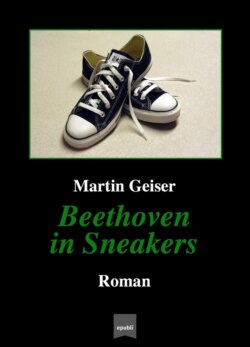Читать книгу Beethoven in Sneakers - Martin Geiser - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4
Im Stübli
April 2016
Da ist erneut die lästige Fliege, die auf meiner Nase herumtanzt und wegen der ich genervt die Augen aufschlage. Mit einem ärgerlichen Grummeln wische ich das Insekt weg, reibe mir den Schlaf aus dem Gesicht und schaue mich um. Das Erste, was ich dabei wahrnehme, ist eine Mutter, die mit zwei Kindern an der Hand an mir vorbei spaziert. Der kleine Junge trägt ein Cap mit dem Emblem des hiesigen Fußballvereins und stiert mich ungeniert und mit großen Augen an. Ich schenke ihm ein breites Lächeln, was bei ihm allerdings nicht so gut ankommt. Er wendet sich von mir ab, krallt sich mit beiden Händen in die Jacke seiner Mutter und beginnt lauthals zu weinen. Die Frau bedenkt mich mit einem harten und vorwurfsvollen Blick, legt ihren Arm um die Schultern des Jungen und zieht ihn weg von mir.
»Blöde Kuh«, murmle ich leise, drücke die Handballen in meine Augenhöhlen und gönne mir so einen kurzen Moment der Ruhe.
Es gibt angenehmere Bilder und Gefühlslagen beim Aufwachen. Eine Matratze, eine weiche Daunendecke, ein Kissen, in Griffweite der Rücken einer schönen Frau – ja, das wär schon was!
Stattdessen schießt mir unerbittlich ein aggressiver, stechender Schmerz in den Kopf, der mich am Aufstehen hindert und mich zwingt, nochmals die Augen zu schließen und für einen kurzen Moment so zu verweilen. So zögere ich den Zeitpunkt des Aufstehens noch eine Weile hinaus, bis ich feststelle, dass den Schmerzen auch mit Geduld nicht beizukommen ist.
Ächzend ziehe ich mich an der Rückenlehne der Parkbank hoch, und augenblicklich werden die Kopfschmerzen von einem Stich in der Wirbelsäule übertüncht. Ich kann einen Aufschrei nicht unterdrücken und beiße verzweifelt die Zähne zusammen. Mein Mittagsnickerchen scheint ein bisschen länger ausgefallen zu sein als ursprünglich geplant, was mir mein Rücken nicht unbedingt zu verzeihen gedenkt.
Langsam, Wirbel um Wirbel streckend, erhebe ich mich, bis ich mich sitzend auf der Bank wiederfinde. Keine Ahnung, wie lange ich dazu gebraucht habe. Meine Stirn ist auf jeden Fall schweißnass, und ich fühle mich, als ob ich gerade die Ziellinie eines Marathonlaufes überschritten hätte.
Vorsichtig stehe ich auf, recke und strecke mich ausgiebig und gähne herzhaft, die Hände in die Hüfte gestützt. Mein Kontrollblick neben die Bank ergibt, dass mein Hab und Gut noch komplett vorhanden ist: Schlafsack, Isomatte und die blaue IKEA-Tasche mit meinen wichtigsten Utensilien. Der iPod steckt auch noch in meiner Hosentasche, somit ist alles da, und ich kann in aller Ruhe wieder Platz nehmen.
Die Beule in meiner Hosentasche verrät mir, dass der Flachmann ebenfalls noch vorhanden ist. Ich klaube ihn heraus und stelle hocherfreut fest, dass er fast noch zu einem Viertel mit Kirsch gefüllt ist. Als ich ihn bereits an meine Lippen geführt habe, halte ich kurz inne und besinne mich eines Besseren. Es wird gewiss noch einen würdigeren Moment geben, um den köstlichen Tropfen zu genießen. So versorge ich die Flasche in meiner Plastiktasche, die ich anschließend durchwühle und tatsächlich noch etwas Mineralwasser finde. Gierig und mit großen Schlucken trinke ich die Flasche leer und zerknülle sie danach geräuschvoll.
Obwohl die Kopfschmerzen noch nicht nachgelassen haben, fühle ich mich etwas besser und betrachte meine Umgebung.
Es ist ein wundervoller Frühlingstag, auf der Münsterplattform tummeln sich zahlreiche Fußgänger. Zu meiner Rechten erheben sich vor dem Gurten majestätisch die Türme des Naturhistorischen Museums. Ein Ausblick, den ich gerne und genussvoll einen Moment auf mich wirken lasse.
Die Sonne steht schon etwas tief und blendet mich. Und erst jetzt wird mir bewusst, dass ich meinen schwarzen Filzhut gar nicht trage, was durch ein überflüssiges Abtasten meines Hauptes noch bestätigt wird.
Ich ohne Hut, das gibt es eigentlich gar nicht, da fühle ich mich komplett nackt. Doch wo könnte er bloß sein? In der Plastiktasche habe ich vorher doch bereits gewühlt, und da war nichts. Verzweifelt suchend drehe ich meinen Kopf nach links und rechts, worauf ich durch einen heftigen Schmerz im Nacken wieder zur Ruhe gemahnt werde.
Verflixt, wurde der mir tatsächlich während meines Mittagsschläfchens geklaut? Ich spreize meine Beine und blicke durch die Bretter der Sitzbank auf den Boden, und tatsächlich: Da liegt er, mein ständiger und treuer Begleiter. Ächzend bücke ich mich, hebe ihn auf und stülpe ihn mir auf den Kopf, nicht ohne ihn vorher mit einem Kuss begrüßt zu haben.
Damit hätte ich meine Siebensachen wieder beieinander und kann mich mit meinem weiteren Tagesablauf beschäftigen.
Hinter mir weckt ein rhythmisches Geräusch, begleitet von aufgeregtem Schreien, meine Aufmerksamkeit. Ich lege einen Arm auf die Banklehne und drehe etwas zu rasch meinen Kopf. Der Schmerz fährt mir augenblicklich in den Nacken, und ich muss mir eingestehen, dass mein Körper für solch ruckartige Bewegungen noch zu wenig Betriebstemperatur erreicht hat.
Mit zusammengebissenen Zähnen massiere ich gründlich den schmerzenden Bereich zwischen den Schulterblättern. Ein Königreich für eine helfende Hand! Eine Liege, duftendes Öl und die professionellen Griffe eines Therapeuten, das wäre nicht zu verachten!
Als ich es endlich schaffe, meinen Kopf zu drehen, stelle ich fest, dass unmittelbar hinter meiner Sitzbank zwei Jugendliche in eine Tischtennis-Partie vertieft sind. Mit ihren gegenseitigen Sticheleien heizen sie sich zusätzlich an, und ich verfolge interessiert den Verlauf des Spiels.
Ich glaube, dass ich früher, ganz früher, als ich noch klein war, auch Pingpong gespielt habe, wahrscheinlich mit meinem Zwillingsbruder. Doch mein Erinnerungsvermögen reicht nicht aus, um klare Bilder aus der Vergangenheit in meinem Kopf erscheinen zu lassen. Auf jeden Fall erreichen die beiden Kontrahenten meiner Meinung nach ein beachtliches Niveau, und ich genieße die Dynamik und das Tempo des Spiels.
Als einer der beiden mit einem Schmetterball das Match beendet, lässt sich der andere erschöpft auf die Knie fallen. Ich applaudiere dem Sieger, der mit erhobenen Händen seinen Triumph feiert und sich nach allen Seiten dreht.
Er grinst mich an und streckt mir den Schläger entgegen.
»Willst du auch mal, Alter? Dann hätte der Loser dort drüben vielleicht mal eine echte Chance.«
Für die Bemerkung erntet er den ausgestreckten Mittelfinger seines Spielpartners. Ich hebe das Kinn und wehre mit einer saloppen Handbewegung ab:
»Muss meine Kräfte vernünftig einteilen. King Roger erwartet mich heute Abend noch auf dem Centre Court.«
»Klar, Alter. Alles cool«, meint der Sieger mit einem wiehernden Lachen und schreitet auf die andere Seite des Tisches, um seinem Partner die Hand zu reichen.
»Mimimimi. Mach nicht so auf schwanger, Mann.«
Mit einem Ruck zieht er ihn hoch und wischt ihm über den Rücken, als ob er soeben das Eidgenössische Schwingfest gewonnen hätte.
»Wichser«, quittiert der Unterlegene und boxt ihn in die Seite. »Revanche?«
»Scheiß auf die Revanche. Energy und Zigarette?«
»Cool, Mann.«
Sie schlagen die Fäuste gegeneinander und winken mir zu, bevor sie Richtung Münsterplatz verschwinden. Ihr Abgang gibt mir die Gelegenheit, mich wieder auf meine momentane Situation zu fokussieren und meinen Körper wieder etwas zu bewegen.
Ich habe keine Ahnung, wie lange ich auf der Bank vor mich hingedöst habe. Ein Wunder eigentlich, dass keiner der Schlümpfe – unsere Bezeichnung für die Bullen – mich aufgeweckt und fortgejagt hat. Aber ich will mich nicht beklagen und erhebe mich vorsichtig. Man soll das Schicksal ja nicht herausfordern.
Ich ergreife den Schlafsack am Riemen, schwinge die Tasche über die Schulter und schlendere langsam Richtung Balustrade, wo ich einen Blick auf die Aare und das Mattequartier werfe.
Mit einem Seufzer schließe ich die Augen und strecke die Nase in die Luft, nehme die Düfte um mich herum wahr. Es riecht nach Frühling, und was gibt es Schöneres als die Erkenntnis, dass die Natur nach ihrer Wiedergeburt sich langsam wieder zu ihrer prallen und prächtigen Schönheit entfaltet.
Dieser philosophische Gedankengang verdient eine Belohnung, und so schüttle ich eine zerbrochene Zigarette aus dem zerknitterten Päckchen und stecke mir die Kippe an.
Gut gelaunt und beschwingt setze ich meinen Weg fort, laufe am Eckpavillon mit dem Lift vorbei und nicke den Gästen des Gartenlokals, die mir aufdringliche und voyeuristische Blicke zuwerfen, freundlich zu.
»Servus«, grüße ich sie, zugegebenermaßen etwas zu laut und zu offensichtlich, sodass sie sich peinlich berührt sogleich wieder von mir abwenden.
Wortfetzen wie unverschämt oder tragisch dringen an meine Ohren, vermögen allerdings meine gute Laune auf keine Art und Weise zu trüben. Da habe ich schon viel schlimme Sachen gehört und über mich ergehen lassen müssen.
Bevor ich die Münsterplattform durch die Gitterabsperrung mit den golden leuchtenden Spitzen wieder verlasse, werfe ich einen Blick zurück und lasse die zauberhafte Stimmung nochmals auf mich wirken. Die Sonnenstrahlen schimmern durch die Bäume, die bereits mit einem stattlichen Grün ausgestattet sind, und die Menschen, welche die Terrasse bevölkern, wirken aufgeräumt und genießen das herrliche Aprilwetter. Ich werfe meine Kippe weg und belohne meine Lunge mit einem tiefen Zug frischer Frühlingsluft. Die satten Aromen lassen mich mit einem lustvollen Aufstöhnen kurz innehalten. Wenn ich die Macht hätte, das Rad der Zeit anzuhalten und den Moment zu konservieren, so wäre dies der richtige Augenblick dafür.
Quengelndes Weinen holt mich aus meinen Tagträumen zurück, und vor mir steht die Mutter mit ihren zwei Kindern, die mir vorher bereits begegnet ist. Wenn mir etwas durch Mark und Bein geht, wie bei einigen Leuten das Geräusch einer Kreide auf Schiefertafel, so ist dies das Kreischen und Brüllen von Halbwüchsigen. Es bereitet mir nahezu körperliche Schmerzen, und am liebsten hätte ich mir die Ohren zugehalten.
Pack deine Racker ein und hau schnellstmöglich mit ihnen ab, denke ich mir und stelle in diesem Moment fest, dass ich den Toreingang zur Münsterplattform so in Beschlag nehme, dass sie mit ihren beiden Schreihälsen links und rechts von ihr gar nicht an mir vorbeikommen kann. So trete ich zur Seite und gebe ihnen mit einer galanten Geste den Weg frei, welche allerdings von keinem der Drei besonders geschätzt oder gewürdigt wird. Die beiden Kleinen schreien lauthals, und die Mutter geht mit gesenktem Blick an mir vorbei.
Kopfschüttelnd schaue ich ihnen nach und fange noch ein paar schimpfende Worte der Frau auf, mit denen sie ihre Kinder zur Räson mahnen will und die ihre Wirkung bei weitem verfehlen.
Nein, das soll nicht der letzte Eindruck gewesen sein, den ich von der Münsterplattform in mir festhalte, bevor ich in die Altstadt zurückkehre! Ich wende mich nochmals dem herrlichen Anblick zu, den ich am liebsten für immer in meine Netzhaut einbrennen würde. Dann ist’s auch für mich Zeit, und ich schlendere durch die Kreuzgasse zum Rathausplatz, wo ich links in die Postgasse einbiege, meinem Ziel entgegen.
Unterwegs begegne ich dem Schorsch mit seinem Schäferhund. Er hat ein blaues Auge und eine geschwollene Lippe. Wahrscheinlich hat er sich wieder wegen einer Kleinigkeit geprügelt.
»Hallo, Schorsch. Wie geht’s? Ist das nicht ein prächtiger Tag?«
»Prächtig?« Ich sehe in seinen Augen Angriffslust aufblitzen. »Ich sage dir mal, was prächtig ist: Unser Stapi, der das Problem mit der Reitschule nicht auf die Reihe kriegt, aber jetzt großspurig eine Biografie seiner Familie veröffentlicht. Nicht mal selber geschrieben hat er sie. Wann auch? Er zeigt sich ja viel lieber im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit bei Apéros und Cüplis anstatt einmal die Ärmel hochzukrempeln und zu arbeiten!«
Er blickt mir während seiner kurzen Brandrede kein einziges Mal in die Augen, dreht dauernd nervös den Kopf nach links und rechts, als ob er kontrollieren müsste, ob er von jemandem verfolgt wird.
Der Schorsch ist unser Veteran, der Dienstälteste auf der Gasse sozusagen. Er ist weit über siebzig Jahre alt, eine kleine, drahtige Gestalt mit schlohweißem Haar, aber dichten, buschigen und tiefschwarzen Augenbrauen, die mich jedes Mal aufs Neue faszinieren. Trotz seines hohen Alters kann er immer wieder erstaunliche Kräfte entwickeln, vor allem wenn ihm irgendetwas nicht in den Kram passt. Dann wird er schon öfter mal handgreiflich. Seine rote Knollennase und die die rotgeäderten Wangen sind Zeichen seiner Vergangenheit als Alkoholiker. Nach einem missglückten Selbstmordversuch beschloss er, sein Leben umzukrempeln. Seit vielen Jahren ist er trocken, lebt vom Sozialamt und bettelt den Rest, den er benötigt, zusammen.
Sein großspuriges und egozentrisches Benehmen ist die Folge seines ehemals übermäßigen Alkoholkonsums. Er muss ständig im Mittelpunkt stehen und kann mit abwertenden und überheblichen Bemerkungen seine Kumpels manchmal gehörig vor den Kopf stoßen. Das hat ihm schon die eine oder andere Beule beschert, wohl gerade letztlich, wie sein geschundenes Gesicht verrät.
Ein bürgerliches Leben ist für ihn nie in Frage gekommen, zu sehr und gerne schimpft er über die unfähigen Politiker und die Adminfuzzis, wie er die Angestellten des Verwaltungsapparats nennt.
Aber er hat auch seine liebenswürdigen Seiten. »Wer kann schon von sich behaupten«, doziert er jeweils für alle die es hören, aber besonders natürlich für diejenigen, die es nicht hören wollen, »dass die ganze Stadt sein Wohnzimmer ist! Ich bin in ganz Bern zu Hause, tout Berne, c’est moi!«
Ein zahnloses Lächeln, gefolgt von einem heftigen Hustenanfall, nicht etwa der Aufregung über unseren Stadtpräsidenten, sondern der zahlreichen Brissagos geschuldet – ja, das ist unser Schorsch.
Nachdem er noch einen Moment über die Politiker gewettert hat, bedeutet er mir, etwas näher zu kommen, macht rasch einen Kontrollblick zu seinem Hund, der sich inzwischen gemütlich niedergelassen hat, und flüstert mir dann ins Ohr:
»Diese Nacht war ich beim Egelsee, und dann sind sie gekommen.«
»Wer ist gekommen?«, flüstere ich zurück, und er straft mich mit einem abschätzigen Blick für diese in seinen Augen saudumme Frage.
»Na, wer wohl? Die Außerirdischen. Ich habe das UFO mit eigenen Augen gesehen. Über dem See ist es geschwebt. Alles war beleuchtet. Ich sage dir, mein Lieber, das Ende ist nahe! Die Menschheit ist am Verdummen. Kein Auge mehr für das wirklich Wichtige. Bloß noch in ihr blödes Gerät starren, das können sie. Aber die Außerirdischen werden uns von diesen Idioten erlösen.« Er packt mich am Arm. »Leute wie mich werden sie verschonen, das ist klar. Leute, die den Durchblick haben. Leute, die wissen, worauf es ankommt. Endlich werden wir vom Abschaum der Menschheit erlöst werden.« Mit kritischem Blick mustert er mich. Das erste Mal, dass er mir in die Augen schaut. »Ich glaube, auch du gehörst zu den Auserwählten. Zu den wenigen, die übrigbleiben.« Er tritt einen Schritt zurück, hebt wissend den Zeigefinger und ergänzt mit lauter Stimme. »Und zuerst werden sie sich unseren Stapi holen, das schwöre ich dir. Und danach unmittelbar diese Idioten aus Russland und Nordkorea. Die Zeit ist gekommen, schon bald ist es soweit.«
Seit seinem Selbstmordversuch ist Schorschs Wahrnehmung leider etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Außerirdische und Verschwörungstheorien gehören zu seinem täglichen Brot.
Er weist den Schäferhund an aufzustehen, verabschiedet sich von mir – »Ich habe noch wichtige Termine.« – und schreitet mit raschen Schritten Richtung Rathaus.
Ich blicke ihm lächelnd nach und nehme dann den Rest meines Weges unter die Beine. Nach ein paar Schritten stehe ich vor dem Stübli, dem öffentlichen Wohnzimmer der Stadt Bern.
Hier, in dieser Oase der menschlichen Wärme, wo nach emotionalen Graden gemessen wird, ist jeder willkommen. Keiner braucht sich zu schämen, man darf sich selbst sein, ohne eine Maske aufsetzen zu müssen. Der Alkoholiker sitzt neben dem Bauarbeiter, der Junkie unterhält sich mit dem Straßenmusiker, die Pensionäre diskutieren mit den Arbeitslosen über die aktuelle politische Lage; alle sind eine große Familie.
Vor der Eingangstüre sitzt Oma Kurti auf der morschen Holzbank und beugt sich über den daneben stehenden Kinderwagen. Die blonde und zerzauste Perücke sitzt schief auf seinem Haupt und würde wohl auseinanderfallen, wenn sie nicht von einem Kopftuch zusammengehalten würde, dessen Farbe unmöglich zu bestimmen ist. Die Essensreste im struppigen Bart zeugen von seiner letzten Mahlzeit, und das geblümte, blaue Kleid hat auch schon bessere Tage gesehen. Darunter trägt er graue Leggins, und seine Füße stecken in knallgelben Gummistiefeln, die so hell leuchten, als seien sie erst gerade geputzt oder neu gekauft worden.
Ich nicke ihm freundlich zu, und er hält sofort den Zeigefinger vor den Mund, um mich zur Ruhe zu mahnen. Er winkt mich zu sich und deutet dann in den Kinderwagen, wo unter der Decke ein verfilzter Teddybär mit nur noch einem Auge liegt. Oma Kurti streichelt ihm zärtlich über den Kopf und flüstert mir dann mit seiner tiefen und scheppernden Bassstimme zu:
»Der Bub ist endlich eingeschlafen. Wir wollen ihn nicht aufwecken. Ist er nicht süß?« Eine gewaltige Alkoholfahne weht mir entgegen, und ich widerstehe erfolgreich dem Reflex mich abzuwenden.
»Allerliebst«, säusle ich zurück. »Wie heißt der Kleine denn?«
»Das ist das Jakobeli«, antwortet Oma Kurti und wirft mir dann einen kritischen Blick zu. Seine Augen flackern unruhig, und der fährt sich mit der Zunge nervös über die kümmerlich geschminkten Lippen. »Bist einer aus dem großen Kanton, gell? Ein Gummihals?« Der Alte lässt seinen kichernden Laut ertönen, der in einen wilden Hustenanfall gipfelt, von dem er sich beinahe nicht erholen kann. Ich klopfe ihm auf den Rücken und merke, wie er sich dabei verkrampft und meiner Hilfe ausweicht.
Unter den zottigen, blonden Stirnfransen, die beinahe bis zur Spitze seiner Hakennase reichen, erkenne ich einen ängstlichen Blick, und so trete ich einen Schritt zurück und ziehe zur Begrüßung meinen Hut.
»Ich bin der Gregor aus Bayern.«
Wie häufig habe ich ihm wohl schon meinen Namen genannt? Oma Kurtis Gedächtnis mit einem Löchersieb zu vergleichen wäre wohl beinahe eine Beleidigung für das Küchenutensil. Ich weiß nicht, wie lange er schon auf der Straße lebt, man munkelt von über dreißig Jahren. Eine lange Zeit, die zusammen mit Unmengen von Alkohol ihre Wirkung hinterlassen hat. Eine gescheiterte Existenz auf der Schattenseite des Lebens. Aber eine Seele von Mensch, in ganz Bern bekannt und beachtet. Wenn er mit seinem Kinderwagen durch die Gassen zieht oder am Bahnhof um ein Almosen bettelt, so zieht er alle Blicke auf sich, und seine Erscheinung lässt keinen kalt.
»Ein Gentleman der alten Schule. Wo gibt es so was heute noch?« Oma Kurti hat sich wieder erholt und nickt mir anerkennend zu. Dann fällt sein Blick in den Kinderwagen und seine Augen verengen sich. »Ach nein, jetzt haben wir das Jakobeli aufgeweckt. Ganz ruhig, mein Schatz.«
Er steht auf und beugt sich tief in den Kinderwagen hinein. Mit leiser und beruhigender Stimme spricht er auf den Teddybären ein und lässt seinen Worten ein Wiegenlied folgen.
Guten Abend, gut’ Nacht, mit Rosen bedacht ...
Er nimmt mich nicht mehr wahr, ist ganz auf den Kinderwagen fokussiert, und ich staune, mit welch heller und klarer Stimme er das Lied von Brahms intoniert.
Ich glaube mich zu erinnern, dass beim letzten Zusammentreffen mit Oma Kurti eine Stoffpuppe mit blonden Zöpfen im Wagen gelegen hat, welche auf den Namen Vreneli getauft war. Vorsichtshalber verkneife ich mir aber die Frage nach ihrem Verbleib, um den Alten nicht aus der Fassung zu bringen.
Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt ...
Mit einem zärtlichen Kuss verabschiedet Oma Kurti den Stoffbären in den Schlaf und streichelt ihm über die pelzige Wange. Als er wieder aufschaut, sind seine Augen wässerig, und eine Träne sitzt im Augenwinkel. Als hätte er meine vorherigen Gedanken gelesen, beginnt er stammelnd:
»Das Vreneli ... nun sind wir zwei halt alleine. Sie hat uns verlassen, war eines Tages plötzlich weg, ist einfach gestorben. Dabei war sie noch so klein.«
Verständnisvoll nickend höre ich ihm zu und frage mich insgeheim, wie eine Puppe wohl gestorben sein kann. War sie kaputt, auseinandergefallen? Oder wurde sie gar von jemandem aus dem Kinderwagen gestohlen? Unvorstellbar für mich, wie man dies einem alten, hilfsbedürftigen Mann antun kann.
»Wir sind immer noch sehr traurig, wir beide«, fährt Oma Kurti fort. »Vor allem das Jakobeli, es geht ihm gar nicht gut. Er vermisst seine kleine Schwester furchtbar. Ich muss ihn ständig trösten, dabei kann ich es selber noch gar nicht fassen.«
Er wischt die Träne weg und zieht die Nase hoch. Ich greife nach seiner Hand, doch erschrocken weicht er mir aus. Verschwommen glaube ich mich zu erinnern, dass er sonst für Berührungen sehr empfänglich ist.
»Kommst du mit hinein?«, frage ich und deute mit dem Kopf gegen die Türe des Stüblis.
»Ach nein, das ist lieb von dir ...« Er scheint erfolglos nach meinem Namen zu suchen. »... du Mann aus dem großen Kanton. Aber mir ist im Moment nicht nach Gesellschaft. Jakobeli und ich brauchen uns nun gegenseitig. Es wird schon wieder besser werden.«
Ich nicke Oma Kurti zu und tippe zum Abschied gegen meinen Filzhut.
Gespannt, wen ich im Stübli alles antreffen werde, trete ich ein und bleibe, nachdem ich die Tür leise geschlossen habe, einen Moment stehen, um die Atmosphäre tief in mir drin aufzunehmen.
Die gewölbte Decke, die weißgetäferten Wände mit den kleinen, gerahmten Bildern – ich kann die wohlige Aufregung in meinem ganzen Körper fühlen. Es ist wie ein Nachhausekommen für mich
Die Tische sind gut besetzt, leises Gemurmel dringt an meine Ohren, und es duftet nach frischem Filterkaffee und warmem Gebäck.
Regula, eine der guten Seelen des Stüblis, hat mich bereits entdeckt und winkt mir zu.
»Du kommst genau richtig!«, ruft sie. »Rate mal, was ich heute für euch gebacken habe.«
»Es riecht verführerisch gut«, gebe ich zur Antwort und hebe demonstrativ meine Nase in die Höhe. »In einem solch exklusiven und edlen Lokal kann es sich nur um Sachertorte und Rumpralinen handeln.«
»Witzbold«, lacht sie und wendet sich wieder ihrer Arbeit zu.
»Beethoven! Ich glaub’s ja nicht!« Der Aufschrei kommt von ganz hinten, und als ich den Kopf in diese Richtung drehe, sehe ich gerade, wie ein Hüne sich von seinem Stuhl erhebt und die Jasskarten auf den Tisch fallen lässt – sehr zum Ärger seiner Mitspieler. »Ta – ta – ta – taaaaa!« Er schmettert das Motiv aus Beethovens Fünfter durch den ganzen Raum und kommt mit ausgestreckten Armen auf mich zu. Als er mich mit seinen Pranken umarmt, bleibt mir beinahe die Luft weg, und gleichzeitig fällt mein Blick auf die Nische hinten im Raum, wo ein Porzellanengel mir seine Flügel entgegenstreckt. Mein ganzer Körper versteift sich, anstatt die kameradschaftliche Umarmung zu erwidern. Die Arme werden schwer, mein Puls beginnt zu rasen, und meine Erinnerungen kreisen wild und ungestüm um einen imaginären Punkt, dem ich mich verzweifelt anzunähern versuche, jedoch nicht zu fassen kriege.
Ein Engel – da war doch irgendetwas. Sehr lange ist es her, und trotzdem ist es noch präsent und versetzt mir einen schmerzhaften Stich mitten in die Brust. Von einer panischen Angst ergriffen, ringe ich nach Luft und beginne zu keuchen.
Die Umarmung erschlafft, und der Riese blickt mich fragend an: »Beethoven? Alles in Ordnung mit dir?«
»Alles gut, Franz.« Einatmen, ausatmen. Ganz ruhig. Langsam normalisiert sich mein Puls wieder, und ich klopfe meinem Gegenüber beruhigend auf die Schulter. »Ein kleiner Schwächeanfall, nichts weiter, worüber man sich Sorgen machen müsste.«
Franz strahlt und umarmt mich nochmals.
»Beethoven! Verfickte Hühnerscheiße! Wo hast du dich bloß wieder rumgetrieben. Wann hab ich dich das letzte Mal gesehen? Mal kurz überlegen ...« Er kratzt sich über seinen dichten Bart und winkt dann ab. »Ist ja egal. Komm mit, setz dich zu uns. Du musst unbedingt den Kuchen kosten, den die gute Regula für uns gebacken hat. Großartig, sag ich nur. Zu einem Jass kann ich dich wohl nicht überreden?«
Er führt mich zum Tisch, wo seine Jasspartner widerwillig ihr Spiel unterbrechen mussten und mich mit argwöhnischen Blicken anstarren.
»Schaut her«, verkündet er feierlich. »Das hier ist unser Beethoven, ein wahrer Kulturfreund. Läuft dauernd mit seinem Knopf im Ohr rum und zieht sich so richtig heavymäßigen Klassikstoff rein. Und ich kann euch sagen, der Kerl versteht auch was davon. Stimmt’s mein Freund?« Er schließt die Augen und bewegt seine Arme, als würde er ein unsichtbares Orchester leiten.
Seine Kumpels zeigen kein Interesse an meiner Person.
»Schon gut, Franz«, meint der eine und deutet auf die hingeworfenen Karten. »Spielen wir jetzt weiter oder machst du einen auf Dirigent?«
»Komm schon«, drängt ein anderer. »Auf so ein gutes Blatt habe ich den ganzen Nachmittag gewartet. Geht’s endlich weiter?«
»Geduld, Geduld, meine Lieben.« Franz ist in seinem Element und geht in der Rolle als Gastgeber völlig auf. »Regula, Kaffee und Kuchen für unseren Freund hier.«
»Spinnst du jetzt komplett?«, kommt es vom Tisch. »Der Laden gehört nicht dir alleine. Dein Mozart kann sich selber bedienen gehen, so wie wir alle es machen.«
»Schön.« Franz zieht eine Schnute. »Dann spielt doch alleine weiter. Ich hab Wichtigeres zu tun.«
Unter lautem Protest führt er mich von den drei Kartenspielern weg und platziert mich an einen freien Tisch.
»Warte hier, Beethoven. Ich hol uns eine kleine Stärkung.«
Mir ist die ganze Situation äußerst peinlich, und ich kann den Ärger von Franz’ Mitstreitern gut verstehen. Ich bin froh, so zu sitzen, dass ich ihnen den Rücken zuwende und nicht in ihre wütenden Gesichter blicken muss.
Franz scheint das alles überhaupt nichts auszumachen. Mit breitem Grinsen stellt er zwei Tassen Kaffee auf den Tisch und hebt mit wichtiger Miene den Zeigefinger.
»Das Gebäck wird uns von der Meisterin höchstpersönlich serviert.« Er deutet auf Regula, die bereits hinter ihm steht, mit zwei großen Stücken Schokoladenkuchen in eine Serviette gewickelt.
Ächzend lässt Franz sich auf den Stuhl sinken und streichelt kurz über Regulas Hand.
»Unsere gute Seele. Und was für eine exzellente Bäckerin. Gott vergelt’s dir, meine Liebe.«
»Seit wann hast du’s denn mit der Religion, du alter Schlawiner?«, stichelt sie und schenkt ihm ein warmes Lächeln. »Guten Appetit euch beiden.«
Und schon ist sie wieder weg. Von hinten vernehme ich wieder Schmährufe, die von Franz mit ausgestrecktem Mittelfinger beantwortet werden, was einen vorwurfvollen Blick von Regula nach sich zieht. Er hebt beschwichtigend die Hände. Es fällt mir auf, dass sie sehr stark zittern, und als er sie vor sich auf den Tisch legt, bestätigt sich dieser Eindruck. Franz fühlt meine kritische Miene und verschränkt die Hände ineinander, wie wenn es ihm peinlich wäre, dass der Alkoholentzug so deutlich zu sehen ist.
Wahrscheinlich arbeitet es in seinem Hinterkopf bereits auf Hochtouren, um die Frage zu beantworten, wann und wie er zur nächsten Bierdose kommen könnte. Meine Gesellschaft scheint ihn zumindest etwas von seiner ständigen Pflichtaufgabe, der Beschaffung von Alkohol, abzulenken.
Er beugt sich nach vorne. »Lassen wir uns von diesen Idioten nicht stören«, flüstert er mir zu, schaut kurz mir kurz über die Schulter zum Tisch seiner ehemaligen Jasskameraden und drängt weiter: »Komm schon, erzähl. Wie ist es dir so ergangen? Wo bist du bloß gewesen? Wochenlang hört man nix mehr von dir, und dann bist du plötzlich wieder da. Ich hab mir Sorgen gemacht, Beethoven, echt jetzt.«
»Moment, Moment«, beschwichtige ich ihn und beiße in den verführerisch riechenden Schokoladenkuchen. Das Gebäck lässt tatsächlich keine Wünsche offen! Mit einem entspannten Stöhnen lecke ich mir die Finger ab und spüle mit einem Schluck Kaffee nach.
»Köstlich, nicht wahr?« Franz nickt anerkennend. »Ein Connaisseur der Haute Cuisine. Unser Beethoven kennt sich eben überall aus! Doch nun erzähl schon, mein Guter. Wo hast du dich rumgetrieben?«
»Mal hier, mal dort. Wo es mir gerade so gefällt«, antworte ich ausweichend. »Bern ist schließlich nicht der einzige schöne Ort auf unserem Planeten.«
»Wie machst du das bloß?« Franz staunt mich mit großen Augen an. Er zupft hektisch an seinem schmutzigen, knallbunt gestreiften Wollpullover herum. »Scheiße, Mann. Nimm mich mal mit. Ich hab keine Ahnung mehr, wie es außerhalb von dieser Stadt überhaupt aussieht. Mensch, Beethoven, du bist so ein cooler Hund! Lass dich nochmals drücken!«
Er steht auf und schließt mich über den Tisch in seine Arme. Ich bin zutiefst berührt und klopfe ihm auf den Rücken. Dann nehmen wir wieder Platz, und ich beginne mit der Erzählung meiner Erlebnisse.