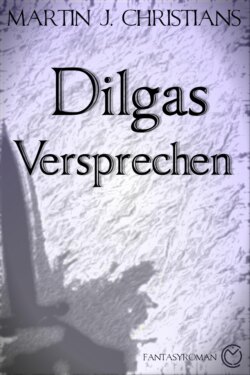Читать книгу Dilgas Versprechen - Martin J. Christians - Страница 10
7.Kapitel
ОглавлениеDie Morgensonne weckte ihn. Sie schien ihm mitten ins Gesicht. Er hatte am vergangenen Abend darauf verzichtet die schweren Samtvorhänge vor das Fenster zu ziehen. Zu sehr hatte ihn das durchsichtige Glas fasziniert. In der Nacht hatte er es noch eine ganze Weile genossen, im warmen Zimmer zu stehen und nach draußen auf den klaren Sternenhimmel zu sehen.
Dilga streckte sich behaglich. Er lag in einem riesigen Bett, mit einer festen Matratze, einer echten Daunendecke und in einem Zimmer, das so groß war, wie die gesamte Hütte der Holzfäller. Sein Blick wanderte über den Tisch, die beiden gepolsterten Stühle, den Kamin und den weichen Teppich. Niemals hätte er es für möglich gehalten, dass er einmal so fürstlich wohnen würde. Neben dem Bett gab es sogar einen Klingelzug für die Diener. Er betrachtete die geflochtene Kordel, brachte es aber nicht über sich, daran zu ziehen. Er rutschte aus dem Bett und sah sich nach seinen Sachen um. Hemd und Hose lagen ordentlich gefaltet auf der kleinen Truhe am Fußende des Bettes, seine Stiefel standen davor.
Es klopfte leise an der Tür. Sofort danach öffnete sie sich einen Spalt und ein Satyr schaute herein. Als der Diener sah, dass er wach war, trat er ein und verneigte sich. Er war kleiner und schmaler als die anderen Diener, die Dilga bisher gesehen hatte. Sein Fell war von einem dunklen braun und er trug eine bronzefarbene Schärpe darüber. Irgendwie erinnerte er ihn an Sitah.
»Soll ich dir eine Waschschüssel bringen, oder wünschst du ein Bad, Herr?« Seine Stimme klang fast wie Gesang.
»Ein Bad?«, fragte Dilga ungläubig. Baden konnte sich ein Söldner nicht oft leisten. Er dachte an die mit heißem Wasser gefüllten hölzernen Zuber in den Badehäusern.
»Ein Bad also«, lächelte der Satyrdiener. Er wandte sich um und öffnete eine Tür, die in die Tapete eingelassen war. Dilga hatte sie bisher nicht einmal bemerkt. Neugierig trat er näher. Der Diener hielt jetzt einen langen Mantel in der Hand. »Wenn du den Morgenmantel anziehen möchtest, Herr. Zum Bad müssen wir ein Stück durchs Haus gehen und es ist kalt um diese Zeit.«
»Ich bin kein Herr.« Es machte ihn nervös so angeredet zu werden.
»Verzeihung!« Der Satyr verneigte sich. »Ich kenne mich mit den Bräuchen der Menschen nicht aus. Wie lautet die korrekte Anrede?«
»Ich heiße Dilga.«
»Ich soll dich einfach bei deinem Namen nennen?«
Er nickte. »Ja, bitte. In meiner Welt zähle ich nicht viel.«
Der Diener musterte ihn aufmerksam. »Hier bist du ein geschätzter Gast meines Herrn.« Damit schien für den Satyr alles geklärt zu sein.
Er schlüpfte in den Morgenmantel, den der Diener ihm unbeirrt hinhielt und folgte ihm dann auf den Gang hinaus. Seine nackten Füße versanken in dem dicken Teppich. »Wie ist dein Name?«
»Zzghu-Nha.«
»Zzghu-Nha«, versuchte er die komplizierten Silben nachzusprechen.
Der Satyr nickte. »Für einen Menschen ist deine Aussprache gar nicht schlecht.«
»Danke.« Sie folgten dem Flur fast bis zum Ende und gingen eine Treppe hinunter.
»Die Bäder liegen am tiefsten Punkt des Hauses«, erklärte Zzghu-Nha. »Das ermöglicht es uns die Wärme aus dem Erdinneren zum Heizen zu nutzen.«
Dilga war beeindruckt. Menschen gruben Keller, dort wo die Erde Kühle versprach und hielten das schon für besonders schlau. Unter seinen Fußsohlen fühlte er die Stufen wärmer werden. Daran änderte sich auch nichts als der Teppich endete und seine Füße über Stufen aus Stein wanderten.
»Wie gedankenlos von mir!« Zzghu-Nha blieb stehen und blickte schuldbewusst auf seine nackten Füße. »Menschen tragen Schuhe.«
»Das ist kein Problem«, beeilte Dilga sich zu versichern.
»Ich kann dir Schuhe fürs Haus holen.«
»Das ist nicht notwendig. Wirklich nicht.«
»Wie du meinst.« Zzghu-Nha öffnete eine Tür, die unmittelbar neben der Treppe lag. Dampf und ein angenehmer Geruch nach Tannen wallte heraus.
Dilga trat ein und staunte. Statt der Zuber, die er erwartet hatte, nahm ein steinernes Bassin fast die Hälfte des Raumes ein. Es war bis zum Rand mit dampfendem Wasser gefüllt, auf dem Schaumkronen schwammen. Am gegenüberliegenden Ende der Bodenwanne saß Loirach. Er hatte die Augen geschlossen.
»Guten Morgen, Mensch«, begrüßte er ihn, ohne die Augen zu öffnen. »Hast du in der Monsterhöhle schlafen können?«
»So gut wie noch nie in meinem Leben.«
Zzghu-Nha trat neben ihn und half ihm aus dem Mantel. Etwas verlegen entledigte er sich seiner restlichen Kleidung. Unter Menschen gehörte es sich nicht, sich vor einem Höhergestellten zu entblößen. Die beiden Satyr sahen darin anscheinend kein Problem. Am Rand des Bassins gab es flache Stufen, die hinunter ins Wasser führten. Vorsichtig ging er in die Wanne hinunter. Das Wasser war heiß und seine Haut rötete sich sofort.
»Nicht zu heiß für dich, Mensch?«
»Nein. Es ist angenehm.« Das Wasser reichte ihm bis zu den Hüften.
»Komm hier herüber.« Loirach öffnete die Augen. »Hier kann man sitzen.«
Er watete durch die Wanne zu seinem Gastgeber. Am steinernen Rand waren Sitzmulden eingelassen. Er setzte sich neben Loirach und lehnte sich zurück. Das Wasser schwappte ihm bis über den Mund. Er prustete und richtete sich wieder auf.
»Hm! Da werden wir wohl etwas basteln müssen, damit du mir nicht ertrinkst!«
Loirach reichte ihm einen bunt emaillierten Tiegel. Er nahm ihn und öffnete den Deckel. Eine herb duftende Seife war darin. Er wusch sich, während Loirach tiefer in seine Sitzmulde rutschte, bis ihm das warme Wasser seinen Hals benetzte.
»Ich habe den Vormittag über außer Haus ein paar Geschäfte zu erledigen.« Loirach pustete eine Schaumkrone zur Seite. »Ich werde dich also nach dem Frühstück eine Weile dir selbst überlassen. Du kannst dich im ganzen Haus und, wenn du möchtest, auch im Park umsehen. Aber bitte verlass mein Grundstück nicht.«
Dilga nickte. Es würde ohnehin Tage dauern allein das Haus zu erkunden und er hatte wenig Lust, ohne Loirachs Begleitung, einem fremden Satyr gegenüberzutreten.
*
In der Nacht war frischer Schnee gefallen und bedeckte die Wege des Gartens. Nur auf den glänzenden schwarzen Steinen, welche die Pfade vom Gras abgegrenzten, lag keiner. Schneeflocken, die auf den Steinen landeten, schmolzen sofort. Dilga hockte sich hin und zog einen seiner Handschuhe aus. Zzghu-Nha hatte ihn mit warmen Wintersachen ausgestattet. Ein paar dicke Socken, Fäustlinge und einen Umhang aus weich gegerbtem Leder, der innen mit Schaffell gefüttert war.
Dilga legte seine Hand auf einen der Steine. Der war warm. Ob sie das auch mit Wärme aus dem Erdinneren machten? Manches von dem, was er in Loirachs Haus gesehen hatte, kam ihm vor wie Magie. Vor allem das Licht. Überall im Haus gab es tagsüber Sonnenlicht, selbst in Zimmern ohne Fenster. Er stand auf und betrachtete das riesige Haus. Von hier sah es aus, als ob es sich mit der Rückwand gegen den Felsen lehnte. Zzghu-Nha hatte versprochen, ihn am Nachmittag durch das Haus zu führen. Falls Loirach das nicht selbst übernahm.
Sein Blick blieb an dem Steingarten hängen, der unmittelbar rechts unter den Fenstern lag. Er lenkte seine Schritte zwischen die künstlichen Hügel, von denen jeder mit unbearbeiteten Steinen bedeckt war. Auf diese Weise sahen sie aus wie Miniaturberge. Auf und zwischen den Hügeln gab es Beete, die jetzt mit Nadelholzzweigen abgedeckt waren. Dilga lächelte. Seine Mutter hatte ihre Kräuterbeete auf dieselbe Weise gegen Frost geschützt.
Zwischen den Rabatten gab es künstliche Teiche, im Moment ohne Wasser. So konnte er sehen, dass auch sie mit flachen Steinen ausgelegt waren. Am Boden jedes künstlichen Tümpels sah er jeweils ein faustgroßes Loch. Sie erinnerten ihn an die mit Pfropfen verschlossenen Abflüsse von Badezubern. Wahrscheinlich dienten sie demselben Zweck. Mit den Augen folgte er den Zuflüssen, die bei wärmerem Wetter das Wasser in die kleinen Tümpel brachten. Sie endeten an der Hausmauer, aus der kupferne Rohre herausstanden.
Dilga verließ den Steingarten und wanderte am Haus entlang. Unter einer hohen alten Tanne stand eine Statue, in Form eines Hundes, der auf seinen Hinterläufen saß. Seine Augen schienen dem Betrachter überall hin zu folgen. Das war unheimlich. Er wandte sich ab, verließ den Pfad am Haus und tauchte in die Büsche und Bäume des eigentlichen Parks ein. Hier waren die Wege schmal und die dunklen Steine dienten nur noch als Begrenzung. Trotzdem lag nirgends Schnee auf ihnen. Vor einer dicken Tanne gabelte sich der Weg. Ihre Äste bogen sich so tief herab, dass ihn ein Tannenzapfen an der Schulter streifte.
Das weckte Erinnerungen an Delia. An eben solchen Zapfen hatte sie ihm den Umgang mit Wurfmessern und Ähnlichem beigebracht. Ein Unterricht der Spaß machte und er hatte Talent im Umgang mit fast jeder Art von Wurfwaffen. Damals zog Delia noch in Erwägung, dass er sie bei ihren Aufträgen begleiten könnte. Unwillkürlich strich seine rechte Hand über den linken Unterarm. Die Dolchscheide fehlte. Ihr Verlust schmerzte ihn. Delias Abschiedsgeschenk an ihn und der verdammte Oligarch hatte sie gestohlen. Zusammen mit seinem ganzen Hab und Gut.
Wie eine unaufhaltsame Flutwelle brach die Erinnerung an die Geschehnisse in Tyralon über ihn herein. Milanas Gesicht erschien vor seinem inneren Auge. Zart wie eine Puppe, goldenes Haar und die Augen so blau wie das Meer. Bei ihrer ersten Begegnung hatte er sie einfach für ein verzogenes Balg gehalten. Ihr Leibwächter hatte er sein sollen. Dafür hatte Oleg ihn engagiert. Niemand hatte ihm gesagt, wie weit seine Aufgaben als ihr Leibwächter gingen. Milana hatte ihn in ihr Bett befohlen und er hatte sich geweigert. Sie war furchtbar beleidigt gewesen und auf ihn losgegangen. Er hatte sie einfach weggestoßen und war gegangen. Leider nicht weit genug. Mit ein bisschen Verstand hätte er sich das nächste Pferd geschnappt und wäre um sein Leben geritten. Er hatte gewusst, dass Milana Olegs Augapfel war und der Oligarch war der Meinung, dass ihm das Recht, sich Milana zu verweigern, nicht zustand. Oleg wollte ihn tot prügeln lassen, aber dann hatte seine Tochter die Idee mit der Hetzjagd gehabt. Mit Grausen erinnerte er sich an ihre kalten Augen, als sie vorschlug ihn wie ein Tier durch die Berge zu jagen. Sie hatte selbst an der Jagd teilgenommen und die Jünglinge immer wieder angestachelt. Zuletzt hatte sie demjenigen eine Nacht versprochen, der ihr Dilgas noch schlagendes Herz bringen würde.
Ihn fröstelte. Einen Moment überlegte er, ob er zum Haus zurückgehen und Zzghu-Nha um einen Tee bitten sollte, entschied sich dann aber dagegen. Der Tag war einfach zu schön um ihn sich durch düstere Erinnerungen verderben zu lassen. Außerdem war er neugierig, ob der Park ähnliche Wunder bereithielt, wie das Haus. Der Hauptweg führte zu einem Baldachin, unter dem eine Bank stand. Feine Ornamente zierten die hölzernen Pfosten, auf denen das Dach ruhte. Von der Bank schaute man auf auf einen kunstvoll gearbeiteten Brunnen, um den sich ein Rosengitter schmiegte. Einen Moment bedauerte er, dass es Winter war. Gern hätte er die Blumen und das Wasserspiel gesehen.
Er folgte dem schmalen Weg, der um die kleine Sitzgruppe herum führte und schnurgerade zwischen hohen Büschen verschwand. Der Pfad endete vor einem geschmiedeten Tor, das in einer Mauer aus bunten Steinen eingefasst war. Die Mauer war zu hoch, um darüber hinweg sehen zu können, also trat er an das Tor heran und spähte durch das Gitter.
Auf der anderen Seite lag ein Park mit wenigen Büschen und riesigen Beeten. Auch hier waren sie sorgfältig mit Zweigen und Blättern abgedeckt. Der Weg, dem er hierher gefolgt war, setzte sich auf der anderen Seite des Tors fort und führte geradewegs auf einen freien Platz hinaus. Dort stand ein Springbrunnen. Ein Laut der Überraschung entwich ihm. Etwas derart Schönes hatte er noch nie gesehen. Der Brunnen war einer natürlichen Klippe nachgebildet, mit aufschäumendem Wasser und Möwen, die gerade im An- oder Abflug begriffen waren. Das Ganze erstrahlte in poliertem Gold. Fasziniert beobachtete er, wie sich das Licht der Wintersonne auf der Oberfläche brach. Zu gern hätte er sich den Brunnen aus der Nähe angesehen.
Plötzlich fiel von der Seite ein Schatten über ihn und dann stand ein Satyr vor ihm. Genau wie Loirach überragte er Dilga deutlich. Sein Fell war grau, an einigen Stellen fast schon weiß und zwei helle Augen funkelten ihn wütend an. Mächtige Klauen packten die Stäbe des Gartentors. Dilga stolperte zurück. Fast wäre er in den Schnee gestürzt. Sein Herz hämmerte, wie bei seiner ersten Begegnung mit Loirach. Der Satyr stieß eine Reihe harter Laute aus, die er nicht verstand. Aber den Hass dahinter begriff er. Der Graue entfaltete seine Flügel. Einen Moment fürchtete Dilga, er würde sich abstoßen und über die Mauer fliegen. Aber der fremde Satyr blieb wo er war und musterte ihn voller Abscheu. Die dolchartigen Zähne blitzend bedrohlich in der Sonne. Unwillkürlich wich er weiter zurück. Wenn dieses Wesen auf ihn losging, war er verloren. Er hatte nicht einmal eine Waffe.
»Reizt dich das Gold?«, herrschte der Graue ihn an. Verachtung und Hass mischten sich in seiner Stimme, als er fortfuhr. »Überlegst du, wie du es stehlen kannst?«
»Ich stehle nicht«, wies Dilga die Anschuldigung empört zurück.
»Das wäre ja was ganz Neues bei einem Menschen. Ihr seid doch toll vor Gier nach Gold.«
»Der Brunnen ist wunderschön«, entgegnete er verstört.
»Wage es dich ihm zu nähern und ich reiße dir die Haut von den Rippen!«
Die Welle des Hasses die ihm entgegenrollte, raubte ihm die Sprache. Das passte überhaupt nicht zu dem, was er bisher in dieser Stadt erlebt hatte. Unfähig sich zu bewegen, stand er da und starrte den Satyr an. Das steigerte den Ärger seines Gegenübers offensichtlich noch. Die Klauen des Wesens legten sich auf den Griff der Pforte.
»Ghornt!« Loirach trat aus dem Schatten einiger Büsche heraus. Mit wenigen Schritten war er neben Dilga.
Die Pforte knirschte, als der Graue sie öffnete. Loirachs Hand legte sich auf Dilgas Bauch und schob ihn hinter sich. »Dilga ist mein Gast!«
Der Graue antwortete in der Sprache der Satyr, aber diesmal klang sie nicht melodisch. Stattdessen war sie voller harter Laute und begleitet von einem feindseligen Zischen. »Er ist ein Mensch!« Ghornt wechselte wieder in die gemeinsame Sprache. »Du hättest ihn nicht her bringen sollen, Loirach. Das war falsch! Sie hat dich mit ihrem Gerede verwirrt.«
Geschockt wanderte sein Blick zwischen den beiden Satyr hin und her. Es war unschwer zu sehen, dass der Graue ihn am liebsten in Stücke reißen würde. Den Ausdruck in Loirachs Augen konnte er nicht deuten.
»Ich bitte dich, Ghornt.«
Loirachs Stimme verriet ihm, dass es zwischen den beiden Giganten ein tiefes und starkes emotionales Band gab.
»Dieser Mensch ist mein Freund!«
Diese Worte bewirkten eine Veränderung bei dem Grauen. Die Wut in den funkelnden Augen wich Unglauben. »Wie kannst du…«, seine Stimme brach. »Hast du sie vergessen?«
»Nein!«
Der Zorn in Loirachs Stimme erschreckte Dilga fast mehr als der Hass des Grauen. Jetzt benutzte auch Loirach die Sprache der Satyr. Auch wenn er die Worte nicht verstand, hörte er wie aufgebracht sein Freund war. Der Graue trat ganz durch das Gartentor und legte Loirach eine Hand auf den Arm. Loirach schüttelte sie ab. So aufgewühlt hatte Dilga ihn noch nie erlebt. Hilflos stand Dilga da. Er wusste nicht, was er tun sollte. Wollte aber auf keinen Fall, dass diese beiden seinetwegen aneinander gerieten. »Loirach…!«
»Geh ins Haus, Dilga!«
Loirachs Stimme duldete keinen Widerspruch. Verstört lief er zum Haus zurück.
*
»Mach dir keine Sorgen.« Zzghu-Nha führte Dilga wieder in das kleine Zimmer mit den Sitzkissen. »Loirach und Ghornt sind alte Freunde.«
Das beruhigte ihn nur wenig. Er hatte Loirach noch nie zuvor wütend gesehen.
»Setz dich, ich bringe dir einen Tee.«
Zzghu-Nha ging, ehe er ablehnen konnte. Dilga setzte sich auf eines der Kissen und überlegte, womit er Loirachs Nachbarn verärgert hatte. Irgendwie hing das mit dem Brunnen zusammen. Es war kaum vorstellbar, dass es Menschen gewagt haben sollten, in die Stadt einzudringen und einen Satyr in seinem eigenen zu Haus zu überfallen. Oder doch? Vielleicht beruhte seine Abneigung auf einem Erlebnis mit einem der Menschen, die hier bei ihnen lebten. Barton hatte gesagt, dass viele von denen, die man den Satyr opferte, Verbrecher waren. Und von was für einer »Sie« war die Rede gewesen?
Zzghu-Nha erschien in der Tür mit dem Tee und unterbrach seine Gedanken. Sie, er wusste mittlerweile, dass sie ein Mädchen war, versuchte beruhigend zu Lächeln, als sie ihm eine Tasse einschenkte.
»Hasst Ghornt alle Menschen, oder habe ich einen Fehler gemacht?«
Mit einem Tuch wischte Zzghu-Nha sorgfältig die Tülle der Teekanne ab, um ein Nachtropfen zu vermeiden. »Er hasst die Menschen, die außerhalb unserer Gemeinschaft leben.«
»Warum?«
»Ihm wurde von Menschen Schlimmes angetan«, antwortete sie bedächtig. »Bitte verstehe, wenn ich nicht darüber rede. Ich weiß es selbst nur vom Hörensagen.« Zzghu-Nha nahm das leere Tablett und zog sich zur Tür zurück.
Er ließ sie gehen. Vielleicht hatte Loirach sein Personal angewiesen, seinen Erklärungen nicht vorzugreifen. Also würde er sich in Geduld üben. Loirach ließ nicht lange auf sich warten. Bald nachdem Zzghu-Nha ihn allein gelassen hatte, tauchte er auf.
»Es tut mir leid, wenn Ghornt dich erschreckt hat«, leitete er übergangslos ein. »Ich hätte dich vor ihm warnen sollen.«
»Warum hasst er Menschen so sehr?«, brach es aus Dilga heraus. Er dachte daran, wie sehr sich Menschen vor den Satyr fürchteten. Menschen hassten, was ihnen Angst machte. Aber es war schwer vorstellbar, dass dieser riesige graue Satyr sich genauso vor Menschen fürchtete, wie diese vor ihm.
»Er hat Grund dazu«, antwortete Loirach ausweichend.
Dilga entging das kurze Aufwallen von Schmerz in Loirachs Augen nicht. Was immer mit Ghornt geschehen war, betraf auch ihn.
»Ich möchte nicht, dass du meinetwegen Streit mit ihm hast«, sagte Dilga betroffen.
Loirach sah in an und lächelte. »Du bist wirklich ungewöhnlich, Mensch. Aber mach dir keine Gedanken. Ghornt ist mein Mentor. Wir haben unsere Differenzen, aber das entzweit uns nicht.«
Der Zorn des Grauen hatte auf ihn nach mehr als nur Differenzen gewirkt, aber er schwieg.
»Du hast mich einmal gefragt, ob alle Satyr die gemeinsame Sprache verstehen…«, fuhr Loirach unvermittelt fort. »Die Antwort ist ja, denn wir haben sie euch beigebracht.«
Dilga brauchte einen Moment um das Gehörte zu begreifen.
»Die Satyr waren einst Lehrer der Menschen«, setzte Loirach seine Erklärung fort. Seit den ersten Tagen, als Menschen in das Reich der Satyr gekommen waren. Damals waren die Menschen noch wild und unzivilisiert gewesen. Tatsächlich waren die Ersten von ihnen Flüchtlinge, die vor einer grausamen Horde Eroberer flohen. Die Satyr gewährten den Fliehenden Asyl und nahmen sich ihrer an. Sie unterrichteten diese Menschen in Kunst, Schrift und Sprache und eine Zeitlang lebten Menschen und Satyr eng zusammen.
Irgendwann zogen die Menschen sich aus den Bergen der Satyr zurück und gründeten ihre eigenen Reiche, aber man unterhielt weiter freundschaftliche Kontakte miteinander. Viele Wissenschaftler der Menschen studierten über Jahre bei den Satyr.
Aber dann begannen die Völker der Menschen sich zu vermehren. Ihre eigenen Gebiete wurden ihnen zu eng und sie führten Krieg gegeneinander, um Nahrung und Besitz. Eine Weile blieben die Satyr von den Kriegen unberührt, bis einige Menschen entdeckten, dass es in ihren Bergen Reichtümer gab. Gold und Erze. Sie fielen in die Gebiete der Satyr ein. Es gab einen fürchterlichen Krieg, den die Menschen verloren. Verträge wurden geschlossen und von den Menschen gebrochen. Eine Weile wiederholte sich das und schließlich zogen die Satyr sich zurück und gestatteten keinem Menschen mehr ihr Land zu betreten. Dass Menschen und Satyr einst zusammengelebt hatten und dass die Menschen ihnen viel verdankten, geriet immer mehr in Vergessenheit.
»Und so wurden aus den Lehrern von einst Monster, die man mit Menschenopfern ruhig halten muss«, schloss Loirach seine Erzählung.
Dilga wusste nicht, was er darauf sagen sollte. Loirachs Geschichte hatte ihn vollkommen erschlagen.
*
Den folgenden Vormittag verbrachte er damit, unter Zzghu-Nhas Führung Loirachs Haus zu erkunden. Der weitaus größte Teil der Villa war in den Berg hineingebaut. Im vorderen Teil befanden sich nur die Gästezimmer, der Speiseraum und ein Audienzsaal. Die Wirtschaftsräume, Loirachs Arbeitszimmer, seine Bibliothek und sogar das Bad, waren tief im Inneren des Felsens. Trotzdem wurden alle Zimmer hell vom Licht der Sonne erleuchtet. Zzghu-Nha lüftete das Geheimnis für ihn. Das Sonnenlicht wurde durch ein Gewirr aus Lichtschächten und Spiegeln ins Haus gelenkt.
»Nicht hineinsehen«, warnte sie und legte ihm eine Hand auf den Arm. »Du könntest böse geblendet werden.«
Dilga starrte das Loch in der Decke an. Zu gern hätte er den Schacht näher in Augenschein genommen.
»Ist es möglich bei Nacht durch die Schächte ins Haus einzudringen?«
Zzghu-Nha schüttelte den Kopf. »Nein. Auf den glatten Oberflächen der Spiegel findet man keinen Halt und es gibt Fangnetze. Hauptsächlich wegen der Vögel.«
Er fragte sich, wie lange es gedauert haben mochte, diesen Palast zu bauen. Die Lichtschächte waren nicht das einzige, was ihn staunen ließ. In der Küche und im Baderaum gab es fließendes Wasser, das über einen Aquädukt von den Bergen herunter kam. Ein weiterer, unterirdisch verlaufender Aquädukt, leitete verschmutztes Wasser zurück in den Berg, wo es in Spalten versickerte.
Außerdem waren die Fußböden der Wohnräume beheizt. Dazu wurde die Wärme aus der Küche genutzt. Ein verzweigtes Netz aus Schächten verteilte sie unter den Zimmern. Fasziniert folgte er seiner Führerin die Treppen wieder hinauf. Zzghu-Nha wollte ihm noch etwas Besonderes zeigen.
»Bereit?«
Er nickte gespannt. Zzghu-Nha trat vor die beiden Türflügel und legte ihre Hände auf die Griffe. Mit einem Blick über ihre Schulter vergewisserte sie sich, dass Dilga ihr gespannt zusah. Sie musste einige Kraft aufwenden, um die Türflügel nach innen zu öffnen. Ihm stockte der Atem. Was er sah, offenbarte mehr Reichtum, als es das gesamte Reich der Oligarchen bieten konnte. Der Raum war rund und hatte die Größe einer kleinen Kathedrale. In jede Wand waren Regale eingefügt. Sie reichten bis zur Decke, die etliche Meter über dem Boden aufragte. Und jedes dieser Regale war bis zum Bersten beladen mit Büchern und Pergamentrollen.
»Das ist fantastisch.« Ehrfürchtig blieb er in der Tür stehen.
»Geh ruhig hinein und sieh sie dir an.«
»Hineingehen?«, fragte er ungläubig. Bibliotheken gehörten zu dem Wertvollsten was Menschen kannten. In ihnen wurde alles Wissen aufbewahrt. Außerdem die Chroniken und die Ursprungstexte der Gesetze. Kein Fürst würde einem Söldner gestatten, seinen Fuß auch nur in die Nähe eines solchen Schatzes zu setzen.
Zzghu-Nha lächelte und wies mit einer anmutigen Geste in den Raum.
»Erlaubt Loirach das?«, fragte er ungläubig.
Ihr Lächeln vertiefte sich. »Herr Loirach ist sehr stolz auf seine Bibliothek. Er zeigt sie all seinen Gästen.«
*
»Hier steckst du?«
Loirach blickte verwundert auf das Buch, das aufgeschlagen vor Dilga auf dem Lesepult lag. Erschrocken sprang er auf. Er war so in seine Lektüre vertieft gewesen, dass er den Satyr nicht hatte kommen hören. Loirach trat näher und sah sich den ledergebundenen Folianten an, in dem Dilga gestöbert hatte. Eine Chronik über den Krieg zwischen Menschen und Satyr.
»Sachranahs Chronik des Unvermeidlichen«, las Loirach laut vor.
Trotz Zzghu-Nhas Versicherung rechnete der Söldner in Dilgas Innerem mit Ärger, weil er es gewagt hatte, eines der kostbaren Bücher in die Hand zu nehmen.
»Kannst du lesen?«, fragte Loirach stattdessen erstaunt.
Dilga nickte. Bei einem Söldner war das fast so ein Wunder wie die Lichtspiegel in Loirachs Haus.
»Hat sich die Welt der Menschen so sehr geändert?«
Er verstand nicht sofort, was Loirach meinte, dann schüttelte er den Kopf. »Nein.« Seufzend fuhr er fort. »Söldner können im Allgemeinen nicht lesen. Die meisten Menschen können es nicht.«
Diese Fähigkeit hatte ihn mehr als einmal in erhebliche Schwierigkeiten gebracht. Unter anderem, weil Kriegsherren ihre Pläne oft achtlos in ihren Zelten herumliegen ließen. Sie gingen einfach davon aus, dass der Pöbel ohnehin nichts damit anfangen konnte.
»Wie kommt es, dass du es kannst?« Loirach setzte sich auf eine der Bänke und bedeutete ihm sich wieder zu setzen.
Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit interessierte sich jemand für seine Vergangenheit. Ein Thema das unter Söldnern ein Tabu war. »Meine Eltern sind halbfreie Bauern. Sie haben Land zur Pacht von einem Gutsherrn«, fing er zögernd an zu erzählen. »Mutter führt die Bücher. Sie hat es mir beigebracht.«
Seine Erinnerungen kehrten in die Vergangenheit zurück. Im Gegensatz zu seiner Mutter, hatte sein Vater es nicht gutgeheißen, dass er Stunden damit verbrachte Lesen und Schreiben zu lernen. »Lass den Jungen was anständiges lernen«, hatte er stets gegrummelt.
»Sind deine Eltern noch am Leben?«
»Ich weiß es nicht.« Er zuckte mit den Achseln. Das Haus seiner Eltern war eine mehrmonatige Reise von Askalon entfernt.
»Wie kommt es, dass der Sohn ehrbarer Leute zu einem Söldner wird? Hast du etwas angestellt?«
Die in Loirachs Frage versteckte Wertung seines Berufs beleidigte ihn nicht. Söldner waren in der Regel keine angenehme Gesellschaft. Die meisten waren dumme, ungebildete Rüpel, die durchaus den ein oder anderen Verstoß gegen Recht und Moral vorzuweisen hatten.
»Nicht mehr als fortzulaufen«, seufzte er. Wenigstens war das sein erster Verstoß gegen das Recht gewesen.
»Erzählst du es mir?«, ermunterte Loirach ihn.
»Da gibt es nicht viel zu erzählen.« Dilga zuckte mit den Schultern. »Ich wollte kein Bauer sein. Ich wollte lernen und mir die Welt anschauen. All die Orte sehen, von denen die Leute im Gasthaus immer redeten.« Ohne dass es ihm bewusst war, runzelte er die Stirn. »Eines Tages heuerte der Gutsherr Söldner an, weil er Streit mit einem seiner Nachbarn hatte. Sie wurden in unserem Dorf einquartiert. Ich hörte ihren Geschichten gern zu und freundete mich mit ihnen an. Von ihnen lernte ich erstmals mit einem Schwert zu kämpfen, was meinen Eltern gar nicht gefallen hat. Sie haben sich beim Herrn beschwert. Der Anführer der Söldner wurde ausgepeitscht und ich eingesperrt«, schloss er.
»Also bist du fortgelaufen«, stellte Loirach fest.
Dilga nickte. Nur sehr vage erinnerte er sich noch an die Nacht, in der er geflohen war. Die Dunkelheit und seine Angst waren längst verblasst. »Ich wollte mich den Söldnern anschließen. Abenteuer erleben, so wie sie. Und etwas über die Welt lernen. Meine Eltern verstanden das nicht und sie hätten es niemals erlaubt. Ich sollte zum Gutsherrn geschickt werden. In seinen Haushalt. Von dort wäre ich niemals entkommen. Also hab ich mich in der Nacht aus dem Haus geschlichen.« Dazu hatte er die Tür zum Dachboden aufbrechen und dann aus dem Flurfenster im ersten Stock des elterlichen Hauses klettern müssen.
»Die Straßen konnte ich nicht benutzen, weil mein Vater und der Grundherr mich sicher suchen ließen. Also bin ich durch den Wald geflohen und habe mich furchtbar verlaufen.« Halb verhungert war er schließlich an der Küste angekommen und dort hatte eine mitleidige Seele ihm erst einmal etwas zu essen gegeben. Ein paar Tage, bis er sich erholt hatte, war er bei der alten Frau geblieben. Zum Dank für ihre Hilfe hatte er Holz gehackt und ihr Häuschen repariert. Sie hatte ihm erzählt, dass an der Küste immer wieder Männer gesucht wurden, die bereit waren auf einem Schiff anzuheuern. Das erschien ihm eine gute Idee, also machte er sich auf Weg dorthin.
»Ich habe mir einige Schiffe angesehen. Das waren richtige Seelenverkäufer.« Er schüttelte sich bei der Erinnerung daran. »Die Vorstellung monatelang, mit einer Bande stinkender Halsabschneider auf einem davon eingesperrt zu sein, gefiel mir nicht. Zumal man sich damit dem Kapitän auf Gedeih und Verderb auslieferte.«
An die Zeit danach, in der er sich mit kleinen Diebstählen und Wilderei durchgeschlagen hatte, dachte er nicht gerne. Sie endete erst, als er auf eine Gruppe Söldner traf, die ihn aufnahm.
»Alves und seine Männer waren in Ordnung. Sie waren ehrlich. Größtenteils«, fügte er lächelnd hinzu. »Von ihnen lernte ich richtig mit einem Beidhänder zu kämpfen und mit einem Bogen zu schießen. Alves unterrichtete mich auch im Nahkampf.«
Der alte Söldnerführer war ein richtiger Schurke gewesen. Es gab keinen faulen Trick, den er nicht kannte. »Irgendwann verloren wir ein Gefecht und die meisten meiner Freunde ihr Leben. Mir gelang die Flucht. Dann bin ich Marodeuren in die Quere gekommen.« Sein Blick verdüsterte sich, bei der Erinnerung daran. »Sie haben mich böse zugerichtet und hätten mich wahrscheinlich getötet, wenn nicht Delia gekommen wäre.« Der Gedanke an seine alte Mentorin und erste Liebe ließ ihn kurz zögern.
»Eine Frau?«, ermunterte Loirach ihn erneut.
Dilga nickte, wieder mit einem Lächeln. »Eine Kämpferin. Die Beste von allen Kämpfern denen ich bisher begegnet bin. Sie kann mit jeder Waffe umgehen und im Nahkampf habe ich sie nie verlieren sehen.« Er erzählte Loirach, wie Delia seine Ausbildung übernommen hatte. Ihn nicht nur mit verschiedenen Waffen und Kampftechniken vertraut gemacht hatte, sondern ihn auch Heilpflanzen und Gifte studieren ließ. Und ihm beibrachte, wie man Karten las und zeichnete. »Sogar zu kochen hat sie mich gelehrt«, beendete er dieses Kapitel seiner Geschichte.
Darüber, dass Delia eine Assassine war und ihn für diesen Beruf rekrutieren wollte, schwieg er. Sein Gefühl sagte ihm, dass Loirach Auftragsmördern keine Sympathie entgegenbrachte. »Irgendwann verließ sie mich und ich zog allein als Söldner weiter. Mit dem Unterschied, dass ich jetzt gut genug war, um auch allein überleben zu können.« Mit wenigen Worten vervollständigte er seinen Lebensbericht, bis zu seinem Treffen mit Oleg, der Jagd durch die Berge und seiner Rettung durch die Holzfäller.
»Ein bewegtes Leben für so einen jungen Menschen«, stellte Loirach fest.
»Ich habe es so gewollt.« Das Leben als Söldner war nicht immer angenehm, aber man war sein eigener Herr. Meistens. Und er würde sich jederzeit wieder dafür entscheiden.
*