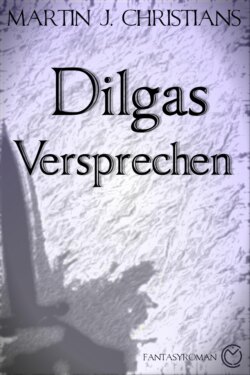Читать книгу Dilgas Versprechen - Martin J. Christians - Страница 9
6.Kapitel
ОглавлениеBlumiger Duft weckte ihn. Dilga öffnete die Augen und setzte sich auf. Loirach hatte den Tisch für ein einfaches Frühstück gedeckt und schöpfte heißen Tee aus dem Kessel in die Becher.
»Guten Morgen, Mensch!«
Dilga faltete die Decke zusammen und schob eines des Kissen, die ihm als Bett gedient hatten, ans Feuer. »Morgen!« Er streckte sich genüsslich und inspizierte das Frühstück. Es bestand aus den Resten, die am vergangenen Abend übrig geblieben waren.
»Du hast einen gesunden Schlaf«, meinte der Satyr.
»Nur wenn ich in Sicherheit bin.« Er nahm einen der Becher und trank einen Schluck.
»Freut mich, dass du anfängst mir zu vertrauen.«
Er antwortete Loirach nicht darauf. Da ihm ohnehin keine Wahl blieb, hatte er beschlossen, das Beste aus der Situation zu machen. Eine Weile aßen sie schweigend. Das Brot schmeckte immer noch frisch und der Tee machte ihn richtig wach.
»Lebst du allein?« Er hatte versucht sich vorzustellen, wie Loirachs Heim wohl aussah, dabei war ihm der Gedanke gekommen, dass der Satyr vielleicht eine Familie hatte.
Loirach zögerte kurz mit der Antwort, dann sagte er: »Lass dich überraschen.«
Fürchtete der Satyr, dass ihm die Antwort nicht gefiel? Dilga wusste es nicht, aber es spielte auch keine Rolle. Er beendete sein Frühstück und zog das Kettenhemd wieder über. Der Satyr erhob keine Einwände. Auch nicht dagegen, dass er sich mit dem Schwert gürtete.
Loirach räumte die Felskammer auf, erst dann schob er den Findling beiseite. Graues Tageslicht fiel herein. Die Sonne war noch nicht richtig aufgegangen. Dilga trat ins Freie und fröstelte. Zu dumm, dass er keine Zeit gehabt hatte, seinen Umhang mitzunehmen. Loirach verschloss seinen Schlupfwinkel sorgfältig.
»Du musst wieder hinunterklettern«, damit deutete der Satyr auf den Weg, dem sie gestern Abend hierher gefolgt waren.
Dilga trat an den Rand des Felsens und schaute hinunter. Das war ganz schön tief. Von unten hatte es nicht so hoch ausgesehen. Er wandte sich um und sah sich nach einer geeigneten Wurzel um, die sein Gewicht trug. Loirach hob vom Boden ab. Diesmal verzichtete der Satyr darauf voran zu fliegen. Er wartete, bis Dilga sich hingekniet hatte und seine Beine über die Felskante baumelten. Loirach flog hinter ihn, während er mit einem Fuß nach einem Halt tastete. Der Abstieg gestaltete sich schwierig. Entsprechend langsam ging es voran. Die ganze Zeit sicherte der Satyr ihn gegen einen Absturz. Dilga fragte sich, ob Loirach wohl die Kraft hatte, ihn im Flug zu tragen. Wischte den Gedanken dann aber beiseite. Fliegen gehörte nicht zu den Dingen, die er sich wünschte.
»Du hast es gleich geschafft«, unterbrach Loirach seine Gedanken.
Schließlich stand er wieder auf festem Boden und sah sich um. Die Nadelbäume waren hoch und einige hatten dichte Kronen, trotzdem war der Wald längst nicht so dicht, wie der Mischwald weiter unten. Loirach führte ihn ein Stück auf dem Weg zurück, den sie am Vortag gekommen waren, bevor er auf einen Trampelpfad einbog, der unter die Bäume führte. Dieser Weg wurde eindeutig vom Schnee freigehalten. Neugierig sah er sich nach weiteren Spuren einer Bewirtschaftung um, konnte aber keine entdecken.
»Hättest du Mort wirklich getötet?« Dilga dachte an das blasse Gesicht des Holzfällers.
»Ich mag es nicht, wenn man versucht mich hinterrücks zu ermorden. Da reagiere ich empfindlich, weißt du.«
Die eigentümliche Art des Satyrs machte es Dilga unmöglich, in ihm länger eine gefährliche Bestie zu sehen. »Wieso hast du in der Höhle nach mir gesucht?«, forschte er weiter und wich einem tiefhängenden Ast aus.
»Es war meine Schuld, dass du in die Ogerhöhle gefallen bist. Du hättest schwer verletzt sein können. Dann wärst du diesen widerlichen kleinen Biestern hilflos ausgeliefert gewesen.«
»Was hätte dich das gekümmert?«
»Wieso hast du Sitah gerettet?«, antwortete Loirach mit einer Gegenfrage.
Er dachte darüber nach. Loirach schien ihm in einigen Dingen ähnlicher zu sein, als viele Menschen. Unvermittelt gabelte der Pfad sich vor ihm. Sie waren stetig weiter bergauf gegangen und die Bäume hier waren hoch, mit schlanken, biegsamen Stämmen. Der eine Weg führte weiter in den Wald hinein, der andere endete vor einer Felswand. Dilga wandte sich dem Waldweg zu.
»Halt!« Loirach deutete auf die Felswand. »Wir müssen da hinüber.«
Achselzuckend wandte er sich um und blieb schließlich vor der Wand stehen. Sie erstreckte sich nach links und rechts, soweit er sehen konnte. Höhleneingänge oder einen Weg hinüber sah er nicht. »Wo geht es weiter?« Ratlos blickte er an der glatten Felswand hoch.
»Hab ich dir schon gesagt«, schmunzelte Loirach. »Wir müssen über die kleine Wand da hinüber.«
»Ich hab keine Flügel, falls dir das entgangen ist.«
»Ich werde dich tragen.«
»Fliegen?« Erschrocken wich er zurück.
»Nun ja, eine derart steile Wand kann auch ich nicht hinauflaufen, also fliegen wir«, meinte Loirach munter.
»Nein!« Heftig schüttelte Dilga den Kopf.
Loirach packte blitzschnell zu. Er erwischte ihn am Handgelenk, zog ihn an sich heran und drehte ihn mit dem Rücken zu sich. Das weiche Fell des Satyr kitzelte ihn am Nacken, dann verlor er den Boden unter den Füßen. Panik überkam ihn und er versuchte sich aus dem festen Griff des Satyr zu winden. Sie gewannen schnell an Höhe. Die vorher mächtigen Bäume sahen plötzlich aus wie Kinderspielzeug.
»Soll ich dich wirklich loslassen?«, keuchte Loirach angestrengt.
Dilga warf einen Blick nach unten, stellte seine Gegenwehr ein und schloss die Augen.
»Mach die Augen auf, sonst wird dir nur übel«, empfahl Loirach.
Dilga hatte keine Ahnung, woher Loirach wusste, dass er die Augen geschlossen hatte. Aber aufmachen wollte er sie auf keinen Fall. Auch wenn ihm tatsächlich übel wurde.
»Wenn du dich übergeben musst, achte bitte darauf, mein Fell nicht zu verunreinigen, ja?«, bat der Satyr.
Trotz seiner Panik musste Dilga lachen. Ganz vorsichtig öffnete er seine Augen einen Spalt. Fast unmittelbar neben ihnen flog ein Rabe. Das schwarze Gefieder glänzte in der Sonne und der Vogel schien nicht im Mindesten beeindruckt von dem Satyr und seiner Last. Fasziniert beobachtete Dilga das elegante Tier aus der Nähe. Er mochte Raben. Sie waren richtige Akrobaten in der Luft und außerdem schlau. Der Rabe krächzte und drehte ab. Langsam schraubte er sich tiefer. Dilga schaute von oben auf die ausgebreiteten Flügel hinunter und dann weiter nach unten. Sie waren hoch. Verdammt hoch. Die Welt unter ihm sah aus wie eine Miniaturnachbildung, wie man sie manchmal auf Jahrmärkten sehen konnte. Sein Herz hämmerte wild.
Loirach änderte seinen Kurs und flog auf den Gipfel zu. Damit kam der Boden wieder näher; war aber immer noch zu weit weg, um einen Sturz aus dieser Höhe zu überleben. Dilga kämpfte darum seinen Atem zu beruhigen. Er mochte es nicht, sich auf jemanden blind verlassen zu müssen. Auf der anderen Seite des Berges begann Loirach einen gemächlichen Sinkflug. Sehnsüchtig schaute Dilga dem Boden entgegen, dem sie sich nur langsam näherten. Allmählich gewannen die Bäume und Felsen unter ihm an Größe, bis sie schließlich wieder ihre normalen Ausmaße hatten. Vorsichtig setzte Loirach ihn ab. Dilga brauchte einen Moment um sich zu sammeln. Hinter sich hörte er den Satyr schwer atmen. Erschrocken wandte er sich um. Loirach hatte sich auf einen Felsen gestützt und japste nach Luft. Sein Fell war schweißnass.
»Was hast du?«, fragte Dilga alarmiert.
»Du bist nicht gerade ein Leichtgewicht«, keuchte der Satyr.
Betreten schaute Dilga an sich herunter. Zusätzlich zu seinem eigenen Gewicht, trug er auch noch das Kettenhemd und den Schwertgürtel. Der Satyr verfügte wirklich über eine beeindruckende Kraft.
»Komm! Gehen wir weiter«, schlug Loirach vor.
Sie ließen die steile Felswand hinter sich und folgten einem breiten Einschnitt zwischen den Bergen. Hier gab es keine Bäume. Nur aufragendes Gestein und Schnee.
*
Eine massive Mauer versperrte ihnen den Weg. Dilga schätze ihre Höhe auf gut zehn Meter. Genau in der Mitte gab es ein Tor. Zwei schwere hölzerne Türflügel, kunstvoll mit Kupfer beschlagen.
»Was ist das für ein Tor?«, fragte er mit einer mulmigen Vorahnung.
»Es versperrt den Zugang zur Stadt.«
»Stadt?«, echote er benommen. Dass Loirach in keiner einfachen Höhle hauste, war ihm mittlerweile klar geworden, aber eine Stadt? Verstanden die Satyr darunter dasselbe wie Menschen? Langsam ging er auf das mächtige Tor zu.
Beide Flügel öffneten sich geräuschlos, noch ehe er sie erreicht hatte. Ein Satyr trat heraus. Er war genauso groß wie Loirach, aber sein Fell war von einem hellen grau. Ganz ähnlich einem menschlichen Wächter, trug er eine gewaltige Axt am Gürtel und auf seinem Rücken hing eine Armbrust, die ein Mensch allein nicht einmal hätte tragen können.
Beklommen blieb Dilga stehen, aber der fremde Satyr beachtete ihn gar nicht. Stattdessen verneigte er sich tief vor Loirach. Die beiden wechselten ein paar Worte in einer gutturalen Sprache, die er nicht verstand, dann bedeutete Loirach ihm weiterzugehen. Mit klopfendem Herzen passierte Dilga das Tor. Dahinter setzte sich der Gebirgseinschnitt fort. Allerdings hatte jemand auf dieser Seite einen breiten Weg angelegt. Und der wurde sorgfältig von Eis und Schnee freigehalten. Er betrachtete die Steine zu seinen Füßen. Sie waren poliert und nahezu fugenlos ineinander eingepasst. Das Tor schloss sich hinter ihm. Er wandte sich um und sah den Satyrwächter durch einen Eingang im Felsen verschwinden.
»Wozu das Tor und die Wache?« Kein Mensch allein konnte die steile Felswand überwinden, über die Loirach ihn getragen hatte. Oder galt diese Vorsicht feindlichen Satyr?
»Wegen der Oger und der Gogs«, erklärte Loirach. »Ist alles in Ordnung mit dir, Mensch?«
»Wie viele Satyr gibt es?« Es gelang ihm nicht, die Furcht aus seiner Stimme zu verbannen.
»Nicht so viele, wie Menschen.«
Zögernd machte Dilga kehrt und folgte dem Weg. Vor ihnen öffnete sich ein weites Tal. Trotz der dicken Schneedecke sah er sorgfältig angelegte Felder und auch Plantagen. In der Ferne gab es ein Dorf. Rauch stieg aus den Schornsteinen auf. War das ihr Ziel? Aber etwas stimmte nicht daran. Erneut blieb er stehen und betrachtete die Häuser. Für einen Satyr und seine Familie kamen sie ihm viel zu klein vor. »Wer lebt dort?«
»Menschen!«
»Sklaven?« Er erinnerte sich an die Opfer, die man niemals wieder sah.
»Wieso denkst du das?«
Dilga zuckte mit den Schultern.
»Einige sind frei, ein paar sind Hörige«, erklärte Loirach schließlich, während sie weitergingen.
Die dünne Luft trug jetzt schwache Geräusche zu ihnen herüber. Er folgte Loirach um eine Felsnase und blieb abrupt stehen. Zwar hatte Loirach am Tor von einer Stadt gesprochen, aber das hatte ihn nicht auf diesen Anblick vorbereiten können. Die Stadt war gigantisch! Sie zog sich die Rückwand eines Berges hinauf. Teilweise schienen die Häuser sogar in den Fels hineingebaut zu sein. Marmordächer glänzten in der Wintersonne. Auf dem abgeflachten Gipfel des Berges, hoch über allen Häusern, thronte ein gewaltiger Palast. Eine Stadtmauer gab es nicht, dafür glänzten am Fuß der Stadt ein paar Hütten, die ganz aus Glas zu sein schienen. »Was ist das?«, verblüfft zeigte er auf die Glashütten.
»Gewächshäuser«, erklärte Loirach.
Verständnislos sah er den Satyr an.
»Komm mit.« Loirach setzte sich wieder in Bewegung. »Ich zeig es dir.«
Schnell näherten sie sich der Stadt. Ihn schwindelte. Er konnte nicht einmal schätzen wie viele Satyr hier lebten. Aber anscheinend kannten sie Hierarchien, genau wie die Menschen. Wenigstens unterschieden sich ihre Häuser in Größe und Prunk voneinander. Die Großartigsten lagen, umgeben von Parkanlagen, direkt unterhalb des Palastes. Je näher sie kamen, desto lauter wurden die Geräusche die aus der Stadt zu ihnen herüber drangen. Sie waren anders als die einer Menschenstadt. Mit Ausnahme des Rauschens einer Wassermühle, hörte er keinen Lärm, wie ihn die verschiedenen Gewerbe verursachten. Die meisten Geräusche, die er hörte, identifizierte er als gesprochene Laute. Tiefe gutturale Töne, ähnlich denen, in denen sich Loirach mit dem Wächter verständigt hatte, und dazwischen hörte er einen sanften Singsang.
Vor ihm ragte eines der Glashäuser auf. Fasziniert betrachtete Dilga die riesigen Scheiben. Er hatte nicht gewusst, dass man sie in dieser Größe herstellen konnte. Und derart klar! Die Scheiben, mit denen die Dächer gedeckt waren, sahen aus wie gefrorenes Wasser und die an den Seitenwänden waren von einem durchscheinenden weiß. Er sah die Silhouetten von Satyr und einigen Menschen durch sie hindurch. Und Pflanzen? Verwirrt betrachtete er das Schattenspiel. Die meisten Menschen hatten nicht einmal Scheiben in ihren Fenstern. Das war Leuten von Stand vorbehalten, weil Glas kaum zu bezahlen war. Und sie waren auch nicht aus klarem Glas, sondern eher farbige Mosaike. Sein Blick blieb an einer Tür hängen. Selbst die war aus Glas. Rau, milchig und irgendwie hatten die Satyr es geschafft Scharniere und eine Klinke daran anzubringen. Ehrfürchtig fuhr er mit der Hand darüber.
Loirach lächelte, wie ein Vater, der seinem Kind seine Werkstatt zeigt und öffnete die Tür. Ein Schwall warmer, schwüler Luft schlug ihm entgegen. Im Gebäude sah Dilga eingefasste Beete in denen Blumen blühten und buschige Kräuter, deren Gerüche sich zu einem betörenden Duftcocktail vermischten. Zwischen den Pflanzungen liefen Satyr mit Gartenwerkzeugen herum. Hacken, Schaufeln und sogar Schubkarren, wie menschliche Bauern sie benutzten. Nur größer. Dilga hatte noch nie gesehen, dass man so viele Blumen anbaute. Und das auch noch in Glashäusern, die anscheinend geheizt wurden. Es war so warm darin, dass ihm der Schweiß übers Gesicht lief, dabei waren sie an der Tür stehen geblieben. Ein Satyr näherte sich ihnen. Sein Fell war von einem matten braun. Er verbeugte sich vor Loirach und sie unterhielten sich, dabei schaute der Braune ihn ein paar Mal neugierig an. Zu seinem Bedauern schloss Loirach die Tür dann wieder und führte ihn weiter die Straße hoch.
»Häuser für Blumen?« Er war noch immer überwältigt.
»Sie werden dort nur gezüchtet«, erklärte Loirach. »Niemand will im Winter auf Blumen verzichten, oder? Einige sind außerdem Heilpflanzen. Und natürlich bauen wir neben Blumen und Kräutern auch Gemüse an.«
Frisches Gemüse im Winter. Das war unglaublich! Und dann dieser Aufwand für Blumen, die nur als Schmuck dienten!
»Woher kommt die Wärme?« Er hatte keine Kamine oder Öfen gesehen.
»Aus dem Inneren des Berges.« Seine Wissbegierde schien Loirach zu gefallen. »Wir leiten sie über Kanäle und Rohre nach oben.«
Dilga hatte schon von Vulkanen gehört und konnte sich vorstellen, dass ihr flüssiges Feuer unter den Bergen floss. Das war wahrscheinlich heiß genug, um als Wärmequelle zu dienen. »Macht ihr alle Arbeiten in solchen Glashäusern?«.
»Nein. Dort züchten wir nur Pflanzen. Die meisten Handwerker haben ihre Werkstätten im Inneren des Berges, hinter ihren jeweiligen Wohnhäusern.«
Dilga betrachtete die Häuser. Sie waren alle aus dem Felsen heraus geschlagen worden. Aber nichts deutete darauf hin, dass in ihnen auch gearbeitet wurde. Man hörte kein Hämmern oder Sägen und es gab auch keine üblen Gerüche. Er schnupperte. Überhaupt roch es nicht wie in einer Menschenstadt. Es stank nicht und nirgendwo war Dreck zu sehen. Neben den Straßen rann keine Kloake aus geleerten Nachttöpfen. Alles war sauber, die Gerüche irgendwie blumig, sanft und lieblich. Ihm fehlten die richtigen Worte, um es zu beschreiben.
Loirach führte ihn weiter den Hang hinauf. Die Wege, die anfangs mit dunklen Steinen gepflastert gewesen waren, zierten jetzt Mosaike. Er konnte keine Bilder in den Mustern erkennen, aber sie waren hübsch. Seine Aufmerksamkeit kehrte zu den Häusern zurück. Keines sah aus wie das Nachbargebäude. Jedes von ihnen schien in Bau und Schmuck einzigartig zu sein, verziert mit Stuck, Metall oder farbigen Holzarbeiten. Und trotzdem passten sie alle zusammen.
»Gar nicht schlecht für Monster, oder?« Loirach zog seine Lippen weit von den Zähnen zurück und offenbarte ein Lächeln, das einen ganzen Hofstaat in Ohnmacht niedersinken lassen könnte.
Die Satyr waren den Menschen in allem überlegen. Dilga konnte nicht sprechen, so überwältigt war er.
»Du bist ein wenig blass, Mensch.« Loirach nahm seinen Arm. »Du fällst mir doch nicht in Ohnmacht?«
*
Wie in Trance folgte er Loirach. Das war alles zu viel! Vor wenigen Wochen noch waren die Satyr für ihn nicht mehr als eine Legende gewesen, die dann plötzlich reale Gestalt angenommen hatte. Und jetzt erwiesen sich diese vermeintlichen Monster als großartige Baumeister, die wahre Kunstwerke aus Felsen und Glas bauten. Die ganz selbstverständlich Wärme aus dem Inneren der Erde nutzten, um im Winter frisches Gemüse zu haben. Und Blumen! Er wagte kaum sich vorzustellen, was als nächstes kam.
Loirach führte ihn zu den Häusern unterhalb des Palastes. Vor einem Tor aus geschmiedetem Silber blieb er stehen. Überwältigt spähte Dilga durch die filigranen, ineinander verschlungenen Stäbe. Noch mehr Wunder konnte er nicht verkraften. Hinter dem Tor lag ein gewöhnlicher Park im Winterkleid. Eine dicke Schneedecke breitete sich auf den Flächen aus und die Bäume trugen keine Blätter. Auf den schneebedeckten Ästen der Nadelbäume turnte ein Eichhörnchen herum. Dilga atmete tief durch. Loirach öffnete die Pforte. Wie aus dem Nichts tauchte ein grauer Satyr auf und verbeugte sich vor ihm. Dilga betrachtete die bunte Schärpe des Grauen. Schon in der Stadt war ihm aufgefallen, dass viele Satyr Schärpen in unterschiedlichen Farben trugen.
Loirach beachtete den Grauen kaum. Sanft schob er Dilga auf den Weg hinter der Pforte. Die Steine knirschten unter seinen Stiefeln, als er auf das Anwesen zuging. Villa war eine untertriebene Bezeichnung für dieses Schloss. Es ragte hoch auf. Mit Sicherheit hatte es mehrere Etagen, selbst wenn man die Größe der Satyr berücksichtigte. Und auch hier hatten die Fenster Scheiben. Nicht nur einige, sondern jedes Fenster, das er sehen konnte. Und dann die Stuckarbeiten und die anderen Verzierungen an den Wänden. Teils farbige Muster, von denen einige sich zu bewegen schienen.
»Gefällt dir mein Haus?«, fragte Loirach.
»Darum würden dich viele menschliche Herrscher beneiden.« Abrupt blieb Dilga stehen. Er erinnerte sich daran, wie respektvoll die anderen Satyr Loirach gegrüßt hatten. Viele hatten sich sogar vor ihm verbeugt.
»Mensch?« Loirach war einen Schritt vor ihm stehen geblieben und sah zu ihm zurück.
»Du bist kein einfacher Satyr«, stellte Dilga verunsichert fest.
Loirach grinste. »In deiner Welt wäre ich ein Herzog.«
Der Schreck fuhr Dilga in die Knochen. Einem Herzog gegenüber hatte er es eindeutig an Respekt fehlen lassen. Er schlug die Augen nieder. »Ich bitte um Vergebung für mein Benehmen.«
»Lass den Quatsch, Dilga.« Loirachs Hand legte sich unter sein Kinn und drückte es hoch. »Du bist mein Gast.«
»Aber… ich bin…«, stotterte er.
»Mensch«, seufzte Loirach ergeben. »Benimm dich einfach so, als wärst du unter Deinesgleichen.« Der Satyr ging ein paar Schritte und blieb dann stehen. »Oh!« Er runzelte die Stirn. »Das heißt, ich wäre dir schon dankbar, wenn du nicht auf den Teppich spuckst.«
»Ich würde nie…«, hob Dilga erschrocken an.
Loirach schüttelte sich vor Lachen. Der Satyr legte ihm eine Hand auf den Rücken und schob ihn die Stufen zur Haustür hinauf. Schon wieder hatte er ihn auf den Arm genommen.
Die Tür öffnete sich und ein weiterer Satyrdiener erschien. Er verbeugte sich vor seinem Herrn und begrüßte ihn wortreich. Ihn betrachtete der Diener wie ein Haustier, von dem man sich fragt, wie viel Schmutz es in die gute Stube trug. Loirach nickte zur Begrüßung und bedeutete Dilga einzutreten. Der Diener wich zur Seite. Dass sein Herr ihm Vortritt gewährte, änderte sein Verhalten. Jetzt deutete er sogar eine kleine Verbeugung an, als Dilga an ihm vorbei ging.
Die Eingangshalle war kleiner, als er nach der Größe des Hauses erwartet hatte, aber sie beeindruckte durch ihre Gestaltung. Den Fußboden zierte ein verschlungenes Muster aus verschiedenfarbigem Marmor. Dazu passend reihten sich an den Wänden halbhohe Säulen entlang. Auf jeder davon stand eine gläserne Vase mit frischen Blumen, die den Eingangsbereich mit ihrem Duft füllten. Von irgendwoher fiel Licht ein, obwohl er kein Fenster sehen konnte und auch keine Lampen oder Kerzen.
Hinter ihm sagte Loirach etwas in der fremden Sprache zu seinem Diener. Darauf erschien der Graue neben Dilga und verbeugte sich.
»Wenn ihr ablegen wollt, Herr.«
Verblüfft starrte Dilga den Grauen an. Noch nie hatte ihn jemand »Herr« genannt.
»Dein Schwert und das Kettenhemd, Dilga.« Loirach trat neben ihn. »Wir tragen kein Kriegszeug in unseren Häusern.«
Er löste seinen Schwertgürtel und reichte das Waffengehänge dem Diener. Der nahm es vorsichtig entgegen und hielt es auf Armlänge von sich, fast so, als könnte es ihn selbstständig anspringen.
*
»Armer Mensch!« Mit gespieltem Mitleid schüttelte Loirach den Kopf. »Verschleppt von einem Monster, das nicht die geringste Rücksicht auf deinen Stand nimmt.«
Dilga verstand den Seitenhieb und grinste. Loirach hatte ihn in einen kleinen Salon geführt, an dessen Wänden Gobelins hingen. Im Kamin prasselte ein warmes Feuer und sie hatten es sich auf ledernen Kissen bequem gemacht.
Ein Satyrdiener trat ein. Er hatte braunes Fell und war ebenso groß wie Loirach. Quer über der Brust trug er eine goldene Schärpe. Vorsichtig stellte er ein Tablett auf dem flachen Tisch ab, der zwischen den Sitzkissen stand. Zwei Kannen mit duftendem Kräutertee und eine großzügige Auswahl an geschnittenem Obst und frischem Gebäck lagen darauf. Der Satyr nickte ihm grüßend zu, dann unterhielt er sich mit seinem Herrn. Dilga beobachtete Loirachs Mienenspiel. Seinem Gastgeber schien nicht alles zu gefallen, was er hörte. Schließlich nickte er und winkte seinen Diener hinaus.
»Greif zu.« Loirach wählte eine Kanne aus und goss Tee in die beiden Becher.
Dilga nahm sich ein Gebäckstück und biss hinein. Es war nicht so süß, wie die klebrige Oberfläche vermuten ließ und es schmeckte herzhafter, als die weiße Farbe versprach. Loirach schob ihm eine der großen Tassen hin und nahm sich ebenfalls etwas von dem Backwerk. Für ihn war es kaum mehr als ein Keks, den er mit einem Bissen in den Mund steckte.
»Deinem Diener an der Tür hat mein Schwert und das Kettenhemd nicht gefallen«, stellte Dilga fest.
»Richtig beobachtet.« Loirach nickte. »Das Kriegshandwerk genießt bei uns kein Ansehen.«
»Aber es gibt Krieger bei den Satyr?« Der Gedanke, dass Krieger kein Ansehen genossen, war ihm sehr fremd. Das traf bei den Menschen nur auf Söldner zu, aber die galten auch nicht als Krieger. Man sah sie eher als Mörder.
»Nur sehr wenige.« Loirach trank einen Schluck und fügte erklärend hinzu. »Satyr führen keine Kriege gegeneinander.«
Es dauerte einen Moment, bis Dilga begriff, was Loirach ihm damit sagte. Wenn sie keinen Krieg gegeneinander führten, kam nur noch ein Gegner in Frage. Aber er hatte noch nie von einem Krieg zwischen Menschen und Satyr gehört. Trotzdem frage er: »Aber gegen Menschen?«
Loirach nickte. Die großen Augen sahen einen Moment durch ihn hindurch, so als ob sie in eine ferne Vergangenheit blickten. Ganz kurz meinte Dilga Schmerz in ihnen zu sehen.
»Vor langer Zeit gab es einen Krieg zwischen Menschen und Satyr«, sagte Loirach schließlich und sah ihn traurig an. »Ich werde dir davon erzählen, Dilga. Aber nicht heute!«
Sein Gastgeber schenkte ihm und auch sich selbst Tee nach. »Du bist seit mehr als hundert Jahren der erste freie Mensch, der als Gast in einer Satyrstadt ist.«
Krieg und der erste Gast seit hundert Jahren. Also hatte es einmal mehr Kontakt zwischen Satyr und Menschen gegeben. Ehe sie zu fliegenden Monstern wurden. Dilga platzte vor Neugier, aber er respektierte Loirachs Wunsch und stellte keine Fragen mehr dazu.
*