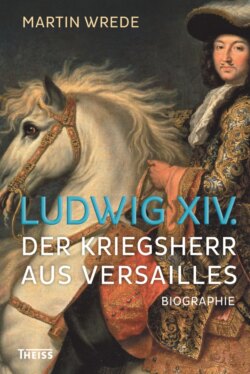Читать книгу Ludwig XIV. - Martin Wrede - Страница 13
Die Einrichtung der Macht
ОглавлениеEs gab bei der Neuverteilung der Macht auch andere Verlierer, nicht nur Anna von Österreich. So wurde der Kanzler Séguier, der noch ein Mann Richelieus war, zwar in seinem Amt bestätigt, aber aus dem neu zugeschnittenen engeren Rat verbannt. Überhaupt wurde dieser engere Rat fortan nur noch von vier Personen gebildet: Neben dem König waren dies zunächst der Finanzminister Fouquet, der Kriegsminister Le Tellier und der Staatsminister Lionne, der in der Folge die auswärtigen Beziehungen verantworten sollte. Ihnen oblag die „große Politik“, also alles, was die genannten drei Amtsbereiche betraf. Das Gremium erhielt bald die Bezeichnung „oberer Rat“ (Conseil d’en haut), was allerdings räumlich gemeint war und den Sitzungssaal bezeichnete. Die Mitglieder wurden vom König informell mündlich benannt bzw. geladen. Zugehörigkeiten von Amts wegen – etwa für den Kanzler – endeten. Daneben oder vielmehr darunter stand der Rat für die inneren Angelegenheiten des Königreichs, auch Depeschenrat genannt (Conseil des Affaires du dedans du Royaume bzw. Conseil des Dépêches), in dem dann zusätzlich der Kanzler sowie andere Ressortminister ihren Platz hatten. Mitglieder des Königshauses waren nicht mehr vertreten, Vertreter der großen Adelshäuser ebenso wenig. Hinzu trat der Finanzrat (Conseil des Finances). Ihnen saß der König nicht nur theoretisch vor oder führte die entscheidende Stimme, sondern tatsächlich. In den weiteren, mit spezielleren Aufgaben betrauten Räten – etwa jenen, die für die Justitz oder die Geistlichkeit zuständig waren – war er hingegen nur symbolisch präsent. Sie wurden an seiner statt vom Kanzler geleitet. Zusammensetzung, Konturen und Konstellation der Räte änderten sich naturgemäß im Laufe der Zeit und im Lichte der Herausforderungen. An ihrer Zusammenstellung und Konturierung allein durch den König aber änderte sich nichts.39
Der Tod Mazarins war zum Teil bejubelt worden – und dies nicht allein von seinen Erben. Auch, dass der König fortan ohne Ersten Minister und also ohne allmächtigen Favoriten regieren wollte, stieß auf heftigen Beifall, gerade innerhalb der Eliten. Weithin galt dies als Rückkehr zum Normalen, zu den guten alten, angeblich erprobten und im Grunde längst vergessenen Gepflogenheiten Heinrichs IV. und Franz’ I. Denn die waren natürlich zu ihrer Zeit durchaus nicht so ideal gewesen oder als solches angesehen worden, dass dies ihre Wiederkehr dringend erforderlich gemacht hätte. Allerdings gab es auch jetzt Zweifel, ob Ludwig zu irgendeiner Alleinregierung langfristig in der Lage sein würde, ob er also über die dafür notwendige Willens- und Arbeitskraft überhaupt verfügte. Die Zweifel sollten sich allerdings rasch zerstreuen. Der Fall des Finanzministers (eigentlich „Oberintendant der Finanzen“, surintendant des Finances) führte eindringlich vor Augen, wer fortan im Zentrum der Regierungsmacht stand und wer diese auch rücksichtslos zu gebrauchen wusste.
Der „Fall“ des Nicolas Fouquet bezeichnet dessen Sturz. Literatur und auch Film stellen gern Prunk und Pracht seines in der Tat gewaltigen Schlossbaus in Vaux-le-Vicomte, südwestlich von Paris gelegen, in den Mittelpunkt, die den König provoziert und zum Handeln gereizt bzw. gezwungen hätten – und also zu Fouquets Verhaftung. Das ist insofern richtig, als Sturz und Verhaftung in der Tat mittelbar auf ein Fest in Vaux-le-Vicomte folgten. Es trifft auch dahingehend, dass der König selbst zu diesem Zeitpunkt kein vergleichbares, dem Zeitgeschmack entsprechendes Bauwerk besaß und Nachsicht für übertriebene Prätentionen von Rangniederen nicht zu seinen Eigenschaften gehörte. Ansprüche, die ihnen nicht zukamen und die die seinen beeinträchtigten, würde Ludwig weder von Nicolas Fouquet dulden noch, auch dafür sollte es Beispiele geben, vom Papst oder vom König von Spanien. Tatsächlich wähnte sich der Finanzminister wohl in einer Position, in der er die Nachfolge Mazarins auf sich zukommen sah, und er ließ dies auch nach außen deutlich werden.
Das waren schwerwiegende Fehler bzw. Fehleinschätzungen. Doch seinem Sturz lagen noch andere Faktoren zugrunde: Bekannt ist die persönliche Rivalität mit seinem nachgeordneten Finanzintendanten Colbert. Eine Rivalität, die persönlich motiviert war, sich aber mit abweichenden Auffassungen über die Finanzierungspraxis des Staates verband. Fouquet war im Auftrag Mazarins dafür verantwortlich gewesen, der Krone in einer jahre- bzw. jahrzehntelangen Kriegs- und Krisenzeit die dringend benötigten Geldmittel zu beschaffen. Da die herkömmlichen Quellen, Steuern und Ämterhandel, hierfür nicht ausreichten, mussten Anleihen ausgegeben, kurzfristige Kredite aufgenommen und auch noch andere, undurchsichtigere Transaktionen durchgeführt werden. Dass bei all dem der persönliche Nutzen Fouquets wie auch Mazarins gemehrt wurde, verstand sich in einer politischen Kultur wie der des französischen Barock von selbst. Im Übrigen war es dann wiederum auch der Minister, der mit seiner Reputation, seinen Verbindungen und nicht zuletzt auch mit seinem Privatvermögen den Geldgebern der Krone das notwendige Vertrauen einflößte, auf dem ein Kreditgeschäft nun einmal beruhte. Und der, auch dies wurde erwartet, zur Not dann eben in die eigenen Taschen griff, wenn es wieder einmal dringend Kapital aufzutreiben galt.40
Das Vertrauen des Königs jedoch hatte Fouquet über all dem verloren, lange vor dem Fest von Vaux. Und genau diese Krise macht sich Colbert durch gezielte Indiskretion, Halbwahrheit und Verleumdung zunutze: Sein Biograph Daniel Dessert nennt ihn deswegen programmatisch „die Giftschlange“.41 Zwangsläufig verlor Fouquet mit dem Vertrauen des Königs sein Amt und mit diesem dann allerdings auch die Freiheit. Ludwig XIV. ließ ihn nach einer gemeinsamen Arbeitssitzung festnehmen und vor ein Sondergericht stellen. Korruption und Misswirtschaft waren die Anklagepunkte. Dass Fouquet nicht auch noch den Kopf bzw. das Leben verlor, hatte er seiner energischen, geschickten und letztlich wohl nicht ganz fehlgehenden Verteidigung zu verdanken, daneben aber auch seinen Verbindungen. Gnade vom König erfuhr er nicht. Er beschloss sein Leben 1680, nach über achtzenjähriger Haft, in der Alpenfestung Pignerolo.
Fouquet war ein Aufsteiger gewesen, worauf sein Motto Quo non ascendet? („Wohin mag er nicht noch steigen?“) auch anspielt, freilich recht selbstbewusst. Das Selbstbewusstsein speiste sich nicht zuletzt daraus, dass der Aufstieg an die Staatsspitze sich aus einer recht soliden Ausgangsposition heraus vollzogen hatte. Der Minister entstammte zwei bedeutenden Amtsadelsdynastien, die Vorfahren waren Richter des Pariser parlement gewesen. Mehrere seiner Kinder heirateten dann in altadelige Herzogsfamilien ein. Fouquet war also recht bald dort angelangt, wohin sein Rivale Colbert erst noch kommen musste, und das allerdings aus deutlich ungünstigerer Ausgangslage. Es war dann dieses Netzwerk, das den Fall auch der Familie Fouquet auffing und zunächst milderte bzw. ihn langfristig sogar verhinderte. Ein Enkel des Gefangenen von Pignerolo, der Marquis de Belle-Isle, sollte im 18. Jahrhundert zum bedeutenden Kriegsminister Ludwigs XV. werden.
Aufstieg und Fall des Ministers Fouquet haben ganz ohne Zweifel ihre romanesken Züge. Es fehlt nicht an Ehrgeiz und Eifersucht, nicht an Triumph und Tragik, schon gar nicht an Dramatik. Dennoch ist das Ereignis, nüchtern betrachtet, eher als einer jener Favoritenstürze oder einfach Ministerwechsel zu verstehen, die einen Neuanfang markierten und die dazu auch gedacht waren. Fouquet, sein Umfeld und seine Praktiken galten als verbraucht und einer vergangenen Ära zugehörig. Die Selbstregierung Ludwigs XIV., an die der Finanzminister nicht recht hatte glauben wollen, sollte auf anderen Grundlagen errichtet werden. Für sie würde sein Konkurrent und Nachfolger verantwortlich sein, denn auf ihn setzte der König.42
Auch Jean-Baptiste Colbert war ein Aufsteiger. Kein schlichter „Bürgerlicher“ mehr, wie dies Klischees und Schulbücher zum Teil immer noch forttragen, aber doch der Spross eines recht jungen, aus der Provinz stammenden amtsadeligen Hauses. Vater und Großvater hatten zum Patriziat in Reims gehört und dort Ämter bekleidet. Der Adelsrang, mit diesen Ämtern und mit notwendigem Grundbesitz, war also tatsächlich frisch erworben, was den Gegnern des Ministers erinnerlich blieb. Am Hofe war er im Gefolge Mazarins und auch Fouquets emporgekommen und hatte dann, wie gesehen, über den Letzteren die Oberhand erlangt. Er sollte durch sein Organisationstalent, seine Arbeitskraft und nicht zuletzt durch seine Skrupellosigkeit eine der Zentralfiguren in der ersten Regierungshälfte Ludwigs XIV. werden. Eine Zeit, in der es ihm gelingen sollte, einen „Clan“, eine regelrechte Ministerdynastie zu begründen, die sich Macht und Einfluss unter der Krone über Jahrzehnte mit nur wenigen anderen Männern bzw. Familien teilen musste. Diese Teilung allerdings überwachte der Herrscher sorgsam.43
Mit der Beseitigung Fouquets, der Beförderung Colberts, traf Ludwig also weitreichende personelle, aber auch strukturelle Entscheidungen. Denn die Nachfolge Colberts als „Finanzminister“ vollzog sich unter veränderten Bedingungen. Amt und Titel des Oberintendanten fielen weg und wurden ersetzt durch die eines Generalkontrolleurs, der weniger frei walten konnte, da er an den neu gegründeten Conseil des Finances gebunden war und damit nicht zuletzt an die Neuerung, dass in diesem Rat allein der König das Zeichnungsrecht für Zahlungsanweisungen besaß. Dass es trotz allem nicht gelingen sollte, Finanzverfassung und Finanzlage der Krone nachhaltig zu verbessern, hatte seine Gründe in den politischen Prioritäten, die die Krone – und also der König – in den kommenden Jahren und Jahrzehnten entwickelte. Reformen im Inneren sollten nur noch sehr bedingt dazugehören.