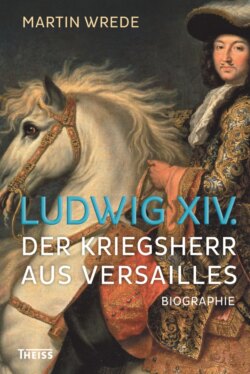Читать книгу Ludwig XIV. - Martin Wrede - Страница 15
Erste Schritte – Ludwig XIV. im Heiligen Römischen Reich
ОглавлениеErste Schritte auf der außenpolitischen Bühne hatte Ludwig vor 1661 nicht nur in Richtung auf Spanien unternommen, in Gestalt des Treffens mit seinem Schwiegervater Philipp IV. und der Hochzeitsfeier von Saint-Jean-de-Luz, sondern auch in Richtung auf das römisch-deutsche Reich, wenngleich hier nicht als Person, sondern eher als diplomatischer Schatten. 1657 war Kaiser Ferdinand III. gestorben. Da sein gewählter Nachfolger ihm bereits drei Jahre zuvor in den Tod vorangegangen war, ließ dies den Kaiserthron vakant werden. Für die französische Politik unter Mazarin ging es in dieser Situation nun darum, einen möglichen nicht-habsburgischen Kandidaten zu finden bzw. zu mobilisieren, etwa den Kurfürsten von Bayern. Auch eine eventuelle Kandidatur Ludwigs XIV. selbst wurde erwogen, allerdings nicht wirklich betrieben. Mazarin und der König begaben sich nach Metz, um die Kommunikation mit den Frankfurter Wahlhandlungen zu erleichtern. Als Garant des Westfälischen Friedens und damit der Reichsverfassung war Frankreich dort mit einem Gesandten vertreten. Weiter als bis Metz führte dieser Weg König und Kardinal aber nicht.
Als einzig plausibler Kandidat erwies sich letztlich der erst achtzehnjährige Erzherzog Leopold, König von Ungarn und Böhmen, der überlebende jüngere Sohn des verstorbenen Kaisers. Der Münchner Wittelsbacher kandidierte nicht gegen Tradition, habsburgische Macht und die dem habsburgischen Kandidaten zuneigende Mehrheit der Kurfürsten. Ludwig XIV. hielt es sinnvollerweise ebenso. Eine offene, unsichere Wahl, die Gefahr der Niederlage galten völlig zu Recht als nicht hinnehmbar. Die Wahl selbst war aus Sicht eines Erbmonarchen bereits ein zweifelhafter Vorgang. Und ohnehin wäre eine solche französisch-deutsche Personalunion keineswegs allein Chance gewesen, sondern sehr viel mehr Risiko. Die französische Diplomatie begnügte sich letztlich damit, die Kurfürsten darin zu ermuntern, dem Kaiser eine sehr weitgehende Wahlkapitulation abzuverlangen. Als schriftliches Wahlversprechen mit Verfassungsrang war sie dazu bestimmt, Leopolds politische Möglichkeiten im Reich allgemein zu begrenzen und außerdem das Reich selbst gegen die dynastische Allianz von Madrid und Wien in Stellung zu bringen: Jede direkte militärische Unternehmung des Kaisers zugunsten Spaniens wurde – wie schon 1648 im Westfälischen Frieden – explizit und dauerhaft ausgeschlossen.9 Zumindest die Durchsetzung dieser Position war bis auf Weiteres ein erfolgreiches Manöver. Es hielt den Kaiser aus dem Reich heraus.
Wichtiger noch war ein anderer Erfolg der französischen Politik: die gemeinsam mit dem Kurfürsten von Mainz betriebene Gründung des 1. Rheinbundes. Dieser vereinigte zahlreiche bedeutende wie unbedeutende Reichsfürsten zum gegenseitigen Schutz, was verfassungsgeschichtlich für sich genommen nichts Neues war. – „Bünde“, „Ligen“, „Einungen“ dieser Art hatte es im Reich seit jeher gegeben.10 Hanse und Schwäbischer Bund vor der Reformation, Protestantische Union und Katholische Liga danach sind nur die bekanntesten. – Hier aber waren es sowohl evangelische wie katholische Fürsten, die sich miteinander verbunden hatten. Das bedeutete nun sehr wohl etwas Neues, und es besaß ein merklich stabilisierendes Element für die sich gerade erst wieder entwickelnde mehrkonfessionelle politische Kultur „nach 1648“. Auch, dass der König von Frankreich als auswärtiger Bündnispartner bzw. als Protektor des Bundes auftrat, war neu. 1658 konnte, ja musste auch dies als ein stabilisierendes Element gelten. Der Rheinbund überbrückte die Konfessionsspaltung, integrierte Frankreich ins Reich und balancierte die Macht des neuen Kaisers aus. Ludwig war also 1658 nicht Kaiser geworden, worauf Mazarin wohl letztlich auch gar nicht ernsthaft gerechnet hatte, aber doch Gegenkaiser. Eine Flugschrift pries ihn als „Befästiger der Christenheit“, „stätige(n) Feind des Mahometischen Reiches“, „tägliche(n) Erhalter des Teutschen Friedens“.11 Das Neben- und von Anfang an auch Gegeneinander Ludwigs XIV. und Leopolds I. sollte im Übrigen die Konstante der folgenden Jahrzehnte werden, wenn auch in anderer Weise, als sich dies zunächst anzubahnen schien.
Doch den Höhepunkt von Ludwigs Einfluss und Geltung im Reich markierte erst das Jahr 1664. Im Jahr zuvor war in Ungarn der Krieg mit den Osmanen wieder ausgebrochen. Ein großes, an die 100.000 Mann starkes osmanisches Invasionsheer hatte Neuhäusel erobert, eine strategisch wichtige Festung im Norden der Donauebene, und es schickte sich an, noch sehr viel weiter vorzustoßen. Der Kaiser, dessen Kräfte weit unterlegen waren, hatte die Reichsstände um Hilfe ersucht und sie auch erhalten: Die Kontingente der Reichsfürsten verstärkten das kaiserliche Heer. Es waren freilich nicht nur die der Reichsfürsten. Auch der Rheinbund – unter Ludwigs Protektorat – trat auf, vereinigte, zum Missfallen Wiens, die Truppen seiner Mitglieder und komplettierte sie um ein nicht unerhebliches französisches Kontingent. Dieses Heer des Rheinbunds agierte neben dem des Kaisers und den Einheiten der übrigen Reichsfürsten als eine von drei Komponenten der christlichen Armee. Die Konstruktion bot Anlass zu Rang- und Kompetenzstreitigkeiten, doch verhinderten diese nicht, dass das Koalitionsheer am 1. August 1664 unter dem Oberbefehl des kaiserlichen Generals Montecuccoli bei St. Gotthard an der Raab einen großen Sieg über die Osmanen erfechten konnte: Es war der erste Erfolg dieser Art, dieses Ausmaßes, zu Lande, also in offener Feldschlacht. Mit ihm begann die mitteleuropäische „Türkenfurcht“, die Angst vor den überlegenen Kräften der Osmanen, allmählich zu schwinden. Der Krieg wurde dann aber rasch zu einem Ende gebracht. Dem Kaiser lag mehr an Stabilität als an dem Wagnis eines weiteren Feldzuges – zumal, da französische Truppen und Bündnispartner mitten in seinen Erblanden standen. Die Osmanen waren ohnehin von der Niederlage ernüchtert. Beide Seiten kamen überein, den Konflikt abzubrechen und es dabei zu belassen, dass jeder das besaß, was er besaß. Für den Kaiser bedeutete das durchaus ein paar schmerzliche Verluste.12
Der Sieg von 1664 wurde also politisch nicht weiter ausgenutzt. Selbstverständlich aber floss er ein in die kaiserliche Selbstdarstellung: Leopold I. ließ sich zum neuen Herkules ausrufen (bzw. ausmalen …), der über die türkische Hydra triumphierte. Und nicht minder selbstverständlich floss er auch ein in die Selbstdarstellung Ludwigs XIV. Er hatte dem Kaiser beigestanden, ihn, das Reich, das Christentum mannhaft und uneigennützig verteidigt. Er war der eigentliche Sieger – zumindest von Fontainebleau und dann Versailles aus gesehen, wo das Motiv der Schlacht von St. Gotthard in zahlreichen Varianten Glaube wie Größe des Königs illustrierte.13 Ein würdiger Erbe Ludwigs des Heiligen, so die Botschaft. Und im Grunde der wahre Schutzherr der westlichen Christenheit, anstelle jenes Kaisers, der bloß gewählt war und nur den Schein der Macht besaß, dessen Ressourcen es mit denen Frankreichs nicht aufnehmen konnten und der noch nicht einmal selbst ins Feld ziehen mochte.14