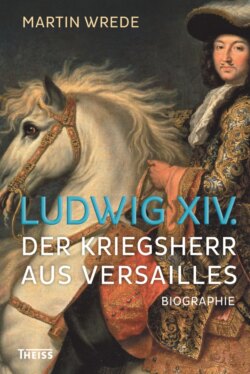Читать книгу Ludwig XIV. - Martin Wrede - Страница 8
I.
Wachsen mit den Aufgaben – Die Jugend des Königs Louis XIV Ein König wird geboren
ОглавлениеFür die Geburtsdaten und -orte gewöhnlicher Sterblicher hält das 17. Jahrhundert einige Unsicherheiten bereit. Sie liegen zuweilen im Dunkeln. Für Fürsten bzw. für Fürstenkinder gilt dies naturgemäß nicht oder nur ausnahmsweise. Für den Thronfolger eines der mächtigsten Staaten Europas gilt es gar nicht. Zeit und Ort der Geburt Ludwigs XIV. stehen also fest: Der dauphin Louis, erster Sohn König Ludwigs XIII. von Frankreich und der Königin Anna, erblickte am 5. September 1638 gegen 11 Uhr vormittags im Schloss zu Saint-Germain-en-Laye das Licht der Welt und des Hofes. Denn die Niederkunft erfolgte inmitten der höfischen Öffentlichkeit, die, wie es die Verfassungstradition vorsah, dem Ereignis beiwohnte, um Zweifel und Verdächtigungen auszuschließen – etwa solche der Kindesunterschiebung.
Mutmaßungen richteten und richten sich stattdessen auf anderes, nämlich den Zeitpunkt der Empfängnis. Zeitgenossen spekulierten eifrig darüber und auch heutige französische Historiker bringen diesem Datum beträchtliches Interesse entgegen. Vorgeschlagen werden etwa der 23. November 1637, der 30. November oder auch der 5. Dezember.1 Das Interesse, das hinter dieser eigentlich wenig belangvollen Frage stand und nach wie vor steht, zeigt dreierlei: zuerst natürlich die enorme Bedeutung, die der Geburt des Thronerben in der Monarchie ganz grundsätzlich zukam bzw. schon deren Erwartung, also der Schwangerschaft der Monarchin. Dynastische Stabilität verbürgte die Stabilität auch des Staates. Und die französische Monarchie war zwei Generationen zuvor nicht nur von den Religionskriegen erschüttert worden, sondern auch vom Aussterben des Herrscherhauses der Valois und der umstrittenen Nachfolge der Bourbonen, einer reichlich entfernten Nebenlinie. Schon die Schwangerschaft der Königin, die Aussicht auf einen direkten Erben, war also ein Staatsereignis. Daneben kommt, zum Zweiten, dann natürlich das Gewicht zum Tragen, das nicht nur in der französischen Historiographie der Person gerade dieses Thronfolgers bzw. dann des Herrschers, Ludwig XIV., beigemessen wurde und weiter beigemessen wird. Es zählt offenbar auch das kleinste biographische (oder gar „vorbiographische“) Detail. Darüber hinaus aber ist, zum Dritten, hier zu erkennen, dass eben diese Geburt bzw. dass Empfängnis und Schwangerschaft keineswegs in einem „normalen“ ehelich-familiären Umfeld erfolgt waren, sondern alles andere als das. Die Hofpanegyrik sprach von einem enfant du miracle, einem „Kind des Himmels“ (wörtlich: des Wunders) also, und von einem Gottesgeschenk. Letzteres ein Titel, der dem Kind dann auch als Beiname beigelegt wurde – Louis Dieudonné. Der Vater allerdings nahm solche Hinweise auf göttliches Mitwirken an einem irdischen Vorgang eher unwillig auf.2
Tatsächlich war die Ehe der Eltern, der dieses Kind nun entsprang, über viele Jahre höchst problembeladen gewesen. 1615 geschlossen, konnte sie, persönlich wie politisch, lange Zeit als gescheitert gelten. Ludwig XIII. von Frankreich und Anna von Österreich (aus der spanischen Linie des Hauses Habsburg) verband wenig miteinander, wenn es nicht gegenseitiges Misstrauen und sogar Abneigung waren. Der König, schwerblütig, persönlich gehemmt, war von Frauen im Allgemeinen, der seinen im Besonderen, nur wenig angezogen. Homoerotische Neigungen gelten als erwiesen, dass sie auch ausgelebt worden wären, ist allerdings wenig plausibel. – Es gibt keine entsprechenden Hinweise, und die persönliche Frömmigkeit des Monarchen macht es nicht wahrscheinlicher. Die Königin wiederum, attraktiv und vom Temperament her zumindest in ihrer Jugend eher das Gegenteil ihres Gatten, war und fühlte sich in ihrer Rolle zurückgesetzt, gekränkt gerade auch von der anti-spanischen Politik, die Ludwig XIII. und der Kardinal Richelieu als sein Erster Minister seit Ende der 1620er-Jahre planvoll ins Werk setzten. Es kam zu Hofintrigen, wechselseitigen Kränkungen – Alexandre Dumas’ „Drei Musketiere“ haben darin einen beträchtlichen realhistorischen Kern3 –, die zu völliger Entfremdung von König und Königin führten und die eheliche Gemeinschaft über Jahre praktisch aufhoben. Erst nach dem Scheitern der spanischen Kabalen der Königin und der Einsicht des Königs in die Notwendigkeit, dem Land einen anderen Erben geben zu müssen als seinen politisch urteilslosen jüngeren Bruder, kam es zu einer Wiederannäherung beider Partner und in deren Folge dann 1638 zur Geburt des ersten, 1640 zu der eines zweiten Sohnes. Die „Aussöhnung“ war von einem quasi-diplomatischen Austausch von Erklärungen begleitet gewesen. Die Königin hatte zugesichert, fortan keine Intrigen mehr anzustrengen. Der König wollte alles Gewesene vergessen haben und fortan mit seiner Frau leben, wie es einem guten Ehemann gebühre. Jean-Christian Petitfils bemerkt zu Recht, dies erwecke den Eindruck eines Notenwechsels zwischen vormals verfeindeten Mächten, die mühsam einen Ausgleich gefunden hatten.4
Das Bild des Gaston d’Orléans, des genannten jüngeren Bruders des Königs und bis 1638 präsumtiven Thronfolgers, muss man dabei eigentlich differenzierter zeichnen, als dies traditionell der Fall ist. Gaston war beständiger Rebell, auch in dieser Rolle allerdings unzuverlässig. Seine Bündnispartner konnten im Grunde nur darin sicher sein, dass er sie früher oder später verraten würde, denn anders als sie war er als direkter Erbe des Throns unangreifbar: Er konnte jederzeit auf Verzeihung rechnen. Über das wiederholte Scheitern seiner Rebellionen hinweg verfolgte er allerdings wohl, glaubt man wohlwollenden Betrachtern, tatsächlich eine liberalere, gemäßigtere politische Konzeption als sein älterer Bruder und dessen Erster Minister. Er war ein Exponent der ständischen, der „gemäßigten“ Monarchie des vergangenen 16. Jahrhunderts.5 Das hätte sich, einmal auf dem Thron, möglicherweise rasch geändert. Doch als Erbe der Krone war er auch deswegen eine unsichere Option, weil er selbst keine männlichen Erben besaß. Und die französische Krone ließ sich eben ausschließlich in männlicher Linie vererben; das war das sogenannte Salische Erbfolgerecht. Die Rangfolge unter den weiteren Nebenlinien des Hauses Bourbon aber war nicht völlig sicher und überhaupt die Aussicht auf einen solchen Erbgang recht gefährlich: Der dynastische Bruch von 1589, als die Valois ausstarben, die entfernt verwandten Bourbonen nachfolgten und sich gegen diese entfernte Nachfolge massivste Proteste erhoben, war in deutlicher Erinnerung. Wobei natürlich der seinerzeitige Widerstand vordringlich konfessionell motiviert gewesen war. Heinrich IV., der erste Bourbone, hatte 1589 noch (oder wieder) dem Protestantismus angehört.
Das konfessionelle Moment mochte nun – Paris war eben eine Messe wert gewesen – seit Heinrichs Konversion entfallen sein: Seine Söhne, Ludwig wie auch Gaston, waren in dezidiert katholischem Geiste erzogen worden. Die dynastische Unsicherheit blieb beunruhigend genug. Die ehelichen Pflichten Ludwigs XIII. waren also königliche. Er musste sich mit seiner Frau versöhnen – im Rahmen des menschlich Möglichen –, wollte er seinem Amt gerecht werden und seiner Pflicht vor Gott.
Zweifel an seiner Vaterschaft, die in den folgenden Jahrzehnten von Gegnern und Feinden der Krone verschiedentlich lanciert wurden, entbehrten dabei der Grundlage. Der König selbst, der seiner Ehefrau politisch wie persönlich bis ans Ende seines Lebens nach wie vor nur wenig Vertrauen entgegenbringen sollte, stellte sie jedenfalls nicht an – dies hatte ja bereits seine Reaktion auf das vermutete göttliche Einwirken auf die Empfängnis angedeutet. Die übrigen Agnaten am Throne, die ja eventuell erbberechtigt gewesen wären, taten ebenfalls nichts Entsprechendes. Ein plausibler Nebenbuhler war am Hofe, im Umkreis der Königin, auch überhaupt nicht vorhanden.
Im Übrigen aber blieb der Einfluss Ludwigs XIII. auf seinen Sohn und Nachfolger gering. Der Vater starb, als der Sohn noch nicht ganz fünf Jahre alt war. Größere persönliche Nähe zwischen beiden hatte sich nicht entwickeln können – ein Resultat der Gepflogenheiten der Zeit, aber auch der Unzugänglichkeit des Vaters. Dass Ludwig XIV. Versailles mit Rücksicht auf das väterliche Jagdschloss zur Residenz erwählt und dieses dann aus Pietät in den Neubau integriert hätte, ist ein Mythos – wenn auch einer, der schon auf die Bauphase zurückgeht.6 In der Selbstinszenierung des Sonnenkönigs sollten der unmittelbare Vorgänger und dessen Lebensleistung keine Rolle spielen. Auch der Dynastiegründer, Heinrich IV., nur eine sehr geringe. Darauf wird zurückzukommen sein.
Anderes galt für das Verhältnis Ludwigs zu seiner Mutter, Anna von Österreich. Hier gab es Nähe, auch Zuwendung, Zärtlichkeit sogar. Sichtbar wurde dies etwa bei den verschiedenen Erkrankungen des Kindes, aber auch im täglichen Umgang. Und natürlich gab es langfristigen Einfluss. Als Königin-Mutter und Regentin wurde Anna zu einer der bedeutendsten Frauengestalten auf bzw. neben dem französischen Thron.7 – „Auf“ den Thron im eigentlichen Sinn gelangten, wie schon gesagt, nach Salischem Erbfolgerecht nur Männer. – Sie war es, die an der Politik Richelieus festhielt, an Mazarin als seinem Nachfolger, und die mit ihm gemeinsam den Krieg gegen Spanien fortführte, mit dem Kaiser den Westfälischen Frieden schloss. Sie hielt der Fronde stand, dem Aufstand des Pariser Amtsadels, des hohen Hofadels und auch der Bürger der Hauptstadt. Und sie übergab ihrem Sohn am Ende ihrer Regentschaft ein gefestigtes Königreich – behauptet gerade auch gegen Spanien, dessen König, Philipp IV., ihr eigener Bruder war. Letzteres wird in der französischen Geschichtsschreibung gern als eine Art „patriotische Wendung“ der durch die Geburt der Söhne endlich nationalisierten Anna von Österreich gewertet, die schließlich zur Französin geworden sei. Es ist freilich eher dynastisch und aus der Logik ihrer königlichen Rolle heraus zu verstehen, denn national oder patriotisch.8 Kinderlos und ungeliebt, nicht einmal respektiert, hatte sich Anna als Vertreterin ihres Geburtshauses – dem der Habsburger – verstanden, ja verstehen müssen. Eine andere Möglichkeit hatte man ihr, im Grunde genommen, gar nicht gegeben. Die fortgesetzte Korrespondenz mit Madrid, aber auch der von Dumas verewigte „Flirt“ mit dem Herzog von Buckingham (der wahrscheinlich eher von diesem ausgegangen war) können wohl nicht zuletzt als Resultat dieser Frustration gelten.9
Der Vater: Ludwig XIII., König von Frankreich und Navarra (1610–1643) im feldherrlichen Harnisch. So wie Heinrich IV. kommandierte auch der zweite Bourbone auf dem Thron seine Truppen wiederholt selber – anders als sein Sohn. Gemälde von Justus van Egmont (1635).
Als Mutter des künftigen Königs, gar Regentin, waren ihre Rolle und Perspektive zwangsläufig verwandelt. Sie war zur Sachwalterin und zum Teil des Hauses Frankreich geworden, also dem ihres Sohnes. Auch frühere Unterstützer aus der Zeit der Opposition gegen Ludwig XIII. und Richelieu wurden enttäuscht. Die Regentin belohnte sie nicht oder doch nur in recht begrenztem Umfang. Mazarin und fast alle anderen Minister des verstorbenen Königs blieben im Amt. Anna hatte verstanden, dass Intrigen gegen den Staat, sofern sie sich gegen Richelieu und Ludwig XIII. gerichtet hatten, nun auch gegen sie und gegen Ludwig XIV. richten konnten. – Das war ungewöhnlich, insofern ein „alter Hof“, also die Amtsträger des Vorgängers, vom Nachfolger oder von dessen Vertrauten allermeist rasch beiseitegeschoben wurden – und wenn nicht rasch, so doch in absehbarer Zeit. Die letzte Regentin Frankreichs, Maria de Medici, die von 1610 bis 1615 für Ludwig XIII. regiert hatte, hatte sowohl den Kurs als auch die Berater Heinrichs IV. recht bald verabschiedet.10
Mutter und Sohn: Anna von Österreich mit dem Dauphin Ludwig. Beide standen einander durchaus nahe. (Französische Schule, vor 1643).
Doch gab es für die Art von verschobenem Rollenverständnis, das Anna von Österreich zeigte, durchaus auch historische Vorbilder: Der Herzog Louis d’Orléans war vor 1498 ein erbitterter Feind der Krone und ihres Machtanspruchs gewesen. Als Ludwig XII. in einer eigentlich nicht sehr wahrscheinlichen Erbfolge zum Träger dieser Krone geworden, verfocht er den gleichen Machtanspruch dann energisch und verband sich mit den Dienern seines Vorgängers.11 Anna von Österreich, die das entsprechende Exempel sicher nicht kannte, hielt es nur wenig anders. Kränkungen gegen oder Dienste für die Ehefrau Ludwigs XIII. waren von der Mutter und Vertreterin Ludwigs XIV. nicht unbedingt vergessen, aber sie rückten in den Hintergrund, wenn das im Sinne der Staatsgeschäfte war bzw. – der Begriff war nicht unumstritten, er galt aus theologisch-moralischer Perspektive weit- und weiterhin als Unwort – im Sinne der Staatsräson. Diese Haltung wurde Anna allerdings sicherlich dadurch erleichtert, dass ihr größter politischer wie persönlicher Gegner, eben Richelieu, schon 1642 gestorben war, ein halbes Jahr vor seinem König.12
Überhaupt ermöglicht wurde die „vollgültige“ Regentschaft der Anna von Österreich dabei erst durch einen politischen coup: Die Königin ließ in einer großen Staatszeremonie das Testament ihres Gatten für ungültig erklären, das ihre von der Verfassungstradition vorgegeben Position als Regentin sehr deutlich beschnitt und einen ganzen Regentschaftsrat zusammenstellte. Diese Zeremonie, das sogenannte lit de justice – wörtlich zu übersetzen als „Bett der Gerechtigkeit“ –, bestand im Erscheinen des Königs in seinem Obersten Gerichtshof, dem parlement – meist handelte es sich um das von Paris –, um dort symbolisch sein „Bett aufzuschlagen“ bzw. Residenz zu nehmen und damit die an die Richter delegierte Macht des roi-justicier wieder an sich zu nehmen. Der König, als Quelle des Rechts, erklärte seinen Willen und das parlement hatte dem zu folgen. Es hatte also einen bestimmten Rechtsakt zu „registrieren“, d.h. ihn den Gesetzen des Landes hinzuzufügen und künftig anzuwenden. Oder es hatte, wie im Fall des Testaments Ludwigs XIII., einen Rechtsakt für ungültig zu erklären. Widerspruchsmöglichkeiten der Magistrate gab es nicht. Das lit de justice war so die ultimative Waffe des Königtums, um von den häufig widerstrebenden Gerichtshöfen die Anerkennung von Gesetzen zu erzwingen.13 Im vorliegenden Fall war es natürlich die vom vierjährigen König begleitete Regentin, die ihren Willen kundtat, und das Pariser parlement zögerte auch gar nicht, sich dem zu fügen. Es erhielt nämlich im Gegenzug Mitwirkungsrechte zurück, die ihm von Richelieu genommen worden waren. Der Letzte Wille des toten Königs durfte und würde den Willen des Nachfolgers also nicht beschränken.