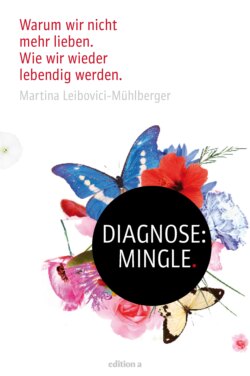Читать книгу Diagnose: Mingle - Martina Leibovici-Mühlberger - Страница 10
Warum wir lieben
ОглавлениеWenn sich Atome ineinander »verlieben«, so bilden sie mittels Bindungskräften Moleküle und somit komplexere Einheiten. Sogar auf subatomarer Ebene ist dieses Wirken der Bindungskräfte, jener Aspekt, der alles zusammenhält, das Entscheidende. Wir können uns zwar nicht sicher sein, ob ein Elektron gerade ein Masseteilchen oder eine Wahrscheinlichkeitswelle ist. Aber das, was dafür entscheidend ist, dass wir es, sei es als Welle oder Teilchen, irgendwo um einen Atomkern herum auf einer Wahrscheinlichkeitsbahn vermuten dürfen, sind die Bindungskräfte. Bindung begründet die kleinsten Bestandteile unseres Universums bis hin zur höchsten Akkumulation und Komplexität und ist als das universelle Prinzip alles Seienden anzusprechen. Bindung, Anziehung und, wenn wir diese Energie emotional konnotieren, Liebe, sind der universelle Antrieb der Lebendigkeit. Über die ersten Hochzeiten der Atome zu anorganischen Molekülverbindungen, weiter zu den organischen Verbindungen, die ersten Einzeller und dann die höhere Komplexität von Mehr- und Vielzellern mit ihrer bereits arbeitsteiligen Struktur, über wirbellose hin zu den Wirbeltieren, den Fischen, Amphibien, Vögeln, Säugetieren und letztendlich bis zu uns Menschen – überall ist, über vielschichtige Komplexitätsstufen und verschachtelte Steuerkreise Bindung der ursprüngliche, große Regisseur im Hintergrund, der Leben erst möglich gemacht hat. Umgekehrt steht Bindungslosigkeit oder der Prozess des Zerfalls von Bindungen für den Tod, so wie auch wir dereinst mit unserem Tod wieder zu Staub und Asche werden. Es ist also Bindung und in einem höheren Sinn Liebe, jene immaterielle Kraft, die die Materie erst lebendig werden lässt und beseelt. Liebe benennt im üblichen Sprachgebrauch ein Gefühl, eine Emotion, und ist damit, wenn wir von rudimentären, von Primatenforschern vermuteten Ansätzen absehen, ganz stark an unsere Spezies Mensch geknüpft. Warum hat uns die Evolution damit ausgestattet? Warum war es nötig, ab einer gewissen Komplexitätsstufe von »Sein« diese Emotion, die doch augenscheinlich so viele Beschwerden verursacht, zu erfinden? Wir können getrost davon ausgehen, dass die Natur nichts umsonst anlegt. Emotionen dürfen als komplexe Integrationseinheiten vieler zuvor gewonnener Sinneserfahrungen gesehen werden und dienen unserem Überleben. Letztendlich mit dem Ziel, uns rasch zu einer Evaluation einer Situation zu führen, um uns entscheidungsfähig zu machen. Wenn ich zum Beispiel allergisch auf Bienengift bin und eventuell bei einem Bienenstich einen anaphylaktischen Schock erleiden könnte, der die Potenz hätte, mich ins Jenseits zu befördern, so macht es durchaus Sinn, wenn ich genau in dem Moment, in dem sich ein derartiges Insekt auf der Suche nach einer Blume durch das offene Fenster in mein Zimmer verirrt, Furcht verspüre. So bin ich alarmiert, sofort etwas zu unternehmen. Emotionen sind also als Integrationseinheiten höherer Ordnung anzusehen, die aus vielen zuvor gewonnen, uns teilweise gar nicht bewussten Sinneseindrücken eine übergeordnete Evaluation einer Situation oder Anforderung ableiten.
Nun, wozu ist also die Liebe gut? Sie hat damit zu tun, dass wir als die Krone der Schöpfung anzusprechen sind, also die bisher höchste Komplexitätsstufe verkörpern, die die Evolution zumindest in unserem Sonnensystem hervorzubringen im Stande war. Das sollte uns allerdings nicht arrogant, sondern demütig sein lassen, denn es bedeutet einen großen Auftrag. Wir haben als Spezies eine derart komplexe Systemik entwickelt, dass wir Vorstellungsvermögen haben, uns also Dinge, Handlungsabläufe, Prozesse und ihre Konsequenzen und möglichen Ergebnisse im Trockendock unseres Geistes vorzustellen vermögen, ohne uns sprichwörtlich dabei die Hände schmutzig machen zu müssen. Und darüber hinaus haben wir es sogar zu einem reflexiven Bewusstsein gebracht. Wir können also über uns selber nachdenken. Mit diesem Selbst-Bewusstsein ist es uns als Privileg sogar eingeschrieben, dass wir das universelle Prinzip der Bindung und der Liebe als das treibende Prinzip der Evolution erkennen und wertschätzen können. Doch dafür, dass es so weit kommen konnte, war das Prinzip der Bindung und des Liebens auch gleichzeitig wieder die Voraussetzung. Das hat, wie könnte es anders sein, mit unserem Hirn zu tun. Wenn wir unsere Grundausrüstung als Menschen betrachten, so ist sie gar nicht unbedingt beeindruckend. Wir müssen sogar neidlos attestieren, dass die meisten Tierarten besser ausgerüstet sind als wir. Keine scharfen Krallen oder Reißzähne, mehr als durchschnittliche Läufer, eindeutig schlechte Schwimmer, ganz sicher keine Ausdauer beim Hangeln von Ast zu Ast, und vom Klettern gar nicht zu reden. Nicht einmal ein wirkungsvolles Tarnkleid haben wir, Flucht durch Fliegen können wir gleich abhaken, und im direkten Kampf Faust gegen Faust sind wir, wenn es nicht gerade um die eigene Spezies geht, so ziemlich jedem, der mehr als 50 Kilogramm und etwas Entschlossenheit mitbringt, unterlegen. Trotzdem dürfen wir uns als die überlegene Spezies sehen, jene, der es gelungen ist, so ziemlich jeden Lebensraum bis zum arktischen Wendekreis und in der anderen Richtung bis in die Sahara hinein zu besiedeln. Dass wir den Globus heute dominieren und alle anderen sukzessive, wenn auch mit unklarem Ausgang ausrotten, ist ein Faktum. Das, was uns so erfolgreich gemacht hat, ist nämlich gerade, dass der Mensch so wenig differenziert ist, so unspektakulär.
Der Mensch ist ein klassischer Generalist. Im Unterschied zu allen auf ihr jeweiliges Habitat genauestens angepassten, ja zugeschnittenen Organismen und Tieren ist der Mensch einfach so, wie er eben ist, simpler Durchschnitt. Ein bisschen von allem. Ein bisschen Laufen, ein bisschen Muskel, ein bisschen Klettern, ein bisschen Schwimmen, ein bisschen Springen, ein bisschen Regulationsmöglichkeit an Temperatur und unterschiedliche Luftdruckverhältnisse. Das Spezifische des Menschen, so könnte man sagen, ist, dass er unspezifisch ist, dass er sich aber extrem flexibel an die jeweiligen Anforderungen anpassen kann. Und dies wird ihm durch sein großes Hirn mit seinem überragenden Vorstellungsvermögen, das »Probehandeln ohne Risiko« ermöglicht, erschlossen. Dieses Hirn und seine großartige Möglichkeit, situationsangepasst zu reagieren, Werkzeuge zu erfinden, Feuer zu kultivieren und Lösungen für die jeweilige Anforderung der Umgebungssituation zu entwickeln, hat uns zum Erfolgsorganismus gemacht. Es hat uns ermöglicht, nahezu jeden Lebensraum zu besiedeln und uns damit gleichzeitig befähigt, über uns nachzudenken. Doch ein Hirn, das derartigen Anforderungen gewachsen sein soll, braucht eine gewisse Größe. Da reicht ein einfaches Affenhirn von, sagen wir, Schimpansengröße und 460 Gramm nicht aus, um Reflexivität in gehörigem, erfolgversprechendem Ausmaß entwickeln zu können. Wir bringen immerhin heute rund 1290 Gramm auf die Waage. Das stellte die Evolution vor eine ziemliche Aufgabe. Denn für das Unternehmen »zunehmende Komplexität« war auch der aufrechte Gang unerlässlich, weil dieser mehr Überblick und damit mehr Überlebenschancen im Busch und Savannenland versprach. Beim aufrechten Gang ist aus der Beckendynamik heraus der Beckendurchgangsöffnung ein Riegel vorgeschoben. Was man da durchbekommt, bei einer Geburt, ist an Hirngröße nicht allzu beachtlich. Damit ist kein Staat zu machen, zumindest im Sinne der Krone der Schöpfung, eines Organismus, der später einmal, wenn er erwachsen ist, innovative, neue Lösungen für komplexe Probleme finden soll. Mit so einem Hirn hätten wir weder die Dampfmaschine, noch die industrielle Revolution, Hip Hop, Quantenmechanik, Jazz, Hamlet oder die Relativitätstheorie erdenken können. Das heißt, dass es notwendig wurde, eine ziemlich lange postpartale also nachgeburtliche Periode einzuschieben, in der dieses Hirn in Ruhe wachsen und gleichzeitig optimal an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten angepasst werden konnte. Doch die Lebensversorgung in Zeiten ohne Sozialversicherung, sozialem Wohnbau, Krankenversorgung, ausgebauten Helfersystemen, Karenzgeld und Mutterschutz, Supermärkten mit gefälligen Öffnungszeiten, Eltern-Kind-Treffpunkten und notfalls Kriseninterventionszentren waren schwer. So schwer, dass diese Bürde der Aufzucht bis zu einem realistischen Freisetzungs- und Selbstversorgungszeitpunkt für ein Weibchen alleine, beladen mit all den Versorgungs- und Nahrungsbeschaffungspflichten als Regelfall nicht realistisch bewältigbar erschien. Da musste der Erzeuger als im wahren Sinn des Wortes Nächstliegender und damit auch Engagiertester mit eingebunden werden. Und damit kam wieder der universelle Antrieb des Lebens, nämlich Bindung, ins Spiel. Es galt, in einer sozial komplexen Form Bindung einzuführen, das Lieben zu entwickeln, das zunehmend auch als solches bewusst werden und erkannt werden konnte. Von der strahlenden romantischen Hollywood-Liebe würde ich hier noch nicht sprechen wollen. Obwohl wir natürlich nicht wissen, ob jene fernen Vorfahren von uns auch schon damals unter dem glitzernden Sternenhimmel für einen Moment die Verschmelzung mit dem Universum erfahren haben, als sie einander in die Augen blickten, bevor sie neues Leben zeugten. Aber von Bindung und Zugehörigkeit in einer sehr klaren und pragmatischen Form, wenngleich vielleicht nicht einmal bewusst, kann hier ganz sicher die Rede sein.
Ich habe in einem Museum einmal die Ausgrabung einer Steinzeit-Familie gesehen, die allesamt an einer Vergiftung gestorben sein sollten, zeitgleich, im Schlaf. Hatten wohl die falschen Beeren zum Nachtisch erwischt. Die Anordnung der Skelette hat mich tief berührt. Da waren die Gebeine einer jungen Frau, die in ihren Armen im Tod wohl ein etwa eineinhalbjähriges Kind gehalten haben muss. Hinter ihr lag, sie umfangend, das Skelett eines Mannes. Etwas an der Seite fanden sich ein etwa siebenjähriger Junge und ein rund zehn- bis elfjähriges Mädchen. Und neben den beiden Kindern das Skelett einer älteren Frau. Eine Familie. Das habe ich mir damals, für einen Moment über die Jahrtausende mit ihnen verbunden, gedacht. Mann und Frau und das Kleinkind vereint, und daneben die schon autonomeren Familienmitglieder, die älteren Kinder und die Großmutter. Ob sie Liebe füreinander gefühlt haben, wie wir sie kennen, weiß ich nicht. Aber Bindung, Zusammengehörigkeit dürfen wir doch wohl als gesichert annehmen, allein aus der Gruppierung heraus. Es ist ein weiter und unausleuchtbarer Weg, von diesen Anfängen der Bindungs- oder auch Zugehörigkeitsgefühle bis zu dem, was wir heute unter Liebe verstehen. Ich bin der Überzeugung, dass er im Spannungsfeld der Individuation des Menschen, also der Wahrnehmung seines eigenen ICHS zu sehen ist.
Zum Zeitpunkt unserer Geburt existiert ein ICH-Bewusstsein noch nicht. Wir wissen also nicht, dass wir wir sind. Dieses ICH muss sich erst konstituieren, muss erst erbaut werden. Ein spannender Prozess, bei dem während der Schöpfung von materieller Struktur durch Wachstum des Hirns und Ausbildung von Synapsenschaltungen auch erst jenes Bewusstsein schrittweise entsteht, das jedes Kind irgendwann zum überwältigten Ausruf »ICH« befähigt, wenn es sein Spiegelbild zum ersten Mal als eben jenes ICH zu erkennen vermag. Zu Beginn unseres Lebens befinden wir uns in einem Raum-Zeit-Kontinuum und in enger, fast symbiotischer Vernetzung mit unseren nächsten Bezugspersonen und der uns umgebenden Umwelt. Wir sind getrieben von wechselnden Bedürfnissen und ihrer Erfüllung. Aber wir sind da – ganz eindeutig, wir gestalten diese Interaktion mit unserer Umgebung mit und treten in Austausch und Reaktion, so uns dies ermöglicht wird. Reziproke, ko-regulierte, affektive Kommunikation nennt man das in der Wissenschaft. So schrecklich diese Worthülse klingt, sie vermag doch eindeutig Wesentliches zu enthüllen. Zum einen, dass bereits Säuglinge, wie eindeutig erwiesen ist, nicht nur passiv auf Reize reagieren, sondern sehr wohl ihrerseits Impulse setzen und über einen wechselseitigen, wiederum bei der Bezugsperson eine Antwort provozierenden Ausdrucksmodus verfügen. Denn die schlaue Evolution hat vorgesorgt, damit die Kommunikation mit den Kindern auch für ihre Bezugspersonen spannend bleibt und diese sie nicht eventuell aus Langeweile einfach weglegen. Zum anderen handelt es sich hierbei nicht nur um reziproke, wechselseitig hin- und herlaufende Kommunikation. Also kein reines Vor- und Zurückschieben von Daten, sondern sie wird sowohl von der Betreuungsperson wie auch vom Säugling und Kleinkind ko-reguliert, das heißt aktiv aus der aktuellen Befindlichkeit heraus mitgestaltet. Um diesen Sachverhalt emotionaler Ko-regulation zu verdeutlichen, müssen wir uns nur in die Situation mit einem zahnenden, brüllenden Kleinkind hineinversetzen. Wenigen von uns gelingt es, im Grundton der eigenen Gefühlswelt während der Tröstungsversuche, ausgeglichen und entspannt zu bleiben, vor allem wenn es sich um längere Zeitsegmente handelt, die das Töchterchen oder der Sohnemann tobt. Unsere Kinder üben also einen Einfluss auf uns und unsere emotionale Befindlichkeit aus.
Was jedoch für unsere Fragestellung der ICH-Entwicklung als der wesentlichste Aspekt der Analyse früher Kommunikationsprozesse bezeichnet werden muss, ist die Tatsache, dass im Hintergrund all dieser von uns als Säugling und Kleinkind sowie heranwachsendem Kind gemachten Erfahrungen unser ICH geformt wird. Erst während wir zum ICH werden, beginnen wir auch die Fähigkeit zu entwickeln, dieses ICH zu bemerken und später dann darüber nachzudenken.
Klar wird hier allerdings auch die Tatsache, dass kein vom Kontext seiner Entstehung »losgelöstes« ICH existiert. Das ICH und sein Bewusstsein zu sich entsteht über das DU, das lebendige Gegenüber und jene Prozesse von Bezugnahme aufeinander. Wer das anzweifelt sei herzlich dazu eingeladen, in historischen Texten zu den ersten Findelhäusern nachzulesen oder deren Todesstatistiken zu studieren. Denn der Säugling, der zwar physisch ernährt wird, aber ohne Bezug(sperson) in einem kalten, seine verzweifelten Signale unbeantwortet lassenden Kosmos zu leben verurteilt ist, der verzweifelt als Organismus binnen kurzer Zeit. Er findet keinen Andockplatz für eine ICH-Entwicklung, vermag zu keinem ICH zu werden und gibt sein Leben auf. Das haben in jüngerer Zeit auch die schrecklichen Waisenhäuser des Ceauşescu-Regimes neuerlich bewiesen. Schon der Stauferkaiser Friedrich II (1194-1250), der wissen wollte, ob Aramäisch oder Latein die heilige Ursprache wäre und Ammen verbot, die ihnen anvertrauten Kinder zu herzen, ihnen vorzusingen, sie zu streicheln oder auch nur, sie beim Stillen anzusehen, erreichte damit nur den Tod der Kinder.
Ohne Bezug, ohne Bindung und Beziehung zu einem DU also kein ICH. Aber wenn wir diesen grundsätzlichen Entwicklungsweg der ICH-Werdung nun nachvollziehen können, erhebt sich natürlich als nächstes die Frage: WIE sieht denn dieses ICH aus? Aus welchen Bestandteilen setzt es sich zusammen? Was genau meinen wir, wenn wir »ICH« sagen? Wie erlebt sich also dieses ICH, das nicht nur in Abhängigkeit zum DU, sondern auch zum größeren DU einer ganzen Gesellschaft, ihren Werten und Grundüberzeugungen und den damit verbundenen Erfahrungen entsteht? Was also ist genau gemeint, wenn sich ein einzelnes ICH beschreibt, das als indisches Mädchen im untersten Kastensegment aufgewachsen ist, oder ein ICH, das in den Hamptons seine ersten prägenden Lebensjahre zugebracht hat? Und gibt es einen Unterschied in der ICH-Wahrnehmung über die Jahrhunderte hinweg?
Lassen wir die Stromschnellen kultureller Einflussfaktoren auf die ICH-Entwicklung beiseite und konzentrieren wir uns auf jene ICHs, die uns in unserem westlichen Lebensalltag bevorzugt entgegenkommen. Wen dürfen wir erwarten?
Wenn wir heute »ICH« sagen und unsere »Sozialisierungsadresse« in unserer reichen Konsumgesellschaft angeben können, so haben wir eine ziemlich klare und vor allem hochspezifische Vorstellung, wer dieses ICH ist. Dieses ICH ist zuerst einmal in klarer Weise eine eigenständige von allen anderen getrennt zu sehende biologische Einheit mit eindeutigen Körpergrenzen. Der körperlichen Ausdehnung und Oberflächenbeschaffenheit dieses ICHS ist heute gleich eine besonders herausragende Bedeutung zugeordnet. Viel Energie, Zeit und Geld wird dafür aufgewendet, um der Präsentation dieses Körpers im Spannungsfeld von Idealvorstellungen einen höchst persönlichen, eben individuellen Look zu geben. Das Ganze erfolgt unter der Zielsetzung, zu seiner eigenen »Marke« zu werden, sich als höchst persönliches Individuum von allen anderen abgrenzen zu können. Für diejenigen von uns, die weniger in der Öffentlichkeit stehen, gilt es dabei nur, in ihren unmittelbaren sozialen Bezugsgruppen »individuelles Gesehen-Werden« zu erzeugen und einen persönlichen »recall« zu provozieren. Jene mit sogenanntem Öffentlichkeitsauftrag müssen dann eben ihr ganzes Leben eventuell auch mit einem roten Käppchen auf dem Kopf in die Oper gehen oder sich sonstwie verkleiden. Aber neben der Möglichkeit, Körperlichkeit als ersten Signalgeber für Individualität zu nutzen, gilt es, eine höchst eigene, unverwechselbare Persönlichkeit zu präsentieren. Die Zielvorstellung unserer heutigen Zeit ist es, wenn möglich zu einem atemberaubenden Gesamtkunstwerk zu avancieren, die perfekte Selbstinstallation oder aber sein persönliches Denkmal zu Lebzeiten zu werden. Wer das schafft, dem sind die Blicke und die Aufmerksamkeit ja die Gefolgschaft der Twitter-Follower sicher. Persönlicher Kreativität und Selbstpersiflage im Dienste dieses Ziels sind keine Grenzen gesetzt. Denn wer will heute noch ernsthaft als Dutzendware gesehen werden oder hängt seine Identität hauptsächlich an seiner Berufsgruppenzugehörigkeit auf?
Dahinter steht ein langer Weg der Individualisierung des Menschen. Auch wenn uns dies heute nicht bewusst ist, wir uns die heutigen Verhältnisse zu dem, was es heißt, ein ICH zu sein, uns als ICH zu FÜHLEN, als normal, wahr, wirklich und gar nicht mehr anders möglich vorstellen.
Natürlich können wir davon ausgehen, dass sich auch schon der mittelalterliche Mensch als Individuum begriff, als ein Mensch mit bestimmtem Aussehen, wenngleich dazu im Durchschnitt der Bevölkerung nur eine so verschwommene Wahrnehmung existierte, wie es der nächstliegende Dorfweiher an einem windstillen Sommertag erahnen ließ. Denn Spiegel waren Mangelware und sicher nicht in jeder Köhlerhütte Standard. Die sozialpsychologische Konzeption des ICHS war in strikter Form an die jeweilige Gemeinschaft und das gemeinsame Überleben gebunden, das ICH durch die Zugehörigkeit zu einer definierten Bezugsgruppe und ihrem Regelwerk weitestgehend bereits definiert. Individualismus, der nur den Einzelnen ins Zentrum stellte, wurde nicht geduldet und unterlag der Ächtung. Das Individuum als unabhängige und von der Gemeinschaft zunehmend abgekoppelte Selbstkonzeption, nahm erst einen langen Weg durch die Einflüsse von Renaissance, Aufklärung und Industrialisierung bis in die Moderne. Die damit verbundenen Übergänge von der dörflichen zur urbanen Gesellschaft, vom Obrigkeitsstaat zu Demokratie, von der überlebensnotwendigen Wirtschaftseinheit einer Gemeinschaft hin zu staatlicher Kranken- und Pensionssicherung trugen ihren Teil dazu bei.
Wie hat sich das Verständnis von Lieben als »Kommunikationsund Organisationsform« von notwendiger Bindung und Beziehung, die uns ja wie besprochen evolutionär eingeschrieben ist, in Parallele dazu entwickelt? Liebe als Sinn stiftende Beziehungsvariable des Paars erweist sich bei genauerer Betrachtung als ein relativ junges Auswahlkriterium in der Partnerwahl. Zumindest dann, wenn wir sie in der Bedeutung eines romantischen emotionalen Affekts verstehen. Die Partnerwahl wurde auch bei uns lange Zeit nach wirtschaftlichen und sozialen Statusüberlegungen getroffen. Die Entwicklung von Zugehörigkeit, wechselseitiger Zuverlässigkeit in der Erfüllung der erwarteten Rolle und Kameradschaft war dabei ein ausreichendes emotionales Spektrum zwischen den Partnern. Liebe im Sinn einer heftigen leidenschaftlichen Affektion füreinander war im Standardkatalog der Kriterien für Paarbeziehungen nicht enthalten, ja vielfach gar nicht erwünscht. Das romantische Ideal, das Liebe als beziehungsbegründende Variable postulierte, gestaltete sich erst im 18. Jahrhundert aus und trat danach langsam seinen Siegeszug durch alle Bevölkerungsschichten an.
Man könnte also durchaus zur Annahme kommen, dass mit zunehmender Individualisation auch zunehmend Gestaltungsfreiheit eröffnet wurde, ein auf der eigenen Person und ihrer Spezifität begründetes »Lieben« zu entwickeln.
Interessant ist, dass »Liebe« als Sinn stiftendes Prinzip schon immer zentrales Motiv in Literatur und Kunst war. Angefangen bei Philemon und Baucis, die noch als altes Ehepaar durch ihre Liebe in Eintracht verbunden vor ihrer Hütte sitzen, über Romeo und Julia, bis zu »Love Story« reichend. So wird das »Lieben« immer wieder als die große positive Kraft beschworen. In unzähligen Varianten ist das Wesen der Liebe Thema der Auseinandersetzung.
In einer Gesellschaft, die ihren Mitgliedern einen hochpersönlichen individualisierten Lebensentwurf einräumt, ja diesen postuliert, sind wir nun dort angekommen, wo jeder von uns diese seine große erfüllende Liebe erleben will. Aber irgendetwas muss schiefgegangen sein.
Wie konnte das passieren? Noch nie haben wir derart intensiv über uns nachzudenken vermocht. Noch nie haben wir dank Arbeitszeitbegrenzung und Urlaubsregelung derart viel Zeit für die Gestaltung unserer Beziehungen zur Verfügung gehabt. Noch nie haben wir uns in derart gesicherten wirtschaftlichen Bedingungen und mit medizinischer Rundumversorgung auf höchstem Niveau vorgefunden. Noch nie stand uns also so viel Raum zur Selbstgestaltung eines glücklichen, liebenden Lebens zur Verfügung. Noch nie waren wir so knapp an der Tür zum Paradies und scheinen dennoch am weit geöffneten Tor laut lamentierend und unser Schicksal beklagend beständig vorbeizulaufen. Luzifer steht in der lässigen Verkleidung eines Geschäftsmanns mit einem frechen, kleinen Panamahut auf dem Kopf daneben und reibt sich angesichts der Tatsache die Hände, dass 38% der europäischen Bevölkerung eine klinisch relevante psychische Beeinträchtigung aufweisen, sprich unglücklich sind.
Wo sind wir in unserer ICH-Werdung falsch abgebogen und haben damit selber das Grundprinzip der Lebendigkeit, »das Lieben«, verraten?