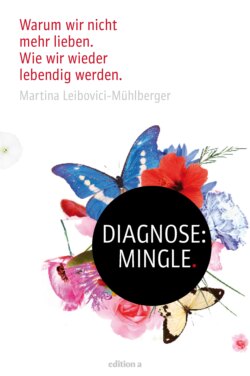Читать книгу Diagnose: Mingle - Martina Leibovici-Mühlberger - Страница 7
Warum wir nicht mehr fühlen können – Ein böser Verdacht
ОглавлениеEigentlich nahmen alle Überlegungen für mich damit ihren Anfang, dass ich begann, mit dem ICD-10 auf Kriegsfuß zu stehen. Der ICD-10 ist, entgegen seinem Namen, kein Schnellzug, sondern das Diagnosemanual für uns Mediziner. Eine Art Bibel, mit der wir die Erkrankungen jedes Fachbereichs, also auch psychische, in einen vierstelligen Nummerncode pressen können. Eine tolle Sache in einer Gesellschaft, der Einrasterung und Klassifizierung sakrosankt ist. Eine Leitlinie, die Objektivität und Realität abzubilden vermag, die eine Krankheitswertigkeit festlegt und somit Orientierung zwischen krank und gesund anzubieten vermag. Damit tritt sich dann auch eine ganze Lawine von handlungsanweisenden Leitlinien für die Behandlung los, und alle sind glücklich. Die behandelnden Ärzte und Therapeuten, die wissen, was sie nun lege artis zu tun haben, und auch die Patienten, die endlich ein fassbares Etikett für ihre Probleme bekommen. In früheren Jahren meiner Tätigkeit hatte ich das befriedigende Gefühl, punktgenau ins Schwarze zu treffen, wenn ich zum Beispiel das F 34.0 nach Zusammenschau und Abwägung aller Anamnesedetails eines Patienten auf den Diagnosebogen malte. In den letzten Jahren überwog mehr das Gefühl, gerade einmal die Zielscheibe getroffen zu haben.
Immer mehr befiel mich der Eindruck, dass bei vielen Patienten ein wesentlicher, ja fundamentaler Aspekt ihres Leidens in der gängigen Diagnostik keine Abbildung findet. Bei vielen meiner Patienten war eine eindeutige Verflachung ihres Gefühlsspektrums, eine deutliche Abnahme der Intensität der Gefühlsqualität, die zwischenmenschliche Prozesse auszulösen vermochten, ja sogar eine Art Fühltaubheit zu bemerken. Diese Schwäche des Gefühls bezog sich eindeutig auf den Bereich der Bindungsprozesse zu anderen Menschen, im Speziellen auf das, was man im allgemeinen Sprachgebrauch als Liebesbeziehungen bezeichnet. Es schien mir, als würde es zu einem zunehmenden Abzug von Bindungsenergie und Bindungsqualität gegenüber anderen Menschen kommen. Stattdessen konnte ich eine Verlagerung der emotionalen Besetzung auf andere, stark »selbstzentrierte« Bereiche und Objekte bemerken. So sehr, dass andere Menschen zu »Selbstobjekten« instrumentalisiert wurden. Gleichzeitig schien diese Strategie von wenig Erfolg im Sinne einer beglückenden Konzeption des persönlichen Lebens gekrönt zu sein. In vielfacher Weise war sie mitverursachend für jene Leiden, die mir die Patienten in der Sprechstunde zur Therapie anboten. Immer häufiger befiel mich das Gefühl, dass hier etwas grundsätzlich und allgemein faul sein müsse, wenn immer mehr Menschen keine Bindungsbesetzung für andere Menschen aufzubringen vermochten und sich, bewusst oder unbewusst, der ständig wachsenden Schar der Mingles anschlossen. Immer mehr bekam ich den Eindruck, hier zwar noch vor einer Nebelwand zu stehen. Aber ich spürte die Gewissheit, dass sich hinter diesem zunehmenden Phänomen weit mehr als das erklärbare persönliche Lebensdisaster von ein paar Individuen verbarg. Die Fühltaubheit oder pragmatische Beziehungsführung schien mir zu etwas wie einem gesellschaftlichen Grundphänomen geworden zu sein. Die Entsorgung der Liebe und damit all dessen, was uns erst Tiefe und Fülle, ja Sinn für jene kurze Zeit zu verleihen vermag, in der wir als flüchtige und verletzbare Kohlenwasserstoffverbindung diesen Planeten bevölkern.
Wurde hier, in dieser Besetzungsverschiebung, die letztendlich das höchste Liebesobjekt immer wieder nur in sich selbst erblickt, die Entkulturalisierung unserer Menschlichkeit eingeläutet? Zahlreiche Fälle aus meiner Praxis gaben dazu beredtes Zeugnis ab. Auch von den damit verbundenen, jedoch in ihrem Zusammenhang oft nicht erkannten Konsequenzen.
Ralf sucht mich zum Beispiel wegen hartnäckiger Schlafstörungen auf. Diese quälen ihn nun schon seit Jahren, allerdings hat das Ganze die Tendenz, immer bedrängender und häufiger zu werden und geht mit einem sich ewig wiederholenden Albtraum einher. Dabei steht mit Ralfs Leben eigentlich alles zum Besten. Er ist einer, der es wirklich geschafft hat, wie man so sagt. Als junger Doktor der Technik hat er vor knapp 30 Jahren eine kleine, aber bemerkenswerte Neuerung in einem Spezialzweig industrieller Fertigung geschaffen und mit dem damit verbundenen Patent Millionen gemacht. Als einer, der gerade von der besseren in die schlechtere Hälfte des Jahrzehnts zwischen 50 und 60 gewechselt hat, könnte er sich behaglich zurücklehnen und sein Leben in vollen Zügen und mit beträchtlichem Wohlstand genießen. Ist ihm das Wetter in Wien zu trüb, so fliegt er für eine Woche zum Golfen nach Thailand oder in sein Haus nach Fort Lauderdale. Doch leider fliegen seine Schlafstörungen und der mit ihnen verbundene Albtraum immer mit, egal an welchem Jet-Set-Point des Globus er sich befindet. Jetzt ist er bereit, tiefer zu graben. In seinem Albtraum fährt er auf einem Motorrad auf einer langen, sonnenbeschienenen Straße. Plötzlich beginnt sich das Wetter zu ändern, und die Straße, die zuerst perfekt glatte Asphaltierung zeigt, bricht an immer mehr Stellen auf, so als würde im Untergrund ein großes Tier wüten. Ralf vermag unvermutet auftauchenden Schlaglöchern und Querrillen nur mit großer Mühe und in letzter Sekunde auszuweichen. Gleichzeitig beschleunigt das Motorrad ganz von alleine. Auftauchender Nebel behindert die Sicht zunehmend. Siedende Angstgefühle durchfluten Ralf und stehen in scharfem Kontrast zu der immer schneidenderen Kälte des Fahrtwinds. Am Ende taucht eine graue Granitwand vor Ralf auf. Der Zusammenstoß ist unvermeidbar, und schweißgebadet wacht er an dieser Stelle des Traums auf. »Jedesmal bin ich dann vollkommen erschöpft und total fertig, brauche eine gute Stunde, um mich wieder emotional zu orientieren und dieses Todesgefühl abschütteln zu können«, berichtet er. In den meisten Nächten, in denen dieser Albtraum auftritt, ist danach an weiteren Schlaf nicht mehr zu denken. Ich sehe ihn mir genauer an. Eine elegante Erscheinung, sportlich, dynamisch, natürlich gebräunt und strahlendes Lächeln, nackte Füße in Wildledermokasins der teuersten Sorte, genauso wie das restliche Outfit, in dem ein gut trainierter und sorgfältig gepflegter Body steckt. In der Bewegung wirkt er etwas steif, manieriert könnte ich es mit weniger Gutmütigkeit, geckenhaft mit Spottlust nennen. In seinem Tagesablauf ist er gut durchbeschäftigt. Die zwei Stunden Bodybuilden habe ich ihm schon vorweg angesehen, sonst Zeitungen und News zur Orientierung, ein wenig tägliche Verfolgung von Aktienkursen, Mittagessen mit dem einen oder anderen Freund oder manchmal mit seinem Sohn. Ausstellungen, Einladungen Folge leisten oder selber in kleiner Runde einladen, sonstige Veranstaltungen, eine Aufsichtsratssache, seine Hobbys und nicht zu vergessen die »Hasenjagd«. Attraktiv, jung und unkompliziert müssen sie sein, um in Ralfs Beuteschema zu passen. Er ist großzügig aber lässt sich auf nichts wirklich Festes mehr ein, wie er mit seiner sehr wohlklingenden Stimme ausführt. Seinen Panzer wird keine mehr zu durchdringen vermögen. Auch das stellt er sogleich klar. Das Lehrgeld seiner Ehe war ein bitterer Nachgeschmack. »Zwei Jahre Glück habe ich mit nachfolgend 20 Jahren Verfolgung und dem Verlust meiner Kinder bezahlt«, beschreibt er mir seine Lebenserfahrung zum Thema Liebesbeziehungen. Seine Bemühungen um die Kinder waren fruchtlos und teuer. Das zu einer Zeit, wo er das Geld dringend in der Firma gebraucht hätte. Als Ergebnis vermag er heute nur eine emotional sehr distanzierte Beziehung zu seinem Sohn vorzuweisen, seine Tochter verweigere, von der Mutter indoktriniert, nach wie vor jede Kontaktnahme. Eine zweite tiefere Beziehung, ein paar Jahre nach der ersten Scheidung, ist an den parallel laufenden Kämpfen mit der Ex-Frau gescheitert. Leidenschaft lässt er seit Jahren nur mehr bei seinen Hobbys zu. Golfen, Old-Timer sammeln und Rennen fahren. Er hat sich dazu auch eine eigene Werkstatt eingerichtet, in der er stundenlang herumschraubt, poliert, adjustiert oder Teile erneuert. Früher waren es auch Motorräder, aber mit denen hat er wegen des Albtraums aufgehört.
Doch Ralf ist nicht mein einziger Patient, der diesen Weg der »Gefühlsvertaubung« gegenüber zwischenmenschlichen Liebesbeziehungen für sich als Lebensstrategie gewählt hat.
Da gibt es Klaus, der seine Frau während der Schwangerschaft, in der sie wegen vorzeitiger Wehen nicht mit ihm schlafen kann, damit konfrontiert, seinen Hormonspiegel mit Unterstützung einer früheren Freundin abbauen zu müssen. Und der meint, nur auf diese Weise über genügend Energie zu verfügen, um sich auf ihr gemeinsames Kind unbeeinträchtigt freuen zu können.
Oder auch die Volksschuldirektorin Elisabeth, die nun, am Ende ihrer 40er, endlich mit Hilfe von Internetforen und einer Freundinnenschar einen klaren Katalog all jener Bedürfnisse angelegt hat, die ihr zukünftiger Traumpartner befriedigen muss. Den kann sie heute im Schlaf und kompromisslos herunterbeten. Die durch entsprechende Plattformen herangeschafften Kandidaten werden rigoros, wenngleich in den letzten beiden Jahren ergebnislos, vermessen. Ein frustrierendes Unterfangen, das ihren abendlichen Alkoholkonsum immer mehr verstärkt hat.
Hartmuth, ein habilitierter Neurologe, in dessen Hände ich meinen Schädel mit blindem Vertrauen legen würde, hat es scheinbar viel besser gemacht. Jedenfalls hat er viele Neider wegen seiner 25 Jahre jüngeren Frau, die er von einer Urlaubsreise aus Rumänien mitgebracht hat. In äußerst bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, ist sie das sexuelle Haushaltspaket seiner mittleren und späteren Jahre. Sie verbindet den Vorzug von Unterlegenheit mit jenem mangelnder Sprachkenntnisse. Sogar einen kleinen Sohn hat er sich auf diese Weise noch anschaffen können, wie er es mir gegenüber nennt. Damit ist auch für die Beschäftigung der bildhübschen jungen Frau aus dem nordöstlichsten und ärmsten Teil von Rumänien gesorgt. Mehr ist da nicht, keine tieferen Gefühle, wehrt er meine Nachfrage fast entrüstet ab. Seine wirkliche Leidenschaft gilt seiner Karriere und Motorradtouren im wilden Gelände, die früher gut gegen seine Depressionen gewirkt haben.
Die erfolgreiche Versicherungsmaklerin Regina wiederum setzt auf die Lebensfreundschaftsbeziehung statt auf eine Liebesbeziehung zu einem Mann. Mit Karl, einem regionalen Immobilienmakler, den sie noch aus Jugendjahren kennt, hat sie den idealen Konterpart gefunden. Sie teilt viel an gemeinsamer Freizeitaktivität, beruflichem Austausch und wechselseitigem Beistand in den unterschiedlichsten Lebensanliegen mit ihm. Aber sicher nicht Sexualität und Liebe. Alles, was im Leben der 52-Jährigen über Freundschaft hinausgehen könnte, ist tabu. »Dafür bin ich einfach zu alt«, hat sie entschieden. Bei mir auf der Couch liegt sie wegen ihrer zwanghaften Hypochondrie.
Nun ließe sich an dieser Stelle sicher gut einwenden, dass es sich hier um ein altersgruppenspezifisches Phänomen handeln könnte. Die mittleren Lebensjahre eben, mit ihren Stromschnellen, die die schon viel weiter oben im Strömungsverlauf angelegten Schwierigkeiten zu Tage treten lassen. Eine Überlegung, die auch für mich beim ersten Hinsehen großen Charme ausstrahlte. Handelte es sich hier etwa nur um das Problem einer kleinen, speziellen Randgruppe von Patienten, die ihre Midlife-Crisis nicht erfolgreich zu überwinden gewusst hatte und so in das Mingle-Schema der totalen Unverbindlichkeit gerutscht war? Die schon aus der Kindheit mit schlechten Bewältigungsstrategien ausgerüstet und eventuell bereits traumatisiert nun psychisch oder psychosomatisch auffällig wurde? Und die als vielleicht neu zu beschreibendes »Gruppensymptom« die Fähigkeit von tiefer emotionaler Bezugsfähigkeit auf ein Partnergegenüber vermissen ließ? War es eventuell auch ein durch die Emanzipationsbewegung erklärbares Generationsproblem der heute 45 bis 60-Jährigen? Jener Frauen also, die schon mit dem vollständigen Konzept, was es bedeutet, eine emanzipierte Frau zu sein, in ihre jungen Frauen- und Beziehungsjahre gegangen waren, nur um auf jene weiterhin in Sachen Emanzipation verschlafen sozialisierten jungen Männer zu treffen, die sich im Zweifelsfall doch besser am patriarchalen Rollenmodell festhielten? Stand hier die Wiege des Mingle-Daseins? Da hatte es sicher genügend Möglichkeit gegeben, einander in Rollenunverträglichkeit ausgiebig an die Kehle zu gehen und Blessuren zu schlagen. Die zarter Besaiteten landeten dann eben auf der Couch und gaben in Sachen Liebe in der einen oder anderen Weise auf.
Wie sah es dagegen bei meinen jüngeren Patienten, also jenen »Millennials« aus, die allesamt ein Geburtsdatum jenseits von 1980 aufweisen? Welche Bedeutung und welchen Stellenwert in ihrer Selbstkonstruktion nahmen Beziehungen für sie ein? Diese Frage beschäftigte mich als nächstes.
Nina ist irgendwo im Umfeld von Linz aufgewachsen. Ihre Mutter ist Volksschuldirektorin, ihr Vater Jurist in einem großen Unternehmen. Nina besucht das lokale Gymnasium, genauso wie ihre zwei Jahre ältere Schwester. Die Beziehung der Eltern ist schwierig und konfliktreich. Der Vater unterhält über Jahre eine Beziehung mit einer Arbeitskollegin, die Familie weiß davon. Die Eltern können sich weder voneinander trennen, noch für den permanent schwelenden Konflikt eine Lösung finden. Irgendwann gibt es einen kleinen Halbbruder für Nina und ihre Schwester und eine Depression für die Mutter, doch an der Grundkonstellation ändert sich nichts. Nina empfindet für beide Eltern nur Verachtung. Als sie am Milleniumssilvester ihren 18. Geburtstag gefeiert und im darauffolgenden Jahr die Matura hinter sich gebracht hat, geht sie nach Wien und studiert Betriebswirtschaft. Ihre eigenen Beziehungen sind flüchtig, explorativ, situationsbezogen, wie sie es nennt. Ihr Studium ist ihr wichtig, und nach einem ersten Job bei einem Handynetzprovider winkt nach fünf Jahren ein Angebot in London, das sie begeistert annimmt. Dort wird ein Arbeitskollege aus Malaysia ihr ständiger Begleiter, mit dem sie, auch um die hohen Londoner Mietkosten teilen zu können, eine Beziehung eingeht. Doch das junge Glück ist von starken kulturellen Spannungen und Revierkämpfen überschattet. Und in der Karriere zurückstehen, um den Beziehungsraum gestalten zu können, will keiner wirklich. Nina leidet unter den Spannungen der sexuellen Wohngemeinschaft mehr als ihr Partner. Immer häufiger verschafft sie sich mit Shopping-Touren Stressabbau und Glücksmomente. Die Situation wird zunehmend unerträglich. Turbulenzen in der Firma führen letztendlich dazu, dass sie vor knapp einem Jahr zurück nach Österreich kommt. Jetzt lebt sie alleine und ist wegen ihrer Kaufsucht bei mir in Behandlung. Männer lässt sie aus Überzeugung nur mehr als One-Night-Stand in ihrem Leben zu.
Mark hat dagegen ein ganz anderes Problem. Er ist 31, gelernter Tontechniker und lebt bei seinen Eltern in deren Haus in Perchtoldsdorf. Der Vater ist ein pensionierter, cholerischer Forstrat, die Mutter eine verhärmte, depressive Hausfrau, wie Mark es beschreibt. Das ist ein feines Arrangement, zumindest aus seinem Blickwinkel, denn die Einliegerwohnung mit ihrem separaten Eingang bietet ihm genügend Privatsphäre, und gleichzeitig sind alle Infrastruktur- und Versorgungsthematiken über die Eltern mitabgehandelt. Er spart enorm Kosten und Energie, weil er sich um Gemeindeabgaben, Strom und Heizung nicht kümmern muss und die Wäsche von Mutters Zauberhand versorgt wird. Rebecca ist Marks Dauerfreundin, seit sechs Jahren, etwas Fixes würde man sagen. Es ist nett mit ihr, angenehm, so beschreibt er die bisherige Beziehung, doch im letzten Jahr hat sich nach Marks Einschätzung ein problematischer Unterton eingeschlichen, der die Leichtigkeit bedroht. Rebecca drängt ihn. Sie will mehr. Die netten Abende in ihrer Wohnung oder bei ihm, die gemeinsamen Urlaube, die Partys und zusammen absolvierten Kino- oder Veranstaltungsbesuche sind ihr zu wenig. Und das, obwohl er sich doch eindeutig dazu bekennt, mit ihr zusammen zu sein. Sie will eine richtige Beziehung, wie sie es nennt, und Mark entwickelt spürbar zunehmende Fluchttendenzen vor der geforderten Verbindlichkeit. Gemeinsam etwas aufbauen ist nicht sein Ding. Das klingt nach Mühe, täglicher Abstimmungsnotwendigkeit und eindeutiger Festlegung auf einen Menschen. Im schlimmsten Fall sogar nach einem gemeinsamen Kind. Wie soll ich wissen, ob ich das morgen noch will, kontert Mark und verschanzt sich hinter der pseudophilosophischen Worthülse, dass das Leben ein Fluss sei, dessen Lauf man sich eben frei anzupassen hätte. In Marks Fall muss man allerdings konstatieren: ohne das Risiko eingehen zu wollen, sich nass zu machen.
Birgit und Phillip scheinen da eindeutig weiter zu sein, denn unter Birgits braunem Schlauchrock wölbt sich bereits eine ansehnliche Schwangerschaft, die irgendwo zwischen dem fünften und sechsten Monat angesiedelt sein muss. Schließlich demonstrieren sie auch damit Ernsthaftigkeit, dass sie zur Auseinandersetzung und Beratung gemeinsam in meinem Sprechzimmer sitzen. Bei Phillip sind die Segel auf Familiengründung gesetzt. Der 32-Jährige, hoch aufgeschossene junge Mann mit einer Figur wie ein Cornetto, hat sich bereits sehr erfolgreich seine Sporen bei einem internationalen Personalentwickler verdient und möchte nun den Hafen Familie anlaufen. Aus Birgits Blickwinkel sieht die Sache jedoch gänzlich anders aus. Für Sie, gerade 30 geworden, passt der Zeitpunkt, um ein Kind, nämlich IHR Kind zu bekommen. Doch sich Phillip »ausliefern«, wie sie es nennt, möchte sie nicht. Sie hat ein klares Konzept vor Augen, wie sie ihre Mutterschaft als autonome und auch wirtschaftlich unabhängige Frau leben möchte, was sie ihrem Kind alles geben möchte. Mit Hinweis auf die »beschissene Ehe« und den jahrelangen nachfolgenden Rosenkrieg ihrer Eltern, von dem nahezu ihre gesamte Kindheit überschattet war, vertritt sie ihr Recht, dieses Risiko mit Mark gemeinsam nicht eingehen zu wollen. Pragmatische Verhältnisse sind ihr lieber. Klare Grenzen, klare Aufgabenverteilungen, kein Zusammenwohnen. Natürlich soll ihr Sohn, das Geschlecht ist schon per Ultraschall festgestellt worden, eine gute und intensive Beziehung zu seinem Vater aufbauen. Phillip soll sich also nicht nur als »Zahlvater« einbringen, aber bitte mit seperatem Lebensterrain. Wie es zwischen ihr und Phillip als Paar weitergehen soll? Das sieht sie gelassen. Mit dem zukünftigen Kind fühlt sich Birgit nun emotional vollkommen auf der sicheren Seite des Lebens angekommen. Denn ihren Sohn wird sie absolut und hingebungsvoll lieben, das spürt sie schon jetzt. »Das ist eine ganz andere, viel sicherere Ebene«, argumentiert sie mit großer Überzeugung, »denn ein Kind liebt einen absolut und enttäuscht sein Gegenüber darin nicht.« »Mit der anderen Ebene hast du recht«, denke ich mir. Doch genau darin liegt die Problematik. Eine schwierige, mit großen Erwartungen beladene Kindheit wartet auf diesen noch ungeborenen Sohn.
Auch die Reihe meiner jüngeren und jungen Patienten, bei denen diese seltsame, spezifische »Fühlschwäche«, diese grundsätzliche Abnahme der Wichtigkeit von Liebesbeziehungen, ja sogar Entwertung derselben, feststellbar ist, ließe sich beliebig fortsetzen. Alles lauwarm, alles cool ist die Devise. Ganz ohne Pulsbeschleunigung soll es sein und sich als taktischer Baustein in ein streng eigenorientiertes Lebenskonzept ohne Anpassungsbereitschaft fügen. Wenn dies allerdings nicht für beide involvierten Teile gilt, sprengt die Konfrontation mit dieser Haltung für den emotional involvierten Partner einen tiefen Krater in die derart geschundene Seele. »Schwangerschaftsberatungen« wie die von Phillip und Birgit sind heute in meiner Praxis keine Seltenheit mehr. Mal ist es der weibliche mal der männliche Teil, der sich für eine verbindliche Beziehung auf der Elternebene nicht wirklich bereit fühlt. Bisweilen wirkt es fast so, als ob vor dem Eintritt der Schwangerschaft in einer Art stillem Arrangement ein mit viel anderen Inhalten und persönlichen Zielen aufgepolstertes und abgelenktes Leben nebeneinander geführt wird. Die Schwangerschaft wird dann zum Offenbarungszeitpunkt, denn sie erfordert Bekenntnis und endgültige Klärung, ob man bereit und fähig ist, sich aufeinander einzulassen und für dieses Kind eine neue soziale Einheit als Basis zu schaffen. Liebesgefühle werden vielfach als bedrohlich erlebt, eine damit einhergehende »Auslieferung« assoziiert und diese als zu hohes Risiko bewertet. Konsumieren in Leichtigkeit, in einem abgesteckten Rahmen, der gleichzeitig Unverbindlichkeit garantiert oder zumindest Hintertüren offen hält, das suchen diese Patienten. Die Dämpfung des Fühlens repräsentiert eine neue Form des strategischen Beziehungsmanagements, das jedoch, wenn ich mich unter meinen Patienten so umblicke, gerade das nicht zu erfüllen scheint, was es anstrebt: nämlich, die Menschen glücklich zu machen.
Zu diesem Zeitpunkt meiner Beobachtungen bewegte ich mich mit meinen Überlegungen noch im Feld meiner Patienten. Ich war der Überzeugung, in dieser Fühltaubheit, dieser Reduzierung der affektiven Besetzung eines Gegenübers, einen Mechanismus zu erblicken, der Ausdruck eines pathologischen Grundgeschehens war. Menschen, die auf Basis unsicherer frühkindlicher Bindungsangebote und entsprechender Traumatisierungen einen »fehlerhaften« Zugang zu einer befriedigenden zwischenmenschlichen Beziehungsgestaltung entwickelt hatten, waren zwar nichts Neues. Ja, sie sind sogar die Grundmatrix der psychotherapeutischen und psychiatrischen sowie psychosomatischen Sprechzimmer. Doch schien es mir eindeutig, dass eine tektonische Verschiebung im Untergrund der Bewältigungsstrategien dieser schmerzhaften Lebenssituation der Einsamkeit und Isolation erfolgte. Denn die Liebesbeziehung als grundsätzliches emotionales Lebensziel war in den früheren Jahren nicht infrage gestellt worden. Mit einem unzureichend reifen Bindungs- und Beziehungsinstrumentarium ausgerüstet, hatten meine früheren Patienten durchaus ihr »Scheitern am Gegenüber oder an sich selber« in heißen Kämpfen, frustrierenden Rückzugsschlachten und zähen, letztendlich ergebnislos verlaufenden Verhandlungen erlebt. Doch am Grundprinzip, am Streben nach einer befriedigenden Partnerschaft, war nicht gerüttelt worden. Nach einer unterschiedlich langen Periode, die sie brauchten, um sich vom Boden zu erheben, Wunden verheilen zu lassen und den Staub der letzten Niederlage aus den Kleidern zu klopfen, waren sie, wie von einem inneren Uhrwerk angetrieben, ganz selbstverständlich wieder aufgestanden. So hatte sich jener starke, auf einen anderen Menschen gerichtete Wunsch nach Nähe und Bindung wieder ganz von selbst eingestellt. Wie Kinder, die beim Laufenlernen unermüdlich nach jedem Sturz wieder aufstehen und weitermachen. Das schien sich jedoch in den letzten 20 Jahren grundlegend geändert zu haben, gerade darin schien die Veränderung zu liegen. Die Menschen schienen aufzugeben. Einen anderen Menschen überhaupt noch tief und rückhaltlos lieben zu wollen, kam aus der Mode. Das war neu. Wo war die Kraft hingekommen? Es schien mir, als hätten meine heutigen Patienten im Gegensatz zu meinen früheren auf ihrem Weg den Glauben verloren, als würde die analoge Erfahrung aller Betroffenen: »Scheiße, das war nicht der/die Richtige, das tut verdammt weh!« nicht mehr zu einem »Okay, dann muss ich etwas ändern, dazulernen, verbessern, auf etwas beim nächsten Mal mehr aufpassen« führen, sondern zu einem bitteren Erkenntnisprozess. Zu einer Grundhaltung von: »Also Beziehungen sind grundsätzlich scheiße, ich mach jetzt gar nichts mehr und kümmere mich nur mehr um mich, der/die Nächste wird sich bei mir gehörig anstrengen müssen, aber ich lass keine/n mehr wirklich an mich ran.« Eine Rücknahme der Besetzungsenergie auf sich selber, ein überzogenes Ausmaß von Beschäftigung mit sich und im Untergrund ein Eisberg an Enttäuschung und Frustration schienen die Folge dieser Schwäche zu sein. Resignation des psychischen Apparats, ein Motivationssystem, das nicht mehr genügend motiviert, die Hand mit Mut nach dem Gegenüber auszustrecken, sondern rät, nur ganz bei sich zu Hause zu bleiben. Bei meinen jüngeren und jungen Patienten schien mir die Sache noch viel grundsätzlicher zu verlaufen. Es mutete an, als würden viele von ihnen bereits an der Basis mit diesem Mangel an Begeisterungsfähigkeit für ein Gegenüber ausgerüstet sein. Schon von Beginn an schienen sie so geprägt in das zwischenmenschliche Beziehungsfeld einsteigen, ganz so, als würde ein zentrales Dogma das sich offen gebende, vertrauensvolle Lieben als gefährlich, unsicher und daher als zu vermeiden entwerten. Ein für die zwischenmenschliche Begegnung bereits zu invalidisierter psychischer Apparat, dem die Brille des Egos aufgeschweißt ist. Aber es ging ihnen allen schlecht damit und, auch wenn dies das rationale Wachbewusstsein mit lautem Pathos abstritt, so hoffte doch jeder ganz im Geheimen, in der letzten tiefsten und von zahlreichen Schlössern abgesicherten Kammer irgendwann dem Traumprinzen oder der Prinzessin zu begegnen. Dem Menschen, der sie mit ihrer Liebe wie das Sterntalerkind überschütten würde. Allerdings frei nach dem Motto: »Geliebt werden will ich schon, aber lieben nicht!« Doch unsere Biologie ist nicht zu betrügen. Der Mensch, das aristotelische zoon politikon, ist als homöostatisches System, sprich als ausgeglichener, gesunder, befriedigter Mensch unter solchen Vorzeichen nicht lebensfähig. Es lebt dann in einem kalten, allein mit Spiegelwänden ausgekleideten Kosmos und verbraucht einen Großteil seiner Energie mit der beständigen Verleugnung und Ablenkung von seiner einsamen Situation. Leben kann so nicht aus seiner Lebendigkeit heraus gestaltet werden. In einem strengen Konzept der Selbstinszenierung, das nur jene Begegnungen und Abläufe zulässt, die diesem kleinen, verunsicherten »Ego« genügend Kontroll- und Steuerungsgefühl vermitteln, wird konsumiert. Güter, Beschäftigungen, Hobbys oder auch andere Menschen. Wenn die Grundgeborgenheit im Lieben aber nicht gegeben ist, können weder genug Kleingeld, skurrile Sammlerleidenschaften, rastlose Selbstbeschäftigung, noch endloses Fitnesstraining helfen. Und auch die sexuelle Trophäensammlung vermag keine ausreichende Wärme zu entwickeln, um die existentielle Einsamkeit nachhaltig zu überwinden.
Nun, hier bewegte ich mich immerhin beruhigenderweise noch im Fahrwasser des Patientenmodells. Es mochte sich also um einen Mechanismus handeln, dessen Erforschung möglicherweise durchaus interessant sein konnte, der allerdings nur auf Personen mit einer entsprechenden Zuordnung zu psychischer Beeinträchtigung zutraf. Zwar waren es immerhin stolze 38% der europäischen Bevölkerung, die irgendwann einmal eine klinisch relevante psychische Störung aufwiesen. Aber dennoch war das eine Minderheit, per definitionem eingerastert und abgesondert gegenüber der psychisch gesunden Normalbevölkerung.