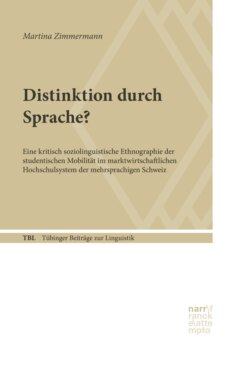Читать книгу Distinktion durch Sprache? - Martina Zimmermann - Страница 30
2.2.4.3 Ideologie
ОглавлениеWerben tertiäre Bildungsanstalten aus der Deutschschweiz um angehende Studierende aus dem Tessin, heben jene die zusätzlichen Deutschkenntnisse hervor, welche diese sich neben dem Studium „wie von selbst“ aneignen könnten (vgl. Kapitel 4). Wenn Tessiner Studierende die Wahl ihres Studienorts begründen, betonen sie die Wichtigkeit der deutschen Sprache und die Vorteile, welche die Mobilität – sie assoziieren diese z.B. mit zusätzlicher Lebenserfahrung und Selbständigkeit – mit sich bringe (vgl. Kapitel 5). Ideologien liegen diesen diskursiven Praktiken zugrunde. Diese zu analysieren trägt dazu bei, die Konstruktion der sozialen Wirklichkeit, in der auch die studentische Mobilität über Sprachgrenzen hinweg ihren Platz hat, und die darin vorkommenden Machtverhältnisse zu beleuchten.
Ideologie ist zum Alltagsbegriff geworden und wird als flexible Hülse verwendet. Der Begriff bedarf einer Definition, wenn wir uns im Rahmen dieser Arbeit dessen bedienen wollen. In sprach-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen hat die Auslegung des „Ideologiebegriffs“ eine Debatte in Gang gesetzt (vgl. Asad 1979; Thompson 1984; Eagleton 1991; Kroskrity et al. 1992). Zwei unterschiedliche Stossrichtungen zeichnen sich in der Diskussion ab.
Der einen zufolge ist Ideologie „a specific set of symbolic representations – discourses, terms, arguments, images, stereotypes – serving a specific purpose“ (Blommaert 2005: 158; Hervorhebung im Original) und wird von spezifischen Akteuren oder Gruppierungen verwendet, die durch den Gebrauch ihrer Ideologie gegen aussen erkennbar werden. Das heisst, dass damit spezifische, für oder gegen etwas Partei ergreifende Akteure und ihre Überzeugungen gemeint sind. Als Beispiel sei hier auf eine Gruppe von Studierenden verwiesen, die sich gegen die Erhöhung von Studiengebühren einsetzt. Zwecks ihrer Kampagne bringen sie Argumente vor, die für die Beibehaltung eines niedrigen Beitrags sprechen (z.B. Zugang zum Studium über Gesellschaftsschichten hinweg) und gebrauchen Diskurse und Bilder, die ihrem Unterfangen förderlich sind.
AutorInnen, die in die Gegenrichtung stossen, legen Ideologie allgemeiner aus. Sie definieren das Konzept als „a general phenomenon characterizing the totality of a particular system or political system, and operated by every member or actor in that system“ (Blommaert 2005: 158; Hervorhebung im Original). Hierbei wird Ideologie einem gesellschaftspolitischen System in seiner Gesamtheit zugeschrieben, einem System, welches sich über ideologische „grands récits“ (Lyotard 1979) definiert, fortschreibt und sich so in seiner Struktur und Geschichte festigt. Solche „grands récits“ erheben Anspruch auf Exklusivität und haben Neutralisierungsprozesse zur Folge. Wenn beispielsweise die studentische Mobilität aus dem Tessin zum guten Ton gehört, mit ihr also „vernünftigerweise“ Vorteile assoziiert werden, führt dies dazu, dass die Mobilität als „neutral“ gilt, sie also keiner Rechtfertigung bedarf. Dagegen muss möglicherweise die Immobilität legitimiert werden, da sie dem „grand récit“ nicht entspricht. Dass dieser nicht „universally and/or timelessly true“, sondern „contestable […], contested, and interest-laden“ (Woolard & Schieffelin 1994: 58) ist, bleibt verborgen. Es kommt nur zum Vorschein, was der entsprechenden ideologischen Ausprägung zufolge den „grand récit“ aufrechterhält. Der Fokus auf Ideologie lädt zum Nachdenken darüber ein, wie es zu diesem „grand récit“ (und keinem anderen) kommt, der „die Summe der Annahmen umfasst, mit deren Hilfe die Mitglieder eines Kollektivs soziale Wirklichkeit1 konstruieren“ (Spitzmüller 2005: 254). Mit dem Blick auf den „grand récit“ wird es möglich, Machtbeziehungen auf den Grund zu gehen (Woolard & Schieffelin 1994).
Im Zusammenhang mit dem Vorhaben, den Stellenwert der Sprache im Kontext der akademischen Mobilität über intra-nationale Sprachgrenzen hinweg zu ergründen, ist neben dem allgemeinen Konzept der Ideologie die Sprachideologie besonders fruchtbar. Doch woher kommt dieser Begriff und was ist darunter zu verstehen?
Im Jahr 1994 halten Woolard und Schieffelin (1994: 56) fest: Es bilde sich ein Konsens, dass es sich lohne, das, was Menschen über Sprache und Kommunikation dächten oder als selbstverständlich betrachteten, zu erforschen. Zwar hat sich bis heute noch kein einheitlicher Begriff von Sprachideologie durchgesetzt, aber es tauchen vermehrt Arbeiten – vorwiegend aus der Anthropologie – auf, die sich mit der ideologischen Dimension von Sprache auseinandersetzen. Diese befassen sich mit dem „Commonsense“ allgemein, der als Ausdruck einer kollektiven Ordnung angesehen wird, und untersuchen diesen in Bezug auf das Wesen der Sprache, das Wesen und die Absicht der Kommunikation und das Kommunikationsverhalten (Woolard 1992).
Rumsey (1990: 346) definiert Sprachideologien als „shared bodies of commonsense notions about the nature of language in the world“. Gemäss ihm ist Sprachideologie nicht nur anhand einer Analyse expliziter metasprachlicher Äusserungen identifizierbar (vgl. Silverstein 1979), sondern zeigt sich auch in sozialen oder sprachlichen Praktiken, die auf implizit bleibenden Vorstellungen beruhen. Woolard (1998: 3) greift diesen Gedanken in ihrer Definition auf: „Representations, whether explicit or implicit, that construe the intersection of language and human beings in a social world are what we mean by ‘language ideology’“. Beziehen wir die Komponente der Macht mit ein, die bei der Mobilitätsrichtung der Studierenden und dem daraus sich ergebenden Spracherwerb mitspielt und in dieser Arbeit von Bedeutung ist, ist Sue Gals Definition besonders hilfreich: „Ideology is […] defined not as a neutral system of ideas, but rather as the way in which meaning, and thus language, serves to sustain relations of domination“ (Gal 1989: 359). Mit ihrer ablehnenden Haltung gegenüber der Neutralität gleicht diese Definition Judith Irvines Verständnis von Sprachideologie, welche die Interessen noch expliziter hervorhebt. Laut Irvine steht Ideologie für „cultural (or subcultural) system of ideas about social and linguistic relationships, together with their loading of moral and political interests“ (Irvine 1989: 255).
Sprachideologien – ob implizit oder explizit – haben Auswirkungen darauf, wie wir unsere Wirklichkeit erleben, darin sozial und sprachlich handeln und welcher Platz uns darin zusteht. Irvine und Gal (2000: 37–39) haben erkundet, wie Sprachideologien zu untersuchen und woran sie festzumachen sind. In Anlehnung an Charles Sanders Peirce listen sie drei semiotische Prozesse auf. Als „Iconization“ bezeichnen sie einen Prozess, der sich dadurch auszeichnet, dass Sprachgebrauch zur direkten Abbildung sozialer Zugehörigkeit herangezogen wird. Diese Verbindung scheint natürlich und zwingend. So werden z.B. italienisch Sprechende, die sich an der Universität Bern aufhalten, „automatisch“ als TessinerInnen, d.h. als aus dem Tessin stammend, kategorisiert. „Erasure“, der zweite Prozess, entfernt oder blendet jegliche soziolinguistische Heterogenität aus, um möglichst grosse Homogenität herzustellen. So könnte etwa einer der italienisch Sprechenden aus Bern stammen; dieser wird aber nicht beachtet, da er dem ideologischen Schema nicht entspricht. Schliesslich umfasst der Prozess der „fractal recursivity“ Übertragungen von ikonischen Beziehungen auf andere Ebenen. Die italienische Sprache, die in einer Gruppe junger Leute an der Universität Bern gesprochen wird, wird etwa nicht nur mit dem Tessin verbunden, sondern auf gewisse Wesenszüge der italienisch Sprechenden überhaupt übertragen.
Die diesen Teil abschliessenden Ausführungen sollen dazu dienen, den Schweizer Kontext und die für den vorliegenden Forschungsgegenstand relevanten sprachideologischen Dimensionen zu umreissen. Die viersprachige Schweiz (mit ihren drei Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch) wird (je nach Interessen der „Erzählenden“ und je nach Adressat) als friedlicher Staat dargestellt, in dem vier (oder mehr) Sprachen harmonisch mit- und nebeneinander gesprochen werden. Verschiedene AutorInnen zeigen, dass dieses Bild täuscht bzw. ideologisch geprägt ist (vgl. Lüdi 2007; Del Percio 2013; Duchêne & Del Percio 2014; Flubacher 2014). Sie legen u.a. dar, dass die in der Verfassung definierte Schweizer Mehrsprachigkeit die Mehrsprachigkeit der in der Schweiz wohnhaften Anderssprachigen ignoriert. Zugleich arbeiten sie die ideologische Komponente, die der Mehrsprachigkeit anhaftet, heraus und decken auf, wie diese im institutionellen Kontext – in der Schweiz und in Europa – zur „neuen Norm“ erhoben worden ist und erhoben wird (vgl. Watts 1997; Maurer 2011; Perez & Materne 2015). Weiter weisen die AutorInnen darauf hin, dass das Territorialitätsprinzip in der Schweiz dazu führe, dass in einer Region – mit wenigen Ausnahmen – nur eine Sprache als Amtssprache gelten könne. Dies hat zur Folge, dass die Schweiz einem Mosaik von mehrheitlich einsprachigen Regionen gleicht, in welchen andere (Amts-)Sprachen einen eher geringen Stellenwert geniessen (Lüdi 2007: 160).
Jene, welche in der Schweiz wohnen und eine der (drei) romanischen Sprachen sprechen, stört zudem die diglossische Situation in der Deutschschweiz – in der punkto Flächen- und SprecherInnenanteil grössten Region. Ich könnte jetzt eine Diglossiedefinition (z.B. Ferguson 1959; Haas 2004) einbauen. Eine Definition dieses Begriffs müsste sogleich hinterfragt werden, da anzunehmen wäre, es handle sich dabei um eine „ideological naturalization of sociolinguistic arrangements“ (Woolard & Schieffelin 1994: 96). Ein knapper Hinweis mag dennoch hilfreich sein, um zu verstehen, worum es geht. Standarddeutsch und Schweizerdeutsch ko-existieren im Deutschschweizer Alltag. Kolde (1981) beschreibt die Diglossie als medial, d.h., dass je nach Wahl des Mediums Standard (Schriftliches wie z.B. Zeitungsartikel) oder Dialekt (z.B. Mündliches wie etwa „volksnahe“ Radiosendungen) verwendet werde. Watts (1999) geht dieser wiederum ideologisch geprägten und prägenden Kategorisierung kritisch auf den Grund und zeigt auf, dass die Verwendung der beiden Varietäten nicht bloss vom Medium abhängig sei. Vielmehr liessen sich dem Dialekt und der Standardsprache verschiedene „Überzeugungen“ zuordnen, die sich dann auf die Wahl des Mediums auswirkten. So gilt etwa der Dialekt als „Mutter-“2 und der Standard als „erste Fremdsprache“. Der Standard3 wird vorwiegend für Schriftliches und somit „Schulisches“ verwendet. Die DeutschschweizerInnen machen sich „echt schweizerisch“, indem sie ihren Dialekt verwenden. Dieser gilt also als Emblem der Zugehörigkeit zur Schweiz (vgl. Watts 1988, 1999). Watts (1999) gebraucht in diesem Zusammenhang auch den Begriff „ideology of dialect“.
Diese ideologischen Grundzüge, die dem Dialekt (und somit auch dem Standard) und der Mehrsprachigkeit der Schweiz anhaften, sind für die vorliegende Arbeit insoweit relevant, als sie erkennen lassen, in welchem Kontext die Tessiner Studierenden sich bewegen, wenn sie die Sprachgrenze zur Deutschschweiz überqueren. Sie geraten somit nicht nur in einen diglossischen Kontext, in dem sie sich sprachlich und sozial zurechtfinden müssen, sie bedienen sich auch verschiedener Sprachideologien und begegnen gleichzeitig einer Herkunftsgesellschaft, in der wiederum verschiedene (Sprach-)Ideologien (auch Tessiner Studierenden gegenüber) vorherrschen. Das Konzept der Sprachideologie ist somit nicht nur theoretisch, sondern auch analytisch fruchtbar. Es erlaubt erstens, unbewusste Annahmen über Sprache und Sprachverhalten zu theoretisieren, Annahmen, die sich darauf auswirken, wie Menschen Ereignisse interpretieren. Zweitens dient es als analytisches „Tool“, auf welches in der Datenanalyse anhand der drei erläuterten semiotischen Prozesse zurückgegriffen wird.