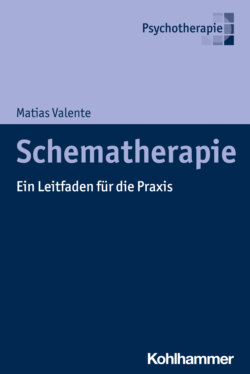Читать книгу Schematherapie - Matias Valente - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das SORK-Schema als Rückkoppelungsmodell der Verhaltenssteuerung
ОглавлениеAn dieser Stelle vielleicht eine kleine Anmerkung vorab: Ich versuche hiermit nicht, die gesamte Geschichte der Psychotherapie mit zwei schönen Grafiken und einer kleinen Anleitung zu erklären! Als Praktiker brauchen wir aber ein Instrument oder Modell als orientierende Hilfe, mit dem wir verschiedene Einflüsse/Techniken miteinander kompatibel machen und sinnvoll anwenden. In meiner persönlichen Erfahrung bieten sich die SORK-Kategorien sehr gut dafür an.
Wenn Sie verhaltenstherapeutisch ausgebildet sind, dann dürfte Ihnen das SORK-Modell bestens bekannt sein. In den allermeisten Abbildungen wird das SORK-Schema für die Mikroanalyse eines Problemverhaltens in linearer Form dargestellt, was sich im Bericht an den Gutachter bei einem Psychotherapieantrag in aller Regel wiederfindet. Schauen wir uns das Beispiel einer typischen SORK-Analyse zum Verständnis agoraphobischer Vermeidung an: Unser Patient hat sich vorgenommen, heute alleine zum Supermarkt zu gehen und steht vor der Wohnungstür (S), vor dem Hintergrund ängstlicher Persönlichkeitszüge und einer erhöhten Fokussierung auf körperlicher Veränderungen (O) denkt er »Ich schaffe es nicht, es wird etwas Schlimmes passieren … mir ist es zuviel« (R-kog), er nimmt dabei Herzrasen und starke Unruhe wahr (R-phys) und fühlt Angst bis Panik (R-emot), sodass er sich umdreht und wieder im Wohnzimmer hinsetzt (R-mot), wobei er eine schnelle Reduktion von Unruhe, Herzrasen und Angst erlebt (K-kf: Ꞓ), sein negatives Selbstbild, seine dysfunktionalen Überzegungen und sein Vermeidungsverhalten werden aber langfristig gefestigt (C-). Diese lineare Darstellung SORK suggeriert ein sehr mechanistisch-reduktionistisches Verständnis von Verhaltenssteuerung.
Unser Nervensystem ist jedoch nicht als lineare Maschine, sondern als hoch anpassungsfähiges System mit ständigen Rückkoppelungsschleifen konzipiert, welches eine möglichst effektive Interaktion mit der Umwelt ermöglichen soll.
Wie würde dann eine Mikroanalyse aussehen, wenn wir das SORK-Schema nicht als Kette, sondern als ständigen Kreis darstellen würden? Der Patient steht vor der Tür (S), die für ihn bereits ein Hinweisstimulus für aversive Erlebnisse geworden ist (O), sodass sein Körper sofort mit leichter Unruhe reagiert (R-phys), woraufhin er denkt »Ich gehe nur einkaufen, was kann da schon passieren?« (R-kog) und kurz durchatmet (R-mot), was seine Unruhe für einen sehr kurzen Augenblick bremst (K-Kf), sodass er erneut die Tür anschaut (K-Lf und neuer S). Er nimmt immer noch eine leichte Unruhe wahr (R-phys), er denkt an den letzten Versuch vor einem Tag, der nicht gut endete (R-kog) und spürt leichte Angst (R-emot), woraufhin er sich selbst sagt »Ich muss das heute schaffen« (R-kog) und einen Schritt in Richtung Tür macht (R-mot), woraufhin er die Tür näherkommen sieht (K und neuer S), wobei er etwas mehr Angst und Unruhe wahrnimmt (K der Handlung und zugleich R-phys und emot)… Ich könnte vermutlich noch fünf Seiten schreiben, bis wir zu seiner Entscheidung kommen, heute nicht einkaufen zu gehen. Anschließend könnten wir aber gleich die nächste Mikroanalyse beginnen, denn nach seiner Entscheidung werden erst recht seine massiven Selbstvorwürfe und seine reaktive Depressivität bemerkbar.
Abb. 0.1: Das SORK-Modell
Das klingt zunächst sehr kompliziert. Man könnte es sogar sicherlich noch komplizierter machen, denn diese Rückkoppelungskreise sind sehr schnell und ergeben häufig eine Art Spirale ( Abb. 0.1), die am Beispiel der Agoraphobie manchmal zur Vermeidung, manchmal zum Verlassen des Hauses führt, jedoch während des Prozesses immer wieder fluktuiert. Es ist in der Tat für die Psychoedukation des Patienten völlig ausreichend, eine deutlich einfachere und lineare Darstellung seiner Symptomatik zu verwenden. Beim »geleiteten Entdecken« oder auch beim Hyperventilationstest leiten wir jedoch in aller Regel unsere Patienten vielmehr im Sinne der Feedbackschleife an und befragen sie zu ihren unmittelbaren Beobachtungen, denn während der praktischen Arbeit – anders als beim Verfassen eines Therapieantrags – wird uns bewusst, dass die lineare Darstellung der Mikroanalyse der Realität einfach nicht gerecht wird.
Das SORK-Modell ist zugegebenermaßen ein traditioneller verhaltenstherapeutischer Ansatz, sodass analytisch oder tiefenpsychologisch arbeitende genauso wie systemisch sozialisierte Kollegen zunächst etwas irritiert schauen dürften, wenn ich die SORK-Kategorien im Sinne eines Instruments zum allgemeinen psychotherapeutischen Verständnis verwende. Und das ist verständlich! Ich bitte Sie – wenn dies der Fall ist – dem Ganzen noch eine Chance zu geben. Das SORK-Modell als Darstellung ständiger Feedbackschleifen setzt keine besonderen Schwerpunkte, es wertet nicht das sichtbare Verhalten höher als die emotionalen oder die kognitiven Reaktionen. Die Wertung erfolgt innerhalb der einzelnen Theorien: Kognitive Therapeuten legen den Schwerpunkt auf kognitive Prozesse und deren Einfluss auf emotionale Reaktionen und das sichtbare Verhalten, klassische Verhaltenstherapeuten auf das sichtbare Verhalten, tiefenpsychologisch-analytische Kollegen auf die emotionalen Reaktionsanteile, Systemiker auf die Interaktionsmuster, welche in Beziehungen, Familien und Gruppen entstehen. Die Organismus-Variable spielt eine wesentliche Rolle, wenn wir die Rolle biologischer Prädispositionen und Lernerfahrungen konzeptualisieren möchten. Dort können wir unbewusste Prozesse, Triebe und Instinkte sowie assoziative Reizbeziehungen, dysfunktionale Grundannahmen oder auch regelgesteuert gelernte Bezugsrahmen einordnen. Und natürlich auch Schemata im Sinne der Schematherapie.