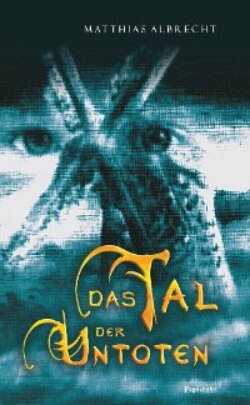Читать книгу Das Tal der Untoten - Matthias Albrecht - Страница 11
V
ОглавлениеEines Morgens wollten wir die Unterkunft verlassen, um unserer Arbeit nachzugehen. Noch in der Tür zögerten die Vorderen. Die Landschaft draußen hatte sich verändert. Die Ruhehäuser waren weg. Die Wege, Gatter, Hütten, Bäume – wie vom Erdboden verschwunden.
So etwas Ähnliches hatten wir erst kürzlich erlebt: Als sich vor zehn Tagen dicker Nebel ins Tal wälzte, dass man die Hand vor Augen nicht erkennen konnte. Da fanden sich nicht mal die Lebenden zurecht, und wir blieben bis zum nächsten Tag in unseren Häusern. Irgendwie schafften es die Schwestern am Abend, bis zu uns vorzudringen und uns wenigstens den Drink zu verabreichen. Deshalb wurde auch niemand aggressiv und streitsüchtig.
Dennoch – wir sollten jetzt eigentlich im Bergwerk sein und Höchstleistungen vollbringen. Schnell wurden wir unruhig. Wir wollten raus. Raus und an die Arbeit. Wir waren es so gewohnt. Einige begannen, ziellos im Raum umherzulaufen. Andere saßen auf ihren Betten und wippten mit dem Oberkörper vor und zurück. Wieder andere, darunter auch ich, puhlten das Stroh aus ihren Matratzen, nur um etwas zu tun.
Die Schwestern wussten sich keinen Rat, und eine ging, den Oberaufseher zu holen. Es dauerte eine Weile, ehe sie mit ihm zurückkehrte. Als er dann in der Tür stand, erfasste er die Situation mit einem Blick. Ich weiß nicht, wie er es schaffte, doch plötzlich waren wir alle Huntstößer. Als Hauer hätten wir im Ruhehaus auch schlecht beschäftigt werden können. So stellte sich auf Weisung des Oberaufsehers nun ein jeder vor sein Bett, schwenkte es um neunzig Grad herum, und schob dann das Gestell gegen den Uhrzeigersinn durch das Haus. Immer einer hinter dem anderen. Auf gerader Strecke kein Problem. In den engen Kehren an den Stirnseiten des Hauses jedoch kamen wir ins Schwitzen. Es war ein Kraftakt, die schweren Betten herum zu wuchten. Zu Beginn kam es öfter zur Staubildung, weil man warten musste, bis der Vordermann um die Kurve war. Doch bald hatten wir den Dreh raus. Die Geschwindigkeit erhöhte sich. Der Oberaufseher stand mit verschränkten Armen grinsend in der Tür, derweil sich die Schwestern die Ohren zuhielten. Im Quietschen und Kreischen, mit denen die grob gearbeiteten, hölzernen Füße von sechzig Betten über die Dielen schabten, wäre selbst der Lärm eines Presslufthammers untergegangen.
Am frühen Nachmittag waren wir am Ende. Wir nahmen unseren Brei zu uns und fielen auf die Betten, die wir mit letzter Kraft wieder an ihren angestammten Platz geschoben hatten. Und Sekunden später in tiefen Schlaf.
Würde es heute wieder so kommen? Niemand traute sich, die Schwelle zu überschreiten. Die Schwestern redeten uns gut zu. Ob wir nicht das Lämpchen über der Tür des Nachbarhauses sehen würden, fragten sie und lachten. Es sei diesmal kein Nebel sondern Schnee. Dann zeigten sie auf die Gemüsebauern, die während des Winters anderweitig beschäftigt werden mussten. Sie räumten die Wege, damit wir zum Bergwerk gelangen konnten. Wir atmeten auf. Schnee kannten wir – aber solch eine Menge hatten wir noch nicht gesehen. Auf dem Weg zur Arbeit staunten wir über die aufgetürmten, mannshohen Wälle aus Schnee zu beiden Seiten unseres Weges. Die Bauern hatten ganze Arbeit geleistet.
Nicht dass Missverständnisse aufkommen: Wir staunten über jene Schneemassen nicht so, wie es Lebende tun würden, aber wir bemerkten sie immerhin und ahnten das Ausmaß dieses Naturphänomens zumindest im Ansatz. Das war für uns Untote bereits eine unerhörte geistige Leistung. Als wir einfuhren, waren diese Eindrücke allerdings schon wieder aus unseren Hirnen gelöscht.
Im Berg war es, verglichen mit der Außentemperatur, regelrecht warm. Wir hauten drauflos, dass es eine Art hatte. Die Huntstößer schoben ihre vollen Loren mit einer Geschwindigkeit zum Förderschacht, als gäbe es kein morgen. Die Spurlatten vibrierten regelrecht auf den geraden Strecken. Und um die Kurven bellten die Hunte, wenn sich Holz auf Holz rieb, wie kläffende Terrier. Ein quietschendes, nervenzerreißendes Bellen.
Wir wollten den Rückstand aufholen. Die Norm erfüllen. Übererfüllen! Pluspunkte sammeln. Jeder Einzelne von uns. Das war sogar den Oberaufsehern suspekt. Nur mühsam gelang es ihnen, unsere Arbeitswut zu zügeln. Was hatten sie davon, wenn uns ein Unfall zustieß oder wir einen Schwächeanfall erlitten? Wenn wir für Tage, gar Wochen, ausfielen? Und vor allem: Was hatten wir davon? Eine Zurückstellung vom Paradieseintritt – wie lange auch immer – wäre wohl noch das geringere Übel gewesen …
An diesem Tag gab es nur acht leicht und zwei mäßig stark Verletzte. Keine Toten. Das war das Verdienst der Aufseher, die uns beizeiten gestoppt hatten.
Kurz vor dem Zubettgehen kamen die Schwestern mit ihren untoten Helferinnen. Jetzt gab es den Drink. Ich spürte den Napf an meinen Lippen und schluckte automatisch. Wenig später fiel ich in tiefen, traumlosen Schlaf. Doch währte dieser nicht lange. Geraume Zeit vor dem Wecken lag ich mit offenen Augen auf meiner Lagerstatt und starrte in die Dunkelheit. Irgendetwas war anders als sonst. Ich schwitzte, obgleich ich mich weitab vom Ofenfass befand. Mein Herz raste, und meine Kehle war trocken. Ich hatte Durst. Meine Handgelenke, Oberarme und Schenkel schmerzten. Das war mir noch nie passiert. Waren das Symptome einer Krankheit? Ich war doch noch nie krank gewesen. Wie sollte ich als Kranker meine Norm schaffen?
Ich setzte mich auf. Mir schwindelte, und ich fühlte mich schwach. Also doch krank? Also doch!
Nach und nach beruhige ich mich. Es würde schon wieder werden. Ich durfte mir nichts anmerken lassen und legte mich wieder hin. In meinem Kopf herrschte ein buntes Durcheinander. Gedanken kamen und gingen, bevor es mir gelang, deren Sinn zu erfassen. Es strengte mich an, und bald ließ ich es bleiben. Es machte mir Angst, hatte ich mir doch nie zuvor soviel Gedanken gemacht. Endlich schlief ich doch ein.
Meine Hacke trifft das Gestein nicht im rechten Winkel und wird mir beinahe aus der Hand geschlagen. Splitter verletzen meinen Nachbarkumpel an der rechten Wange und der Schläfe. Dunkles Blut läuft ihm über das Gesicht. Er bemerkt es nicht. Sein Blick streift mich nur kurz und teilnahmslos. Dann führt er seinen letzten Schlag, dreht sich nach links und geht zum Ende der Schlange. Ich folge ihm. Der Aufseher tritt zu mir heran. Fragt, was los sei mit mir. Er hat alles gesehen. Ich gebe keine Antwort.
„Das ist nicht professionell, M203“, sagt er. Nicht professionell heißt: Nicht der Norm entsprechend. Und damit ist nicht die Arbeitsleistung, sondern das Verhalten gemeint.
Er zieht mir das rechte Lid empor, leuchtet mir ins Auge und runzelt die Brauen. „Du bist doch nicht krank, 203?“
Ich zucke die Schultern. „Heute Nacht …“
„Was war in der Nacht?“
„Ich, ich weiß nicht. Irgendwie anders.“
„Versuche es zu beschreiben.“
Ich schließe die Augen und tue mein Bestes, doch die Erinnerung will nicht kommen. Der Aufseher klopft mir auf die Schulter. „Ihr seid beide wieder dran. Reiß dich jetzt zusammen.“
Ich nicke, hebe die Hacke und schlage zu. Diesmal trifft die Breitseite des Blattes den Fels. Prallt zurück und gegen meine Stirn. Ich gehe zu Boden.
„Ausfahren!“, befiehlt der Aufseher. Mühsam komme ich auf die Beine, torkle zum Ende der wartenden Hauer und breche erneut zusammen. Der Huntstößer wird angewiesen, mich aufzuladen. Er schafft es nicht allein. Ich bin ein Doppelzentner schlaffes, kraftloses Fleisch.
„Helfen!“Andere packen mit zu und wuchten mich rücklings auf die Lore. Dann werde ich ausgefahren. Ich sehe noch die Verschalung über mir vorübergleiten, dann schwinden mir die Sinne.
Was für ein Traum! Oder war es gar keiner? Ich sah mich um. Und wusste plötzlich, wo ich mich befand: In der Sanitätsbaracke! Hier herrschte nicht gerade Hochbetrieb. Untote wurden nur selten krank. Und ausgerechnet mich musste es erwischen. Außer mir lagen hier noch zwei „Versager“ in ihren Betten und schienen mehr tot als lebendig zu sein. Sie bewegten sich kaum und waren blass wie eine frisch gekalkte Wand. Wäre es mir möglich gewesen, meine Gedanken zu ordnen, hätte ich über diesen Witz schmunzeln können. Halbtote Untote im Krankenrevier! Zum Totlachen.
Auf den ersten Blick unterschied sich diese Baracke nicht wesentlich von unseren Unterkünften. Nur dass sie kleiner war. Kürzer. Kein Langhaus. Statt dreißig Betten lediglich zehn auf jeder Längsseite. Der obligatorische Ofen mit dem Drahtkäfig drum herum stand auch hier inmitten des Hauses. Doch links neben jedem Bett befand sich ein kleines Schränkchen, welches nur die Schwestern zu öffnen vermochten. Manchmal, wenn eine von ihnen ans Bett des Kranken trat, entnahm sie diesem Schränkchen etwas und – tja, ich weiß nicht, was sie dann damit machte, aber irgendwie hatte es wohl mit der Pflege oder Betreuung zu tun. Vielleicht handelte es sich um Medizin. Oder Verbandsmaterial. Etwas in der Art.
Anfangs war ich sehr nervös. Eigentlich lag es nicht in unserer Natur, nervös zu sein oder diese Empfindung auch nur im Ansatz zu fühlen. Geschweige denn, sie in unser Bewusstsein zu lassen. Doch ich spürte es. Etwas Fremdes schien von mir Besitz ergriffen zu haben. Ich spürte auch, dass es mit der Zeit nachließ. Und wieder von mir Besitz ergriff, als ich die untote Helferin meiner Schwester erkannte. Die, welche mir gestern den Drink gereicht hatte.
Normalerweise empfanden männliche Untote nichts beim Anblick von weiblichen. Und umgekehrt. Das dürfte kaum verwunderlich sein, nicht wahr? Und damit hatte ich nun ein Problem. Denn ich erkannte diese Untote nicht nur – ich empfand auch etwas, das ich nicht in Worte kleiden konnte. Es ist ja schon für einen Lebenden schwer genug, seine Gefühle für das andere Geschlecht zu beschreiben, wie viel mehr dann für einen Untoten?!
Als sie mir an diesem Abend die Medizin verabreichte, wollte ich ihr eine Frage vorlegen. Allerdings kam mir kein Wort über die Lippen. Nicht dass ich die Fähigkeit, zu sprechen, eingebüßt hätte, obgleich das kein Wunder gewesen wäre, denn im Allgemeinen reden Untote ja nicht viel. Ich hatte das, glaube ich, bereits erwähnt. Es ist nur so, dass ich in diesem Moment nicht in der Lage war, meine Frage in Worte zu fassen.
Sie spürte meinen verzweifelten Versuch, ihr etwas mitzuteilen, berührte – mit einem schnellen Seitenblick auf die Schwester – ihre Lippen mit dem Zeigefinger und drückte meinen Oberkörper mit sanfter Gewalt auf die Lagerstatt. Dann legte sie die Hände flach aneinander, hielt sie sich an die Wange, neigte den Kopf zur Seite, schloss dabei kurz die Augen und nickte mir zu, als wollte sie sagen: „Schlaf nun oder tu wenigstens so.“ Die Schwester bekam von alldem nichts mit, denn sie war dabei, meine Schnittverletzungen an den Unterschenkeln zu verarzten. Tatsächlich entspannte ich mich und schlief kurze Zeit später ein.
Irgendwann in der Nacht – der Heizer war bereits gegangen – wurde ich wachgerüttelt. Ich öffnete die Augen und erkannte im diffusen Schein einer Öllampe „meine“ untote Assistentin. Wieder hielt sie sich den Finger an die Lippen, dann flüsterte sie: „Sprich leise und bewege dich nicht! Erkennst du mich?“
Ich nickte.
„Wie fühlst du dich?“
Diese Frage überforderte mich. Was meinte sie? Was wollte sie hören? Was sollte ich antworten? Es wäre besser gewesen, sie hätte mir die Antworten in den Mund gelegt. Als Alternativen, meine ich.
„Ich – eh …“
„Spürst du etwas Merkwürdiges?“
„Etwas Merkwürdiges?“ Ich verstand sie nicht. Worauf wollte sie hinaus?
„Ich meine etwas, das du zuvor nicht gefühlt hast. Ist irgendwas anders als sonst?“
Ein paar Sekunden lang unternahm ich den krampfhaften Versuch, zu denken. Dann sagte ich: „Ich – ich sollte jetzt schlafen.“
Sie lächelte. „Richtig. Und warum?“
Wieder so eine Frage. Warum? Na, weil, weil …
„Weil es so sein muss?“
„Genau. Und wieso schläfst du dann nicht?“
Mir wurde warm. Nicht deshalb, weil sie eigentlich ganz hübsch war. Dies bemerken zu können, verwirrte mich zusätzlich. Aber diese Fragen! Sie zu beantworten fiel mir schwerer, als in einer Stunde einen Zentner Gestein zu hauen. Als hätte ich unmittelbar vor einer mündlichen Prüfung die falsche Frage gezogen.
Mündliche Prüfung? Wie kam ich darauf?
„Wie-so-bist-du-wach?“ Sie betonte die einzelnen Silben, indem sie zwischen jeder eine kleine Pause machte.
Ich hatte das Gefühl, dass von dieser Frage mein Eintritt ins Paradies abhängen würde und strengte mich an, die Antwort zu finden. Jetzt schwitzte ich regelrecht.
„Weil – weil du – mich – geweckt hast?“
„Gut“, sagte sie und schaute sich um. Die beiden Kranken hielten die Augen geschlossen und schliefen. Oder waren zumindest nicht in der Lage, ihr Umfeld wahrzunehmen. „Das wollte ich hören. Du machst schnell Fortschritte. Das ist ausgezeichnet.“
Ich lächelte und atmete auf. Ich hatte wohl die richtige Antwort gegeben. Natürlich rein zufällig. Wie ein Lottospieler, der spontan die richtigen Zahlen tippt.
Was, zum Teufel, ist ein Lottospieler …
„Hier, trink das!“
Ich fühlte einen Becher an meinen Lippen und schluckte mechanisch. Es schmeckte bittersüß wie die Medizin, die wir alltäglich bekamen.
„Ich habe doch schon am Abend …“
„Das hier ist etwas anderes“, unterbricht sie mich. „Eine andere – eh – Medizin.“
„Eine andere?“
„Jetzt höre mir jetzt genau zu, 203. Dein Leben hängt davon ab!“
Mein Leben? Nicht das Paradies? Was ist denn Leben? Was kann ein Untoter mit Leben anfangen? Mein irritierter Blick schien Bände zu sprechen, denn sie sagte: „Du hast vor deiner Zeit als Hauer ein Leben gehabt, 203. Wie jeder andere Untote auch. Kannst du dich daran erinnern?“
Ich schüttelte den Kopf. Diese Behauptung kam mir lächerlich vor.
„Nein“, sagt sie und atmete desillusioniert auf. „Soweit bist du noch nicht. Aber bald. Bald wirst du wissen, was ich meine.“
„Gut“, hörte ich mich sagen. „Ich bin müde. Kann ich jetzt schlafen?“
„Gleich“, sagte sie. „Erst muss ich dich noch instruieren.“
Ich hatte dieses Wort noch nie gehört, verband jedoch etwas Unwiderrufliches damit. Etwas Schlimmes.
„Willst du mir den – den Kopf absägen?“
Sie hielt sich die Hand vor den Mund. Beinahe hätte sie laut aufgelacht. Mir war nicht klar, was so lustig an einer Hinrichtung sein sollte.
„Nein du Dummerchen. Ich muss dir aber ein paar Verhaltensregeln einhämmern, damit du dich nicht verrätst.“
„Was meinst du?“
„Beantworte mir zunächst folgende Frage: Bist du schon einmal lebendig begraben worden?“
„Be-gra-ben?“
„Mit Trommeln, Fackeln, Gesängen, Beschwörungsformeln und so. Kannst du dich daran erinnern?“
„Die Trommeln. Ja. Und die Gesänge …“
„Und die bemalten Gesichter und Masken. Und der Kumys, den du zuvor getrunken hast.“
„Der Kuhmist?“ Jetzt musste ich schmunzeln. „Die alte Melly hat ihn …“
Weniger als Bier – Nur ’n paar Prozent – Nich der Rede wert – Weit über neunzig – Baba Jaga – Kuhmist –Besser als gedacht – Lebenselixier …
Ich setzte mich so schnell auf, dass mir schwindlig wurde.
„Ich – ich war in einem … man hat mich in einen Sarg …“
„Jeden von uns“, sagte sie und hielt sich wieder den Finger vor den Mund. „Aber sprich leiser!“ Sie sah zu den anderen Patienten hinüber, die sich nicht bewegten. „Du kannst dich also erinnern?“
Ich nickte. Mein Mund war plötzlich so trocken. Und der Kopf brummte, als beherbergte er ein Hornissennest.
„Daran – ja. Aber nicht an das, was davor war.“
„Auch nicht an deinen richtigen Namen?“
„M203 …“
„Nein. Deinen Namen vor deiner, eh, Verwandlung.“
„Welche Verwandlung? Und was sind Hornissen?“
„Hornissen? Wie kommst du denn auf die?“
„Ich – ich weiß nicht …“
Sie schüttelte den Kopf und flüsterte. „Vergiss das jetzt! Und begreife endlich: man hat dich und uns zu Zombies gemacht“. Ich spürte ihren warmen Atem. „Verstehst du? Zu Zombies. Zu willenlosen Werkzeugen.“
„Zombies …“, wiederholte ich und schaute sie fragend an. „Was sind Zombies?“
„Jedenfalls nicht Leichen fressende, halb verweste, teils skelettierte, mit eitrigen Binden umwickelte Kreaturen, wie man sie aus Büchern oder Filmen kennt. Es ist ein bestimmter Voodoo-Zauber. Wenn ein Mensch mit Gift vermischten Kumys trinkt, lebendig begraben und nach kurzer Zeit wieder ausgebuddelt wird, glaubt er, in einer Zwischenwelt gefangen zu sein. Nicht mehr lebendig, aber auch noch nicht wirklich tot. Ein Erdgebundener, dem eigene Entscheidungen verwehrt bleiben. Sein Erinnerungsvermögen an früher ist gleich null. Er hat keinen Willen mehr und tut alles, was man von ihm verlangt.“
Ich gab mir Mühe, ihr zu folgen. Es gelang mir nur teilweise, doch immerhin in einem Umfang, der mich ahnen ließ, was mit mir passiert war.
„Natürlich“, fuhr sie fort, „funktioniert das nur, wenn man ihm regelmäßig Atropinsulfat in Verbindung mit anderen Wirkstoffen verabreicht. Sonst wacht er wieder auf. So wie du jetzt.“
„Die – Medizin, die ich jeden Abend …“
„Ja. Aber ich habe sie ausgetauscht.“
„Aus-ge-tauscht? Seit – wann?“
„Seit gestern. Du hast seitdem bestimmt schon einige Dinge bemerkt, die ungewöhnlich waren.“
„Ich bin in der Nacht aufgewacht. Das ist noch nie passiert. Und ich – ich fühlte mich nicht gut.“
„Das war nur der Anfang. Ich bin dabei, dich aufzutauen. So nennen wir die Rückverwandlung eines Zombies in einen Menschen. Ich sorge dafür, dass du bald wieder zu dem wirst, der du einmal warst.“
„Du – du meinst – doch nicht etwa – zu einem Lebenden?“
„Genau das meine ich.“
„Aber – aber – ich will das nicht. Ich will nicht auftauen. Das – das Paradies! Der ewige Schlaf. Werde ich dann immer noch nach – nach dort kommen?“
„Oh Gott, du Armer!“ Sie tupfte mir den kalten Schweiß von der Stirn. „Du wirst etwas viel Besseres gewinnen als ewigen Schlaf. Na ja, zumindest in deinem wirklichen Leben.“
Ich schwieg und starrte zur Decke. Begann allmählich zu begreifen. Und auch wieder nicht.
„Kriegen die – die anderen auch die neue Medizin?“
„Nein. Nur ganz wenige. Kaum eine Handvoll. Du bist voraussichtlich der letzte von ihnen.“
„Wieso ich? Wieso gerade ich …“
„Du scheinst mir noch der Hellste zu sein unter all deinen Kumpels. Ich habe dich lange beobachtet.“
„Der Hellste?“ Ich schaute auf meinen Unterarm und fand, dass dessen Haut sich farblich nicht von der meiner Kameraden unterschied. Die Schwestergehilfin lachte leise.
„Wir sind – mit dir – insgesamt sechs. Allein können wir es weder wagen noch schaffen, zu fliehen. Deshalb brauchen wir dich. Aber du musst dich zusammenreißen. Musst dich weiterhin so geben und verhalten, als wärest du ein waschechter Zombie. Sonst fliegt deine Tarnung auf und wir mit ihr. Was das bedeutet, muss ich ja wohl nicht erläutern.“ Sie führte ihre angewinkelte Hand zum Hals und machte eine schnelle Bewegung, während ich es in Worte fasste:
„Kopf ab?“
Sie nickte.
„Oh …“
„Du sagst es. Die ewige Verdammnis. Kein Paradies. Kein Schlaf. Kein Leben. Nur bleierne, schmerzende, erstickende Müdigkeit bis zum Tag des Jüngsten Gerichts.“
Ich glaubte ihr in diesem Moment. Ich hätte alles geglaubt.
„Wann – wann gehen wir von hier weg?“
„Nicht heute und nicht morgen. Du wirst es erfahren, wenn es soweit ist. Durch mich oder einen meiner Kameraden.“
„Wie erkenne ich ihn, wenn – wenn du es nicht selbst bist?“
„Er oder sie wird dich mitten in der Nacht wecken und zum Sammelpunkt bringen. Ich kann dir nicht garantierten, dass ich es sein werde. Wir können die Aktion auch nur nachts starten. Am Tage wäre es zu gefährlich.“
„Und was soll ich nun tun?“
„Ich werde es dir nach und nach sagen. Und du wirst dich strikt daran halten. Kleine Schritte am Anfang. Keine großen. Das ist ganz wichtig, damit du keine Fehler machst. Und dann … Dann wird in Kürze dein bisheriges Dasein als Untoter Geschichte sein.“
Ich schluckte und nickte. „Wie heißt du?“
„Prima“, lächelte sie.
„Prima? Hast du keinen – keinen Nummernamen?“
Sie biss sich auf die Lippen. „Klar hab ich ’ne Nummer. W188. In Wirklichkeit heiße ich aber Yvonne. Und mit prima meinte ich, es ist schön, dass du jetzt auch mal von dir aus ’ne Frage stellst, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Thema steht. Das gibt Grund zur Hoffnung.“
Ich griff mir an den Kopf. „Ich verstehe nicht viel. Also, von dem, was du da sagst. Und ich kann nicht gut sprechen. Also – eh – reden.“ Dann sah ich ihr in die Augen. „Ist das schlimm?“
„Nein. Gar nicht. Ganz normal für jemanden, der seit Jahren kaum gesprochen und sich Gedanken gemacht hat. Und der gerade die ersten Schritte zurück ins Leben tut. Ganz kleine Schritte. Bei mir hat es Monate gedauert.“
„Und was soll ich jetzt tun?“
Sie nahm bedeutungsvoll meine Hand, schaute sich kurz um und kam mir dann so nahe, dass ich ihren warmen Atem spürte.
„Hör genau zu, was ich sage: Es gibt streng genommen kein Paradies. Das, was die euch weismachen, ist nichts anderes als der Zustand nach dem Tod. Nichts, nichts und abermals nichts. Bis in alle Ewigkeit.“
„Was ist – nichts? Ist es …“
„Psst!“ Sie fuhr herum, beruhigte sich aber gleich wieder. Einer der Schläfer hatte sich nur auf die andere Seite gedreht.
„Kannst du dich an die Zeit vor deiner Geburt erinnern?“
Ich schüttelte den Kopf. „Was ist Geburt?“
„Okay“, lächelte sie. „Mein Fehler. Ich meine an die Zeit, bevor du hierher kamst.“
Wieder versuchte ich etwas Unmögliches: Nachzudenken. Dann schüttelte ich den Kopf.
„Siehst du“, sagte sie. „Du kennst ja nicht mal deinen richtigen Namen als Mensch. Und so ist es auch nach dem Sterben. Es ist wie ein traumloser Schlaf. Keine Fähigkeit, zu denken oder etwas zu empfinden. Nur dass man eben nicht mehr erwacht. Niemals mehr.“
„Aber – ist das nicht so wie im Paradies?“
Sie lehnte sich zurück. In ihrem Blick lag etwas Merkwürdiges, das ich nicht zu deuten wusste.
„Ja“, sagte sie leise. „Wenn man es so sieht …“
Sie schwieg einige Sekunden lang. Ich wurde ungeduldig. Und immer müder.
„Was willst du denn nun, was ich machen soll?“
„Du hast recht. Ich kann dir während der paar Minuten, die wir jetzt Zeit haben, nicht das ganze Universum erklären. Für dich und uns ist jetzt nur eines wichtig: Du musst auch weiterhin so tun, als ob du die Zombie-Medizin bekommst. Darfst dir nicht anmerken lassen, dass du plötzlich anders bist als deine Kumpels. Dieses Gespräch zwischen uns hat es nie gegeben! Nur für dich. Im Geheimen, verstehst du?“
Ich atmete tief durch, nickte – und schüttelte dann wieder den Kopf.
„Oh Gott“, sagte sie und holte ihrerseits Luft. „Ich merk schon – ich bin keine gute Lehrerin.“
„Ich bin müde“, sagte ich.
„Okay, du hast recht. Ich muss jetzt ohnehin gehen. Also tu einfach das, was deine Kumpels tun. Beobachte sie genau. Denke anfangs nicht tiefgründig über alles nach. Stell keine Fragen. Und wenn du gefragt wirst, dann antworte nicht zu schnell und sprich monoton. So als hättest du Mühe, die Frage zu verstehen. Halt so wie immer. Weißt du, was monoton heißt?“
„Ohne Gefühl?“, riet ich aufs Geradewohl.
„Etwas in der Art, richtig. Du darfst keine Gefühle zeigen. Im Übrigen haben Untote keine besonders gute Auffassungsgabe. Merke dir das! Bewege dich langsam, aber zielgerichtet. Den Blick immer nach vorn oder unten. Schau keinem direkt in die Augen. Sie würden bemerken, dass was nicht stimmt. Jedenfalls die Aufseher und deine Schwester. Vor allem die! Und komm bald wieder zu Kräften. Wenn du für sie wertlos wirst, weil du nicht mal mehr leichte Arbeiten verrichten kannst, werden sie dich entsorgen.“
„Du meinst – köpfen?“
„Ja.“
Sie erhob sich und drückte mir zum Abschied die Hand. „Schlaf jetzt. Ich komme morgen früh wieder. Na ja, oder nachher, wie man’s nimmt.“
„Ach – eh – Hundert… – Hundertacht.“
„Yvonne!“
„Ja. Yvonne. Was ist wenn – wenn ich es nicht kann?“
„Du kannst es. Ich konnte es ja auch. Es darf nicht schiefgehen!“ Sie blies das Flämmchen der Öllampe aus. „Und wenn, dann – dann helfe uns Gott!“
Einen Augenblick später war ich wieder allein. Wer war Gott? Der Vodoo-Meister? Wie konnte der helfen?
Ich lag auf meiner Bettstatt und starrte in die Richtung, in der ich die Decke des Hauses vermutete. Sehen konnte ich sie nicht. In meinem Kopf drehte sich alles. Ein buntes Gewimmel.
Nichts verraten! Die Kumpel beobachten. Keine Fragen stellen. Zielgerichtet bewegen. Und langsam. Ganz langsam!
Mit kleinen Schritten.
Ich begann wieder zu schwitzen.
Ich wollte, ich wäre tot.
Ich wollte, ich wäre im Paradies.