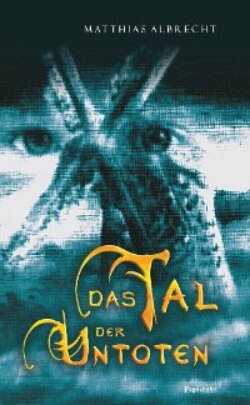Читать книгу Das Tal der Untoten - Matthias Albrecht - Страница 7
I
ОглавлениеIch hatte Zeit. Verdammt viel Zeit. Konnte, wenn mir der Sinn danach stand, stundenlang aus dem Fenster schauen und die Autos zählen, die in die Einfahrt zum Parkplatz der Justizvollzugsanstalt bogen. Und die Menschen, die ihnen entstiegen: Beamte, Besucher, Anwälte, Vernehmer, Postboten …
Es war mir zwar nicht möglich, den gesamten Platz zu überblicken, aber einen Großteil schon; immerhin „wohnte“ ich im obersten Stockwerk des Hafthauses.
Ich konnte mir auch vorstellen, einen Garten in der angrenzenden Anlage zu besitzen, Gäste eingeladen und gerade den Grill angefeuert zu haben. Bald bedeckte weiße Asche die Glut der Holzkohlebriketts und ich legte die ersten Fleischstücke auf. Saft und Fett tropften vom Rost – der Duft, den mir der Westwind herüber wehte, gab meiner Tagträumerei einen realistischen Kick. Ich schloss die Augen und schmeckte das frisch gebrutzelte Steak, das kühle Bier, den scharfen Senf – und schluckte schlussendlich die Traumwelt mitsamt dem sich in meinem Mund unwillkürlich gebildeten Speichel wie eine bittere Pille, während ich mich vom Gitter löste und in die Realität meiner „Bude“ zurückkehrte.
Seit knapp fünf Monaten war ich jetzt Gefangener. Ich teilte mein Los mit rund vierhundertachtzig weiteren Insassen. Nicht dass ich mich mit ihnen identifizierte. Wobei es natürlich welche gab, die – wie ich – glaubten, unschuldig eingesperrt worden zu sein. Das waren die wenigsten, wenn sie es zumeist auch nicht laut äußerten. Der Großteil fand sich in sein Schicksal und hielt die Füße still. Einige allerdings probten den Aufstand. Sie provozierten und beleidigten die Beamten oder griffen sie und ihre Mitgefangenen tätlich an, verstießen permanent gegen die Hausordnung, zerschlugen ihr Mobiliar, ritzten sich Wunden ins Fleisch, legten Feuer … Es handelte sich oftmals um Ausländer aus dem arabischen Raum, welche „auf Droge waren“ oder Inhaftierte anderer Nationalitäten, vor allem Osteuropäer, die sich nicht mit der deutschen Mentalität und den hier herrschenden Umständen anzufreunden vermochten. Doch auch Deutsche befanden sich darunter. Das muss ich der Fairness und Vollständigkeit halber einräumen.
Für solche Eventualitäten gab es seitens des Vollzugs spezielle Maßnahmen. In akuten Fällen der Selbstverletzungsgefahr oder gar Suizidandrohung reagierte man prompt mit der Verlegung des betreffenden Gefangenen in den sogenannten „Suizidpräventionsraum“. Einer Zelle, welche mit einer bruchsicheren Scheibe ausgestattet war, durch welche ein Beamter im Nachbarzimmer sämtliche Aktivitäten des zu Beobachtenden verfolgen konnte. Und die über eine reißfeste Matratze, widerstandsfähige Fensterscheibe, ein unzerstörbares Edelstahl-WC und ähnlich robustes Mobiliar verfügte. In extremeren Fällen griff man auch schon mal zum „Besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende Gegenstände“, kurz „BGH“, zurück, der aus einem mit Fußbodenheizung versehenen, gefliesten, nackten Raum bestand. Eine in ebenfalls reißfestes Material eingenähte Matratze und ein Loch im Boden, in welches man seine Notdurft verrichten musste – das waren die wenigen Einrichtungsgegenstände. Und das einzige Bekleidungsstück bestand aus einer superdünnen Unterhose, die in Fetzen riss, sofern man sie beim Anziehen nicht mit der nötigen Feinfühligkeit behandelte.
Auch ich habe leider meine Erfahrung mit dieser Räumlichkeit machen müssen, doch dazu später.
Jetzt wird Ihnen vor allem unter den Nägeln brennen, zu erfahren, weshalb ich in den Knast kam. Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Allerdings muss ich dafür etwas weiter ausholen. Aber ich habe ja jede Menge Zeit. Und Sie wohl auch. Sonst hätten Sie doch wohl nicht ernsthaft in Erwägung gezogen, sich diesen meinen geistigen Ergüssen zu widmen …
Am dreizehnten September des Jahres 1996 befand ich mich zwei Stunden vor regulärem Dienstende auf der A9 in Richtung Eisenberg. In der Ferne grummelte es: Eine Gewitterfront zog auf. Meine letzte Adresse lautete „Mühltal 6 – Waldgasthof Naupoldsmühle“. Zwei Pakete waren auszuliefern. Ich hätte mein Ziel mit verbundenen Augen finden können; das Mühltal war mir seit meiner Jugend durch zahlreiche Ferienaufenthalte bekannt.
Ich nahm die Abfahrt nach Bad Klosterlausnitz, durchquerte den Ort und schlug dann in Weißenborn den Mühltalweg zur Meuschkensmühle ein, der einer schmalen, improvisierten Straße glich. In der Zeit meiner Kindheit war diese unbefestigt und für Kraftfahrzeuge tabu; lediglich Anwohner, Zulieferer, Polizei, Feuerwehr, forstwirtschaftliche Fahrzeuge, die „Schnelle medizinische Hilfe“, wie die Rettungswagen früher hießen, und noch einige wenige Fahrzeuge mehr besaßen die Erlaubnis, sie zu nutzen. Ansonsten begegneten dem Wanderer lediglich Fahrradfahrer und Kremser. Und andere Wanderer.
War die Straße bereits für kleinere Personenkraftwagen nicht ohne stete Konzentration des Fahrers zu meistern, stellte sie für mich und meinen UPS-P45-Sprinter geradezu eine Herausforderung dar. Begegnen sich in einer der zahlreichen Kurven, ja selbst auf gerader Strecke, zwei Lieferwagen, heißt es für einen von beiden, bis zur nächsten Straßenverbreiterung zurückzusetzen, um den anderen vorbeifahren lassen zu können. Ohne Beifahrer als Einweiser ein Kunststück. Nebenbei nicht ungefährlich – die Rauda, der Mühlenbach, folgt der Straße unmittelbar zur Rechten oder Linken – je nachdem, in welche Richtung man sich bewegt. Außerdem ist das Ganze mit erheblichem Zeitaufwand verbunden.
Das Gewitter zog rasch näher; aufgewirbelter Staub und Tannennadeln nahmen mir die Sicht. Mit einem Schlag brach Dunkelheit herein, hin und wieder von Blitzen erhellt, und als ich die Meuschkensmühle passiert hatte, begann es wie aus Kübeln zu gießen. Der Sturm heulte. Kiefern- und Fichtenzapfen prasselten aufs Dach. Man konnte die Hand vor Augen kaum sehen, geschweige denn die Straße. Oder das, was die Eingeborenen und die hiesige Straßenbaumeisterei dafür hielten.
Ich schaltete in den zweiten Gang herunter und nahm den Fuß vom Gas, bereit, sofort mit beiden Füßen auf Kupplung und Bremse zu steigen, so es notwendig werden sollte. Die Scheibenwischer auf schnellstes Intervall gestellt und die Nase fast an der Frontscheibe, tastete ich mich voran. Jeder Fußgänger hätte mich jetzt überholt. Trotz Wetterkapriolen.
Nach der Wende hatte man die Straße nicht nur asphaltiert, sondern auch ein paar bauliche Maßnahmen gegen Erdrutsche unternommen. Dennoch waren solche nicht auszuschließen. Und gegen Windbruch gab es auch keine Versicherung. Wenn mir jetzt ein umstürzender Baum auf den Sprinter oder gar in die Frontscheibe krachte …
Gleißende Helligkeit schoss bis in die hintersten Winkel meines Hirns; ein Donnerschlag unmittelbar darauf, als sei eine Bombe detoniert. Der Wagen wankte. Instinktiv zog ich den Kopf ein, schloss die Augen. Mein rechter Fuß trat das Bremspedal durch das Karosserieblech, der linke rutschte von der Kupplung. Es war, als prallte der Sprinter gegen ein unsichtbares Hindernis, mein Oberkörper ruckte nach vorn – dann erstarb der Motor. Ich konnte es fühlen, doch nicht hören; das Inferno der entfesselten Naturgewalten ließ solches nicht zu. Und die Granaten, die zu Hunderten in meinem unmittelbaren Umfeld einzuschlagen schienen, wollten mir überdies die Trommelfelle zerreißen …
Bereits ein paar Minuten später ebbte das Blitzlichtgewitter ab. Ich kam allmählich zu mir. Der erste Gedanke: „Ich habe es überlebt!“ Der zweite: „Bis jetzt jedenfalls.“ Der dritte: „Bin ich noch auf der Straße?“ Diese Frage schien Vorrang zu haben und berechtigt zu sein, stand doch der Sprinter, wie ich jetzt bemerkte, seltsam schief, als sei mir der Motor bergauf verreckt. Badete der Transporter womöglich mit dem Hinterteil im Bach? Trotz der Schwüle in meiner Kabine rieselte es mir eiskalt den Rücken hinunter. Wenn dem so sei, könnte ich mich aus eigener Kraft nicht befreien. Allradantrieb hin oder her. Der P45 war kein Jeep, der sich mittels eines um einen Baumstamm gewundenen Drahtseils und einer Winde – wie Baron von Münchhausen an den eigenen Haaren mitsamt Gaul – selbst aus dem Sumpf herauszuziehen vermochte.
Ich fingerte eine Zigarette aus der Brusttasche meiner Dienstbekleidung, brannte sie an, zwang mich zur Ruhe und begann, Selbstgespräche zu führen: „Wenn ich aufgeraucht habe, werde ich nachsehen. Ich steige aus und mache mir ein Bild von der Situation. Stecke ich wirklich mit dem Arsch in der Rauda, ist wenigstens die Straße für andere frei. Die Ladung ist auch sicher. Vorausgesetzt – es ist nicht allzu viel zu Bruch gegangen und die Hecktür ist nicht aufgesprung …“
Ich zog die Notlampe aus der Halterung und leuchtete in den Durchgang zum Laderaum. Die Hecktür war zu. Die Pakete zum Teil aus den Regalen gerutscht. Egal. Höhere Gewalt. Beschädigungen zahlen die Versicherungen im Schadensfall. Derartige plötzlich auftretende Wetterkapriolen kann man ja schließlich nicht vorhersehen. Und ich habe mich den Bestimmungen gemäß verhalten. Bin kein Risiko eingegangen. Stattdessen Fuß vom Gas, rechts ran und abgewartet, bis die Gefahr vorüber war. Ja gut, rechts ran war in diesem Fall nicht machbar. Das besorgte die Böschung des Bachs von allein. Wie gesagt – höhere Gewalt …
Die Scheibe der Fahrerseite ließ sich nicht mehr per Knopfdruck absenken, trotz eingeschalteter Zündung. Ich musste die Tür öffnen, um die Kippe hinauszuwerfen. Erst als ich sie wieder schloss, verarbeitete mein Hirn den Gedanken: Ja, die Zündung war eingeschaltet, doch keinerlei Anzeige zeugte davon. Der Sprinter war tot, als habe jemand die Batterie abgeklemmt. Kein Abblendlicht, keine Instrumentenbeleuchtung. Ob sich infolge des Rucks, mit dem das Fahrzeug zum Halten kam, eine der Batterieklemmen gelöst hatte? Unwahrscheinlich. Oder – hatte der Blitzschlag die Elektronik lahmgelegt? Schon eher möglich.
Es regnete noch immer. Nicht mehr so stark wie noch vor Minuten, doch ausreichend. Sei’s drum, ich musste raus, um mir ein Bild zu machen! Ich beleuchtete mein linkes Handgelenk. Vier Minuten vor sechs Uhr nachmittags. Und es herrschte noch immer finstere Nacht! Das Gewitter zog zwar ab, dennoch schien sich die massive Wolkendecke hartnäckig halten zu wollen.
Ich stieg aus dem Sprinter, rutschte auf glitschigem Moos aus und schlug der Länge nach hin. „Prima“, dachte ich und raffte mich auf. „Wenn es dicke kommt, dann richtig!“ Immerhin hatte ich mir nichts getan. Im Widerschein der vereinzelten Blitze vermochte ich meine Umgebung nur schemenhaft wahrzunehmen. Ich schaute zunächst nach der Batterie. Die Klemmen saßen fest auf den Polen. Für jede weitere Ursachenforschung fehlte mir das fachliche Wissen. Also ließ ich die Hände vom Motorraum und sah mich um.
Ich steckte nicht im Bach. Von dem war weit und breit nichts zu entdecken. Das beruhigte mich ein wenig. Die Straße konnte ich von hier aus allerdings auch nicht erkennen. Was das eben so positive Gefühl relativierte.
Ich folgte dem Weg, den meine Räder in den Boden gefräst hatten, zurück. Nach gefühlten zwanzig Metern blieb ich ratlos stehen. Keine Straße weit und breit. Wie war der Wagen auf die kleine Lichtung gekommen, auf der er jetzt stand? Wieso war ich nicht mit einem Felsen oder Baum kollidiert? Ich war nicht abgebogen. Hatte stets den Weg vor Augen gehabt. Nicht gerade deutlich. Aber doch so, dass ich mir sicher sein durfte …
Die Erkenntnis, die ich in diesem Augenblick gewann, durchfloss mich wie ein Stromschlag: Die Spuren meines Sprinters endeten abrupt an einem wilden Brombeerdickicht mit angrenzendem, undurchdringlichem Unterholz! Ein paar Meter dahinter erhob sich ein hoher, dichter Fichtenbestand, der noch vor wenigen Jahrzehnten eine Schonung gewesen sein mochte. Keine Chance, sich von dort aus eine Schneise zu bahnen. Nicht einmal mit einem Panzer. Schon gar nicht mit einem UPS-Mercedes-Sprinter. Und – das kam erschwerend hinzu – von einer Schneise im eigentlichen Sinn gab es auch nicht die leiseste Andeutung …
Ich starrte auf die Reifenspuren, derweil meine Lampe zunehmend schwächer strahlte. Um alle Eventualitäten auszuschließen (ich hätte es ja auch mit frischen Abdrücken eines Forstfahrzeugs zu tun haben können), folgte ich ihnen zurück in Fahrtrichtung und achtete darauf, nicht deren Verlauf aus den Augen zu verlieren. Als ich wenig später auf das Heck meines Sprinters stieß, war ich der Verzweiflung nahe. Was in aller Welt war geschehen? Wie kam ich hierher? Und wo, in des Teufels Namen, war die verdammte Mühltalstraße?
Mit dem letzten Licht der Lampe betrachtete ich den Boden vor dem Fahrzeug. Der Waldboden war unberührt. Keine Reifenspuren.
Ich war völlig durchnässt und zitterte. Ob vor Kälte, Angst oder Verzweiflung, weiß ich im Nachhinein nicht zu sagen. Wahrscheinlich war es ein Konglomerat aus allen drei Empfindungen. Obendrein stand ich nun vollends im Dunkeln. Die Lampe hatte ihren Geist aufgegeben.
Im Fahrzeug war es zwar nicht warm, aber ich fühlte mich hier doch wohler als draußen. Was nun tun? Wie sollte es weitergehen? Mir fiel mein Handy ein. Ich öffnete das Handschuhfach und tastete nach ihm. Fand es und wählte die Nummer der Firma. Kein Netz! Auch das noch. Vielleicht befand ich mich in einem Funkloch, oder das Gewitter hatte einen der Mobilfunkmasten lahmgelegt. Ich hoffte auf ersteres, verspürte jedoch wenig Lust, zu Fuß durch den Wald zu irren in der Hoffnung, irgendwo eine Verbindung zu bekommen. Wahrscheinlich hätte ich nicht wieder zum Sprinter zurückgefunden.
Wo war diese verfluchte Straße? Wieso stand ich mitten im Wald? Ja und – weshalb hatte ich anfangs das Gefühl gehabt, der Sprinter würde schief stehen? Er stand doch völlig gerade!
Es hatte keinen Sinn, mir diese Fragen zu stellen; es gab hier niemanden, der sie mir beantworten konnte. Mit Logik kam ich nicht weiter. Sie war angesichts der soeben gemachten Feststellungen wenig hilfreich. Andere Theorien jedoch ins Kalkül zu ziehen, fiel mir erst recht nicht ein. Mein Verstand – damals hatte ich noch welchen – sträubte sich gegen jedwede utopische Argumentation, bevor sie sich in meinem Hirn manifestieren konnte. Stattdessen beschäftigte sich letzteres mit pragmatischeren Überlegungen: Ich musste aus den durchnässten Klamotten raus. Je eher desto besser. Bevor ich mir eine Lungenentzündung holte. Ich hatte zwar keine anderen, dafür aber eine alte Decke, in die ich mich wickelte, nachdem ich mich ausgezogen hatte.
Allmählich wurde mir warm. Der Gewitterguss war in einen leichten Landregen übergegangen, der einschläfernd wirkte. Ich fand mich gedanklich damit ab, hier die Nacht verbringen zu müssen. Wenn der Morgen graute, würde ich weitersehen. Es blieb mir ja eh nichts übrig …