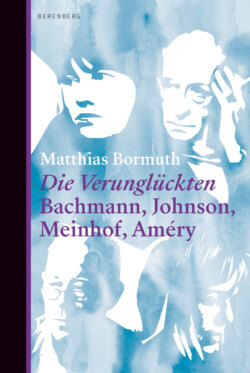Читать книгу Die Verunglückten - Matthias Bormuth - Страница 10
IV.
ОглавлениеDer Graben, der Ulrike Meinhof als spätere Terroristin von den drei Schriftstellern trennt, scheint kaum überbrückbar. Jedoch verstand es ein prominenter Vertreter des deutschen literarischen Lebens, der sowohl mit Ulrike Meinhof als auch mit Ingeborg Bachmann und Uwe Johnson vertraut war, Revolution und Literatur wortgewandt zu verbinden. Es ist der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger, der in der 1968er-Bewegung die sprachlich suggestive Verbindung zwischen dem politischen und ästhetischen Engagement bildete. In seinen späten Erinnerungen Tumult weist er ausdrücklich auf die »Traditionen des deutschen Idealismus« hin, die zu kennen zum Verständnis der Zeit nötig sei.
Enzensberger begründete 1965 mit dem Kursbuch im Suhrkamp Verlag das literarisch führende Periodikum der revolutionären Begeisterung. So hieß es 1968 in seinen Berliner Gemeinplätzen in provokativer Anspielung auf Marx und sein Kommunistisches Manifest: »Ein Gespenst geht um in Europa: das Gespenst der Revolution.« Die im Kursbuch abgedruckten Essays, Erzählungen, Studien und Gedichte wollten auch die beschämende Lehre der jüngsten Geschichte nutzen, um es besser als die Väter zu machen. Seine Verse, so etwa das Gedicht »an einen mann in der trambahn«, waren gegen das kollektive Vergessen gerichtet: »und ich sehe narben, / die du nicht siehst […] und ich sehe den mord in deinem aug, in der trambahn, mir gegenüber«. Der Vietnam-Krieg und die grausame Rolle der Amerikaner, die sich vom Befreier zum Unterdrücker gewandelt hatten, taten ein Übriges, um den Zorn Enzensbergers zu entfachen. Zuletzt war er auch am Kampf um gerechte Verhältnisse beteiligt, der 1968 die revolutionären Impulse bis in den eigenen Verlag trug. Als Siegfried Unseld in Frankfurt den »Aufstand der Lektoren« geschickt ausbremste, wechselte das Kursbuch zu Klaus Wagenbach nach West-Berlin, dem Zentrum der APO. Enzensberger war dort über seine geschiedene Ehefrau Dagrun und seinen Bruder Ulrich persönlich mit der legendären Kommune 1 verbunden und nahm an einer ihrer spektakulären Aktionen auf dem Kürfürstendamm teil.
In Tumult stellte sich Enzensberger selbstironisch der peinlichen Frage: »Und bei diesem Theater hast du mitgespielt?« Mit Witz versucht sein innerer Dialog Distanz zu den »ärgsten Blamagen« der revolutionären Jahre zu demonstrieren, zu denen auch der mehrmonatige Aufenthalt auf Kuba gehörte, der 1968 der medienwirksamen Aufkündigung eines großzügigen Stipendiums einer amerikanischen Universität folgte. In den Jahrestagen verewigte Uwe Johnson die zugehörige Notiz der New York Times: »Der deutsche Dichter Hans Magnus Enzensberger hat ein Stipendium an der Universität Wesleyan aufgegeben mit einem Trompetenstoß gegen die auswärtige Politik der Vereinigten Staaten und mit einem Heil für Cuba, wo er nach seinen Worten leben will.« Anerkennend kommentiert der späte Enzensberger: »Johnson war boshaft, aber nicht in allen Punkten hat er unrecht behalten. Das muß ich ihm lassen.«
Aber bei aller Nähe, die Hans Magnus Enzensberger vor allem in verbalen Aktionen zum revolutionären Aufbruch zeigte, gelang es ihm, als die Bewegungen der APO wieder verebbten, lebensklug in die Reserve zu gehen. Aus dieser Position beobachtete er teilnahmsvoll die Ursprungsszene der Roten Armee Fraktion. Tumult erscheint hierin als literarische Chronik des Unglücks, das die revolutionäre Emphase über Ulrike Meinhof brachte. In schillernden Wendungen gesteht Enzensberger, direkt nach der gewaltsamen Befreiung Andreas Baaders die Flüchtenden kurz beherbergt, aber die Einladung, am Sturz des »Systems« aktiv mitzuwirken, später unter konspirativen Umständen ausgeschlagen zu haben. Er schließt diese Passage: »Bis zu ihrem Selbstmord habe ich nie wieder von der bedauernswerten Ulrike Meinhof gehört.«
Der Historiker Wolfgang Kraushaar hat der 68er-Generation luzide das »Vexierbild« Enzensberger erschlossen und unterstrichen, dass Jürgen Habermas Enzensberger vor allem in der Rolle des »Harlekin« sah. Die »artistische Leichtigkeit«, mit der sich der Schriftsteller auf den verschiedenen Bühnen bewegte, ist ein Phänomen für sich. Tumult enthält das schwache Bekenntnis: »[E]inen Rest von Komplizentum konnte und kann ich nicht abstreifen. Jeder, der in das Durcheinander verwickelt war, haftet mehr oder weniger mit.«