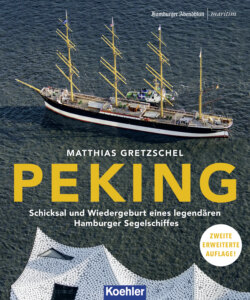Читать книгу PEKING - Matthias Gretzschel - Страница 11
4 GEGEN DEN TREND Warum Laeisz auch im Dampfschiffzeitalter auf Segel setzt
ОглавлениеIm Frühsommer 1816 ist Ferdinand Laeisz Buchbinderlehrling und hat noch nichts mit Schifffahrt zu tun. Da der damals 15-Jährige aber eigentlich gern zur See gefahren wäre, können wir wohl davon ausgehen, dass er sich die am 17. Juni zu erwartende Attraktion nicht entgehen lässt. Wahrscheinlich wird er sich irgendwo in der Menschenmenge, die die Hafenkante bevölkert, einen Platz gesucht haben. Tausende stehen dort, recken die Hälse und warten stundenlang, um einen Blick auf das Ungetüm zu erhaschen, das seit Tagen Stadtgespräch ist. Irgendwann geht ein Raunen durch die Menge, an der Flussbiegung wird eine Rauchfahne sichtbar, und bald darauf zeigt sich dieses merkwürdige Schiff, das zwar auch noch über Segel verfügt, aber – man glaubt es kaum – sich ganz ohne Windkraft elbaufwärts bewegt. Dafür zieht das neuartige britische Schiff THE LADY OF THE LAKE eine dicke schwarze Rauchfahne hinter sich her.
Der Reporter der „Hamburgischen Adreß-Comptoir-Nachrichten“ schreibt kurz darauf begeistert: „Mit dem Strom und dem Wind ist es nicht möglich, die Schnelligkeit dieses Schiffes mit einem anderen zu vergleichen, und dennoch kann es auf den ersten Wink auf der Stelle zum Stillstand gebracht werden.“ Aber viele Menschen sind auch skeptisch, befürchten Explosionen und Brände. Und die Elbschiffer haben Angst, dass ihnen bald eine neue Konkurrenz erwachsen könnte. Zunächst scheinen die Skeptiker recht zu behalten, denn der Fährdienst zwischen Hamburg, Cuxhaven und dem britischen Glasgow ist zwar schnell, aber auch teuer und deshalb unrentabel. Vor allem aus diesem Grund stellt der britische Reeder die Verbindung auch schon im Sommer 1817 wieder ein. Allerdings bekommen die Hamburger bereits ein Jahr später das nächste Dampfschiff zu sehen, es ist die Dampffähre, die passenderweise „de Smöker“ genannt wird und ab Juni 1818 Hamburg mit Harburg verbindet. Die Hafenverwaltung ist jedoch vorsichtig und verlegt aus Sorge um die stets feuergefährdeten Segelschiffe den Liegeplatz dieses und aller künftigen Dampfschiffe in sichere Entfernung vom Haupthafen elbabwärts vor die Schanze Jonas. Zwei 1837 installierte Pontons ermöglichen den Passagieren einen bequemeren Ein- und Ausstieg und den Schiffsführern ein weitgehend gefahrloses An- und Ablegen. Jahrzehnte später, nämlich von 1907 bis 1909, wird hier der repräsentative „Schiffsbahnhof“ der St. Pauli-Landungsbrücken erbaut werden.
Wurden Dampfschiffe zunächst vor allem auf Flüssen und im Seeverkehr über kürzere Distanzen eingesetzt, treten sie bald den Beweis an, dass sich auch Atlantiküberquerungen mit Dampfkraft durchführen lassen, allerdings zunächst noch nicht ausschließlich. Die ersten Dampfschiffe sind nämlich im Grunde genommen nur erweiterte Segler, in die man zusätzlich eine Maschine eingebaut hat, die zwei seitlich angebrachte Schaufelräder antreibt. Der Propeller, der umgangssprachlich als Schiffsschraube bezeichnet wird, setzt sich erst seit den 1840er-Jahren durch.
Die SAVANNAH überquerte den Atlantik 1819 in nur 27 Tagen und war damit etwa drei Tage schneller als ein leistungsfähiges Segelschiff.
Dank der zunächst nach wie vor verfügbaren Segel geht man auf „Nummer sicher“, kommt im Fall eines Maschinenschadens vom Fleck – und auch dann, wenn die letzte Kohle verfeuert ist. Der enorme Kohleverbrauch ist nämlich der Schwachpunkt der neuen Technik. Die Kohle kommt die Reeder nicht nur teuer zu stehen, sondern nimmt einen großen Teil jenes Platzes weg, der auf Segelschiffen für die Fracht zur Verfügung steht. Andererseits sind Dampfer eben nicht mehr vom Wind abhängig und können auch schneller fahren als die meisten Segler. Trotzdem sehen viele Reeder, die Frachter über den Atlantik schicken, Anfang des 19. Jahrhunderts die Zeit für das Dampfschiff noch nicht gekommen. Wenn sie die Zeitungen aufschlagen, in denen über die ersten sensationellen Atlantiküberquerungen von Dampfern berichtet wird, fühlen sie sich bestätigt. Zwar schafft die amerikanische SAVANNAH, ein nur 33,5 Meter langes, zum Dampfer umgebautes Segelschiff, im Frühjahr 1819 erstmals die Strecke über den Großen Teich in 27 Tagen und elf Stunden und braucht damit etwa drei Tage weniger als ein schnelles Segelschiff. Doch die SAVANNAH fährt nur an zwölf Tagen mit Dampfkraft, danach ist die Kohle verfeuert. Fracht hat sie so gut wie keine an Bord, und kein einziger Passagier hat sich auf die Fahrt mit dem „Dampfsarg“, wie die SAVANNAH in maßloser Übertreibung in der amerikanischen Presse tituliert wird, einlassen wollen. Doch die Technik wird ständig verbessert, und bald erweist sich der Dampferverkehr über den Atlantik gegenüber den Seglern als konkurrenzfähig – allerdings nur im Passagierbereich. Lediglich 18 Tage und 14 Stunden braucht die amerikanische SIRIUS im Frühjahr 1838 für die erste Atlantikpassage, die ausschließlich mit Dampfkraft bewältigt wird. Immerhin 94 Passagiere sind an Bord. Sogar drei Tage weniger benötigt die deutlich größere GREAT WESTERN, die noch am gleichen Tag überraschenderweise in New York eintrifft. Aufgrund einiger Missgeschicke im Vorfeld hat der Dampfer zwar nur sieben Passagiere an Bord, aber schon für die nächsten Fahrten sind die 128 Plätze meist ausgebucht. Hinzu kommen noch einmal 20 Betten im Vorschiff für die Diener, die ihren Herren im Bedarfsfall bei rauer See die Spucktüten reichen müssen. Mit der GREAT WESTERN setzt sich der Dampfer als schnelles Verkehrsmittel im Passagierverkehr über den Atlantik nach und nach durch. Beim Frachtverkehr sieht das noch anders aus.
Ferdinand Laeisz verfolgt diese Entwicklung mit großem Interesse. In seinen Erinnerungen schreibt er über die Situation zur Jahrhundertmitte: „Die Dampfschiff-Reederei vermochte in diesen Jahren überhaupt keine Seide zu spinnen, da sie wohl noch zu teuer arbeitete. Auch die erste deutsche Dampfschiff-Fahrt zwischen Hamburg und England, bei welcher ich mich beteiligt hatte, lieferte ein ungünstiges Resultat, und im Oktober 1858 kam die schreckliche Nachricht von dem Verbrennen unseres Packetfahrt-Dampfers AUSTRIA auf hoher See mit einem Verlust von mehreren Hundert Menschenleben, unter welchen ich besonders den wackeren Capt. Heidtmann, meinen Freund von der Krimreise, betrauerte.“
Laeisz ist kein Segelschiff-Traditionalist, sondern sieht die enormen technischen Errungenschaften und Möglichkeiten des 19. Jahrhunderts durchaus positiv. Wie stark er an den Innovationen der Industriellen Revolution interessiert ist, zeigt sich unter anderem daran, dass er die Weltausstellungen in London (1851), Paris (1855) und Wien (1873) besucht und begeistert darüber berichtet. Auf diesen großen internationalen Leistungsschauen wird die jeweils modernste Technik präsentiert und ein Fortschritt beschworen, der offenbar durch nichts zu bremsen ist.
Aber Laeisz ist bei aller Technikbegeisterung auch ein kühler Rechner, der alle Vor- und Nachteile gegeneinander aufwiegt. Und dabei kommt er zu dem Resultat, dass schnelle Segelschiffe beim Frachtverkehr von Massengütern viel profitabler sein können als die Dampfer jener Zeit, jedenfalls unter bestimmten Voraussetzungen. Auch das ist Resultat der Innovationen jener Zeit, die heute als Industrielle Revolution bezeichnet wird. Denn die enorm dynamische Entwicklung führt im Lauf des 19. Jahrhunderts nicht nur zur stetigen weiteren Verbesserung von Dampfschiffen, sondern verändert auch die Konstruktion und Konzeption von Segelschiffen, die zu dieser Zeit noch ein erhebliches Entwicklungspotenzial haben. Das betrifft zunächst das Material. Nachdem die Schiffsrümpfe seit Jahrtausenden aus Holz gefertigt worden sind, steht nun mit Eisen ein in diesem Bereich völlig neues Material zur Verfügung. Eisen kann zwar im Gegensatz zu Holz nicht schwimmen, doch ein aus vernieteten Eisenplatten hergestellter Schiffsrumpf ist widerstandsfähiger als einer aus Holz. Das beweist schon der erste aus Eisen hergestellte Großsegler, der passenderweise IRON SIDES heißt und 1838 von der Liverpooler Werft Jackson & Jordan gebaut wird.
Ferdinand Laeisz verfolgt die Entwicklung in Schiffbau, setzt allerdings zunächst weiterhin auf seine Holzschiffe, deren Konstruktion er immer weiter optimieren lässt, vor allem mit einem Ziel: Geschwindigkeit. Kaffee aus Costa Rica, Erze aus Mexiko und Chile sowie Guano aus Peru gehören zur Fracht, die die Laeisz-Schiffe in Südamerika an Bord nehmen. Doch bald wird etwas anderes zum Hauptgeschäftsfeld: die Salpeterfahrt.
Die Hinterlassenschaft einer Salpetermine in Chile. Die Arbeiter mussten hier oft unter menschenverachtenden Bedingungen schuften.
Die aus abgelagertem Vogelkot (Guano) bestehenden natürlichen Vorkommen von Salpeter, chemisch Natriumnitrat, werden in der Atacamawüste im heutigen Nordchile in großem Maßstab abgebaut und nach Europa verschifft. Allerdings sind die Arbeitsbedingungen für die dort Beschäftigten beispiellos schlecht. Die Minengesellschaften beuten die Arbeiter gnadenlos aus, Gesundheits- und Arbeitsschutz gibt es so gut wie gar nicht, die Bezahlung erfolgt zum Teil mit Gutscheinen, die nur in den firmeneigenen Läden eingelöst werden können. Die Nachfrage nach Salpeter ist riesig. Die Bedeutung des Rohstoffs, der vor allem für die Herstellung von Düngemittel und Sprengstoff genutzt wird, lässt sich beinahe mit der vergleichen, die das Öl im 20. Jahrhundert gewinnen wird. Kein Wunder, dass diese Ressource Begehrlichkeiten weckt und zu erheblichen Interessenskonflikten in Südamerika führt. So kommt es 1879 zum Salpeterkrieg, der zwischen Chile, Peru und Bolivien blutig ausgetragen wird. Als 1884 dann endlich die Waffen schweigen, erweist sich Chile als Gewinner. Im Vertrag von Valparaíso wird Chile die gesamte Region zugesprochen, in der man das „Weiße Gold“ abbaut. Und mit dem Abbau geht es jetzt erst richtig los, finanziert übrigens nicht nur mit US-amerikanischen Kapital, sondern auch in großem Umfang mit deutschen Investitionen. Der Transportbedarf von und nach Deutschland ist jedenfalls enorm, die Route allerdings extrem anspruchsvoll, denn sie führt von Europa aus über den Atlantik um das gefährliche Kap Hoorn an der Südspitze Amerikas zur Pazifikküste und dann nach Norden hinauf in die chilenischen Häfen Valparaíso, Iquique oder Antofagasta. Dass Laeisz im Jahr 1886 die Salpeterfahrt zum Hauptgeschäft seiner Reederei macht, ist ein geschickter Schachzug, denn auf den Ostasienrouten wären seine Segler seit der 1869 erfolgten Eröffnung des Suezkanals nicht mehr konkurrenzfähig. Durch den Kanal müssten die Windjammer geschleppt werden, und das Rote Meer wäre für sie aufgrund seiner zahlreichen tückischen Korallenriffe ein allzu gefährliches Revier. Auf der ungleich längeren traditionellen Route um das Kap der Guten Hoffnung würden die Großsegler hingegen hoffnungslos ins Hintertreffen geraten.
Ganz anders verhält es sich auf der Südamerikaroute, die die Segler von Laeisz mitunter sogar schneller, auf jeden Fall aber deutlich kostengünstiger als die konkurrierenden Dampfer zurücklegen.
Wie das konkret aussieht, belegen die folgenden Zahlen: Normalerweise braucht ein hölzerner Segler von Lizard Point, dem südlichsten Punkt Englands, bis nach Chile etwa 120 Tage, die 1873 gebaute PATAGONIA schafft es unter Kapitän Hellwege in nur 81 Tagen. Solche oder ähnlich schnelle Fahrten sind aber nur möglich, weil es sich bei den Laeisz-Schiffen um „bis ins letzte durchkonstruierte Ausgeburten kaufmännischen Zweckdenkens“ und „technische Präzisionsinstrumente ihrer Zeit“ handelt, wie der Hamburger Schifffahrtsexperte Hans Georg Prager es formuliert.
Die Bark PROFESSOR ist vier Jahre alt, als sie 1869 als erstes eisernes Schiff in die Laeisz-Flotte aufgenommen wird. Dass es sich lohnt, auf Eisen zu setzen, zeigt sich schon bald, denn die PROFESSOR schafft es in 81 Tagen vom Kanal nach Valparaíso – und ist damit genauso schnell wie die PATAGONIA auf ihrer Rekordfahrt. Auch die POLYNESIA, die 1884 als zweites Eisenschiff in Dienst gestellt wird, erfüllt die Erwartungen des Reeders, der mit der Bark PARNASS 1878 das letzte hölzerne Schiff erwirbt. Die PARNASS ist extrem schnell und schafft die Strecke vom Kanal nach Chile in nur 70 Tagen, doch die Eisenschiffe sind noch schneller. So schafft die PLUS 1886/87 die Strecke in nur 61 Tagen – allerdings unter besonders günstigen Rahmenbedingungen. Das Segelschiff „manövrierte wie eine Jacht und pflügte durch das Wasser wie ein Klipper. Aber so waren viele der Laeisz-Schiffe, große wie kleine“, schreibt der australische Seefahrer und Abenteurer Alan Villiers bewundernd über die PLUS, die das letzte Eisenschiff in der Flotte ist. Die POTRIMPOS, die 1887 bei Blohm & Voss gebaut wird, ist ungefähr genauso groß wie die PLUS, ihr Rumpf besteht aber nicht mehr aus Eisen, sondern aus Stahl. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist es dank neuer Technologien möglich geworden, immer hochwertigeren Stahl herzustellen, der allerdings zunächst ziemlich teuer ist. In einem 1881 erschienenen Fachartikel über die „Anwendung des Stahles im Schiffbau“ heißt es: „Bedeutend verringert werden die Kosten eines Stahlschiffes dadurch, dass dasselbe bei gleicher Größe und gleicher Festigkeit mit einem eisernen Rumpf wegen der höheren Bruchfestigkeit des Stahles um 18 bis 20 Prozent leichter erbaut werden kann, also ein geringeres Eigengewicht ergibt und daher bei gleichem Tiefgange eine größere Nutzlast zu tragen vermag, so dass schon hierdurch der Reeder binnen Kurzem die höheren Kosten gedeckt sehen würde. Vor allen Dingen aber gewährt ein Stahlschiff gegenüber einem eisernen eine viel höhere Sicherheit bei etwaigen Kollisionen oder Strandungen. Es sind Fälle vorgekommen, dass Stahlschiffe auf Felsen liefen, ohne anderen Schaden zu erleiden, als dass eine zuweilen allerdings bedeutende Verbiegung der Schiffshaut sowie der zunächst gelegenen Spanten und Bodenstücke stattfand, dass aber kein Leck entstand, selbst bei Stößen, welche ein eisernes Schiff unfehlbar zum Sinken gebracht haben würden. Die große Zähigkeit des Stahles ist es, welche ihn so überlegen dem Eisen macht und ihn als das beste und vorteilhafteste Schiffbaumaterial der Zukunft erscheinen lässt.“
Queen Victoria eröffnet die Londoner Weltausstellung von 1851. Auch Ferdinand Laeisz besuchte diese große Leistungsschau, auf der die modernsten Entwicklungen ihrer Zeit vorgestellt wurden.
Auch wenn das neue Material zunächst noch teuer ist, wiegen die Vorteile so schwer, dass Laeisz fortan nur noch Schiffe mit Stahlrumpf bauen lässt. Die neuen Stahlschiffe heißen zum Beispiel PROMPT, PAMELIA, POTSDAM und PALMYRA. Einerseits sind sie modern und fortschrittlich, andererseits aber traditionell, da es sich noch immer um Dreimaster handelt.
Doch längst denken Carl Heinrich und Carl Ferdinand Laeisz an einen neuen, größeren und schnelleren Schiffstyp, der nicht mehr nur drei, sondern vier Masten haben soll. Fünf Jahre nach Ferdinand Laeisz‘ Tod läuft 1892 bei Joh. C. Tecklenborg in Geestemünde die PLACILLA vom Stapel, die erste Viermastbark der Laeisz-Flotte, ein Schiffstyp, der Maßstäbe setzen wird. Verfügten die bisherigen Dreimaster nur auf Back (Vorschiff) und Poop (Hinterschiff) über erhöhte Aufbauten, so kommt nun in der Mitte des Schiffs noch ein sogenanntes Hochdeck dazu, das Brückendeck, auf dem sich das Kartenhaus und das Ruder oder sogar das Ruderhaus und damit die Kommandobrücke befinden. Früher befand sich das Ruder grundsätzlich auf der Poop, wo jetzt nur noch ein Notruder installiert wird. Als Drei-Insel-Typ bezeichnet man dieses Konstruktionsmuster, das enorme Vorteile hat. Zum einen sind Rudergänger und wachhabende Offiziere auf dem Hochdeck bei hohem Seegang besser geschützt, außerdem haben sie eine deutlich bessere Sicht. Zudem bietet der erhöhte Mittelaufbau, der sich bei schwerem Wetter zum Hauptdeck verschließen lässt, im Inneren Platz für verschiedene Unterkünfte und Arbeitsräume, etwa für den Schiffszimmermann, den Segelmacher und den Koch. Hans Georg Prager schreibt dazu: „Für die Mannschaft war das Hochdeck ein weitgehend sicheres Arbeitsdeck für vorzunehmende Segelmanöver. Später kam noch eine Verbesserung hinzu, die den ersten Laeisz-Viermastern noch gefehlt haben dürfte: Laufstege verbanden das Hochdeck mit Back und Poop, sodass Besatzungsmitglieder bei erforderlichen Wegen dorthin nicht mehr derart der See ausgesetzt waren wie früher. Das Hauptdeck oder Wetterdeck wurde ja bei schwerem Wetter vollständig überbrandet. Es füllte sich sogar mit ‚grüner See‘.“ Als grüne See werden überkommende Brecher bezeichnet.
Laeisz optimiert die Konstruktion seiner Segler immer weiter, gerät aber manchmal dabei auch an Grenzen. So experimentiert man mit Fünfmastern, was sich allerdings nicht auszahlen wird. Dabei sieht es am Anfang gut aus, als 1895 bei Joh. C. Tecklenborg in Geestemünde die erste Fünfmastbark vom Stapel läuft. Sie wird auf den Namen POTOSI getauft und ist das größte Segelschiff der Welt. Allerdings nur sieben Jahre lang, bis 1902 die auf derselben Werft erbaute PREUSSEN in Dienst gestellt wird, bei der es sich um ein Fünfmastvollschiff handelt. Beide Schiffe sind für die Salpeterfahrt konzipiert, erreichen auch Geschwindigkeitsrekorde, bleiben aber trotzdem die einzigen Fünfmaster in der Laeisz-Flotte, die auf der Südamerikaroute fast ausschließlich die bewährten Viermastbarken einsetzt. Diese verfügen alle über einen stählernen Rumpf und sind als Drei-Insel-Schiffe konzipiert. Seeleute in aller Welt nennen diese extrem schnellen Schiffe, deren Namen stets mit dem Buchstaben P beginnen, bewundernd Flying-P-Liner.
Nicht nur die Geschwindigkeit ist entscheidend, der Erfolg und die Attraktivität der Flying-P-Liner gründen sich auch auf deren technische Ausgereiftheit und – nicht zuletzt – auf die hohen Sicherheitsstandards. So sind auf vielen Flying-P-Linern die Wanten nicht mit Webeleinen (kurze, quer verlaufende Tauverbindungsstücke), sondern mit Holzsprossen als Tritte zum Aufentern ausgestattet, was die Gefahr von Unfällen reduziert. Dass es sich insgesamt um vergleichsweise sichere Schiffe handelt, lässt sich sogar statistisch belegen: Nach der Aufstellung der Klassifikationsgesellschaft Bureau Veritas gehen im Jahr 1908 drei Prozent aller Segelschiffe verloren, bei den Flying-P-Linern liegt der rechnerische Verlust pro Jahr dagegen bei nur 0,9 Prozent. Kein Wunder also, dass fähige Seeleute gern auf diesen Schiffen anheuern, zumal auch die Versorgung an Bord und die Bezahlung verhältnismäßig gut sind.
Auch an Land werden die Abläufe inzwischen besser organisiert, so sorgen Anfang des 20. Jahrhunderts in den chilenischen Salpeterhäfen eigene Agenten dafür, dass die Ladung sicher und schnell vonstattengeht. An der Gewinnung, also dem Abbau des Salpeters hat die Firma F. Laeisz sich allerdings nie beteiligt, sondern sie konzentriert sich ausschließlich auf den Transport.