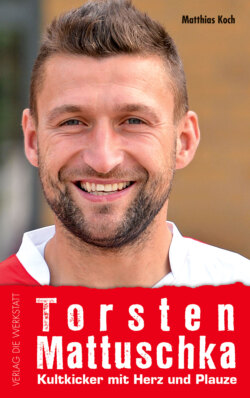Читать книгу Torsten Mattuschka - Matthias Koch - Страница 8
ОглавлениеKAPITEL 2
In Merzdorf fing alles an
1985 bis 1988
Sein Freund der Ball
Die Erziehung von Torsten Mattuschka fällt vermutlich nicht leicht. „Beim Mistbauen war ich immer weit vorne dabei. Ich habe Muttern einmal sogar Geld geklaut und damit meine Kumpels aus der Klasse auf den Rummel eingeladen. Da war ich vielleicht acht, neun Jahre alt. Mutter hatte immer Geld in einer Mon-Chéri-Büchse geparkt“, berichtet Mattuschka.
Mama Christa findet das gar nicht gut, zumal sie erst einmal nach dem familieninternen Täter fahnden musste. „Torsten und ich sollten so lange in unserem Zimmer sitzen, bis es einer zugegeben hat“, erzählt Schwester Katja. Torsten streitet erst einmal alles ab. Nachdem er dann doch mit der Sprache herausrückt, gibt es von der Mutter ein paar auf die Finger. Dabei will Torsten niemandem schaden. „Ich bin ein Typ, der gern einen ausgibt. Wir waren auf dem Rummel, sind Karussell gefahren und haben Lose gekauft“, erinnert er sich.
Den Quatsch, den er als Erwachsener immer noch macht, kann er damals nicht immer in halbwegs elegante Bahnen wie heute lenken. „Scheiße hat Torsten früher schon gebaut. Er war kein einfaches Kind. Es ging sehr viel kaputt bei ihm“, schaut Mama Mattuschka zurück. „Er hatte nur den Ball im Kopf. Häufig wurde bei uns geklingelt, weil Torsten an ein Auto geschossen hatte.“ Schwester Katja betont aber, dass ihr Bruder keinesfalls frech gewesen sei.
Am 29. August 1987 wird Torsten Mattuschka eingeschult. Bis zur sechsten Klasse besucht er die 30. Oberschule und spätere 11. Gesamtschule im Cottbuser Stadtteil Sachsendorf. Seine Liebe zum Fußball wird aber auf dem Dorf in Merzdorf gefördert. Dort ist er oft bei den Groß-eltern zu Besuch. Während seine Mutter häufig auch am Sonnabend arbeiten geht, um Torsten und seine Schwester Katja durchzukriegen, steuert Torsten Oma und Opa an. „Nach Merzdorf bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Das hat schon eine halbe Stunde gedauert“, berichtet Mattuschka. Es geht meistens freitags nach der Schule los und am Sonntagabend wieder nach Sachsendorf zurück.
Die Begeisterung für den Fußball ist schon vorhanden. Opa Heinz erkennt das Talent und lenkt es in die richtigen Bahnen, ein bisschen wohl auch aus Selbstschutz. „Ich war schon damals so fußballverrückt, dass ich sogar beim Mittagessen mit der Pille unterm Tisch jonglierte. Um nicht ihr komplettes Geschirr den Bach runtergehen zu sehen, haben Oma und Opa mich dann lieber 1985 bei der BSG Aufbau Merzdorf angemeldet. Da war ich fünf Jahre alt“, erzählt Mattuschka 2014 dem Magazin 11Freunde.
Der 1952 gegründete Verein hieß zu DDR-Zeiten zunächst BSG Traktor Merzdorf und wird nach der Wende in SV Rot-Weiss Merzdorf 1952 umbenannt. Heute gibt es dort einen großen Rasenplatz, eine weitere kleine Grünfläche zum Trainieren und ein schmuckes Funktionsgebäude. Damals wie heute trennt eine Straße eine Längsseite des Sportplatzes von anliegenden Einfamilienhäusern. Früher sorgten Pappeln für etwas Lärm- und Sichtschutz, aber sie mussten in den 2000er Jahren gefällt werden. „Ihre Wurzeln haben irgendwann die Straße angehoben. Sie wuchsen auch ins Feld rein. Der Platz war eine Katastrophe“, schaut Mattuschka-Kumpel Robert Zeitz zurück.
Spaß haben die Knirpse dennoch. Eine alte grüne Torwand mit weißen Löchern wird ohne Ende bearbeitet. Ab und an spielt und trainiert Mattuschka im Verein auch mit Älteren, weil er so viel Talent mitbringt. Sein erster Trainer ist Andreas Raack.
In Merzdorf findet Mattuschka Freunde fürs Leben. „Wir sind eine Truppe von zehn, zwölf Mann. Der richtig harte Kern besteht aus sechs oder sieben Leuten. Und das schon seit über 30 Jahren“, sagt Mattuschka stolz. Der Kontakt reißt auch in den neun Jahren, in denen Mattuschka beim 1. FC Union in Berlin spielt, nie ab. Daniel Dubrau wird Silvester 2011 sogar Mattuschkas Trauzeuge bei der Hochzeit mit Susanne. Robert Zeitz hat einen Partykeller in Merzdorf. Dort schaut die Merzdorf-Gang regelmäßig Fußball – bevorzugt Champions-League-Spiele von Bayern München. Da ist die Torschnaps-Garantie besonders hoch, munkelt man. Die eine oder andere Nacht soll Mattuschka im Hause Zeitz im Partykeller auf der Couch verbracht haben …
„Die Wurzeln gingen bis mitten auf den Sportplatz“
Interview mit Andreas Raack, Mattuschkas erstem Trainer
Andreas Raack stammt aus dem in den 1980er Jahren abgebaggerten Groß Lieskow und landete nach der Umsiedlung in Merzdorf. Beim heutigen Vorstandsmitglied des SV Rot-Weiss Merzdorf machte Mattuschka zwischen 1985 und 1988 seine ersten Schritte als organisierter Fußballer.
Herr Raack, Sie sollen der allererste Trainer von Torsten Mattuschka gewesen sein?
„Das ist so. Ich habe in Merzdorf früher immer die jüngsten Jahrgänge trainiert. Torsten hat mit knapp sechs Jahren bei mir angefangen. Mit sieben Jahren spielte er bereits in der Altersklasse, die heute der D-Jugend entspricht. Mindestens einen Jahrgang über seinem eigentlichen hat er aufgrund seiner Stärke immer mitgewirkt, bevor er 1988 zu Energie Cottbus gewechselt ist.“
Heute heißt der Verein SV Rot-Weiss Merzdorf. Und wie 1985?
„Da war es die BSG Aufb au Merzdorf. Als deren Trägerbetrieb fungierte das Kalksandsteinwerk in Dissenchen. Die haben uns so lange unterstützt, wie es das Werk gab. Uns wurde ein Lkw der Marke W50 mit einem Personenkoffer gestellt. Mit dem sind wir auch zu Auswärtsspielen gefahren. Wohl bis zu Beginn der 1970er Jahre hieß der Verein Traktor Merzdorf. Mit der Wende wurde es der SV Rot-Weiss, weil Rot als Farbe auf den Trikots irgendwie immer dazugehörte. 1990 war Merzdorf noch eine eigenständige Gemeinde. Von der haben wir die ganze Sportanlage in Eigentum übernommen – das Gebäude und den Platz.“
Dort sollen früher Pappeln an der Straße gestanden haben …
„Ja, die waren riesengroß. Ich glaube, 2004 oder 2005 wurden die zwölf Pappeln gefällt. Sie haben einen Haufen Ärger gemacht. Als Flachwurzler suchten sie sich das Wasser. Die Wurzeln gingen bis mitten auf den Sportplatz und haben auch die anliegende Straße zerstört.“
Die Rasenqualität war also nicht die beste, als Mattuschka hier in den 1980er und 1990er Jahren spielte?
„Der Platz war uneben. Durch das nahe Tagebaugebiet wurde mit der Absenkung des Grundwassers auch die Erde bewegt. Die unebene Rasenfläche ist ein anerkannter Bergbauschaden.“
Wie sah es ungefähr aus, als der kleine Mattuschka mit dem Kicken bei Aufb au Merzdorf anfing?
„Es gab ein Rasengroßfeld und hinter einem Tor eine Schmirgelscheibe zum Trainieren. Dort gab es mehr Sand als alles andere.“
Welche Erinnerungen haben Sie an die Anfangszeit?
„Torsten war ein sehr aufgeweckter Junge und zu allem Blödsinn bereit. Aber wenn man ihm einen Ball hingeschmissen hat, war es mit dem Quatschmachen vorbei. Dann zählte nur noch die Pille.“
Wie bewerten Sie es, dass er es trotz etlicher Höhen und Tiefen in seiner Karriere bis in den Profifußball geschafft hat?
„Das kam für mich schon sehr überraschend, dass er das bei Energie unter Eduard Geyer hinbekommen hat. In Dissenchen spielte er in der 7. Liga und traute sich dann noch mal den Sprung zu. Wäre er einige Jahre früher zu Verstand gekommen, hätte er es vielleicht noch weiter gebracht.“
Zwischenzeitlich spielte Mattuschka in der B- und A-Jugend noch mal zwei Jahre für Merzdorf. Wurde ihm der Wechsel zum Lokalrivalen nach Dissenchen übel genommen?
„Ein bisschen schon. Torsten hat in Dissenchen eine Malerlehre absolviert. Wir haben ihm in Merzdorf auch eine angeboten. Aber der Opa von Torsten hat sich dann für die Ausbildung in Dissenchen bei der Firma Laschke stark gemacht. Das war traurig für Merzdorf. Aber von uns aus hätte er den späteren Sprung zurück zu Energie nicht geschafft.“
Stimmt es, dass Sie mit Torsten mehr oder weniger verwandt sind?
„Nicht wirklich. Ich bin quasi angeheiratet. Seine Mutter Christa und meine Frau Silvia sind Cousinen. Meine Schwiegermutter Elsbeth und Torstens Opa Heinz waren Geschwister. Der Opa hat in Merzdorf gewohnt, wo sich Torsten oft nach der Schule und am Wochenende aufgehalten hat. Mutter Christa hat ihn dann nach dem Training abgeholt.“
Wie wurden die Auswärtsspiele bewältigt?
„Alles mit Autos und mit Hilfe der Eltern. Die Kinder, die aus Cottbus kamen, wurden teilweise abgeholt und wieder nach Hause gebracht.“
Sind Sie noch im Verein aktiv?
„Ja, im Vorstand. Ich kümmere mich hauptsächlich um die Anlage und die Gebäude.“
Einige Anwohner sollen nicht so sehr über die aktive Ultra-Szene des SV Rot-Weiss erfreut sein?
„Na ja, bei Heimspielen ist es schon ganz schön laut. Aber der Sportplatz war vor den Häusern da.“
Sind Sie stolz darauf, dass einer wie Mattuschka in Merzdorf angefangen hat?
„Sicher. Und als er Dissenchen wieder verlassen hatte, wurde auch nicht mehr negativ über ihn gesprochen. Man darf nicht vergessen: Er zog ja noch andere Jungs aus unserem Verein nach Dissenchen nach, beispielsweise seinen späteren Trauzeugen Daniel Dubrau. Aber viele ehemalige Merzdorfer sind zurückgekehrt und spielen inzwischen bei den Alten Herren. Einige haben auch ein paar Jungs produziert, sie sind Väter geworden. Wir haben derzeit eine F- und eine Bambini-Mannschaft.“
Aktuell spielen Merzdorf und Dissenchen bei den Männern nach 37 Jahren wieder in einer Liga. Wie groß ist die Feindschaft noch?
„Die Spieler untereinander verstehen sich. Die Sprüche vom verbotenen Dorf Dissenchen fallen aber immer noch. Die sind die Süd-Molukken, und wir sind die Nord-Molukken.“
Hat Merzdorf eigentlich mal eine Ausbildungsentschädigung für Mattuschka erhalten?
„Nein, wir haben darauf verzichtet. Das könnte auch daran liegen, dass der Wechsel von Merzdorf zu Energie nicht ganz sauber verlief. 1988 hat Energie einfach einen neuen Spielerpass für Torsten ausgestellt, obwohl er bei uns schon einen hatte. Uns hat damals aber keiner gefragt.“
(K)ein guter Esser
Torsten Mattuschka fehlt es in seiner Jugend finanziell an nichts. Die alleinerziehende Mutter hat keine Probleme, die Kinder durchzubringen. „Mama hat alles dafür getan, dass wir gute Klamotten haben“, weiß Mattuschka zu berichten.
Christa Mattuschka bringt von ihrem Job im Fleischerei-Fachgeschäft auch gern etwas mit zum Futtern nach Hause. Dass Torsten später nicht zu den Grazien unter den Profifußballern Deutschlands gehören wird, nimmt sie ein bisschen auf ihre Kappe. „Es liegt wahrscheinlich auch an mir, dass Torsten ein guter Esser geworden ist. Weil ich meine Kinder gut versorgt habe. Wir hatten zu DDR-Zeiten alles. Ich habe selbst gern gegessen. Häufig gab es Schnitzel oder Bratwurst“, erzählt Christa Mattuschka. Ihre Freundin hatte zudem in Sachsendorf einen Imbissstand.
Häufig bittet der heranwachsende Torsten die Mutter um Geld – für Pommes. Auf dem Markt ist Torsten Stammkunde. Mutter Christa berichtet, dass sie auch gern mit den Kindern zu McDonald’s gefahren sei. Das tut Mattuschka heute noch. Der Autor dieses Buches hat es auch schon erlebt, dass der im Auto sitzende Mattuschka ein Telefonat kurz unterbricht, um mal eben am Drive-in-Schalter eines Schellrestaurants eine Bestellung aufzugeben.
Überraschend ist jedoch die Aussage Mattuschkas, dass er schon immer ein Mäkelfritze gewesen sei. „Ich sehe zwar so aus, als ob ich alles fresse, aber es ist nicht so. Ich mag keine Leberwurst und keine Bock-wurst. Auch Ananas kann ich nicht mehr sehen, seitdem mir einmal davon richtig schlecht geworden ist“, berichtet Mattuschka. „Wenn ich mich vom Essen übergeben muss, bekomme ich das nie mehr herunter. Das ist anders als beim Saufen.“
Von wegen „Tusche“
Für Tausende Fans ist heute klar: Der Spitzname von Torsten Mattuschka lautet „Tusche“, und dieser hat sich vor allem in seiner Zeit beim 1. FC Union herauskristallisiert. Seit wann der beliebte Fußballer so gerufen wird, ist aber nicht belegt. Früher war es auch üblich, dass er als „Tuschkasten“ verunglimpft wurde. Mattuschka glaubt, dass es den „Tusche“ oder „Tuschi“ auch schon in seiner ersten Phase bei Energie Cottbus gab – selbst wenn dieser Spitzname damals längst nicht so häufig wie heute benutzt wurde.
Mattuschka stellt aber auch klar, dass er in Merzdorf schon immer der „Higgins“ gewesen sei. Woher dieser Spitzname stammt, weiß er nicht genau. Eine Vermutung ist, dass dieser auf der US-amerikanischen TVSerie Magnum beruht, die zwischen 1984 und 1991 zunächst im ARDFernsehen ausgestrahlt wurde. Der von Tom Selleck gespielte Privatdetektiv Magnum gerät darin immer wieder mit dem Grundstücksverwalter Jonathan Quayle Higgins in Konflikt, den Schauspieler John Hillerman mimte. „Da war ich fünf oder sechs Jahre alt. Da wurde ich in Feuerwehrkleidung gesteckt. Die Stiefel waren viel zu groß. Da hat irgendjemand gesagt, der sieht aus wie Higgins“, beschreibt Mattuschka die Entstehung seines ersten Spitznamens.
Seine Schwester Katja pflichtet dem bei. In Merzdorf wisse jeder, wer mit „Higgins“ gemeint sei. Sie selbst schreibe ihn bei WhatsApp immer mit „Mein Kleiner“ an. Mutter Christa nennt ihren Sohn ebenfalls den „Kleinen“ oder schlichtweg „Torsten“. Bei Frau Susanne ist er der „Schatzi“.
Im Merzdorf-Clan wird heute noch über die Schreibweise des Urspitznamens von Mattuschka gerätselt. Robert Zeitz geht von der Schreibweise „Hegens“ aus. Daniel Dubrau widerspricht. „Ich sagte immer Higgins zu ihm. Ich wusste anfangs gar nicht, dass er anders hieß.“ Fest steht nur, dass er in Merzdorf nicht der „Tusche“ ist. „Das ist erst bei Union entstanden. Für uns ist und war er immer der Higgins. So hieß er von klein an“, meint sein erster Merzdorfer Trainer Andreas Raack.