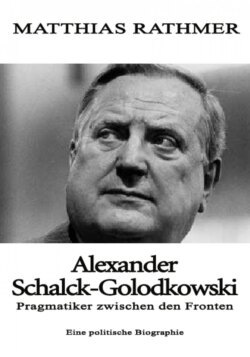Читать книгу Alexander Schalck-Golodkowski - Matthias Rathmer - Страница 11
Herausforderung Außenhandel
ОглавлениеDie wirtschaftlichen Voraussetzungen beider deutscher Staaten, unter denen Schalcks Aufstieg begann, hätten ungleicher kaum seien können. Währen in der Bundesrepublik das sog. „Wirtschaftswunder" seinen Lauf nahm, litt die DDR unter den extremen Reparationsforderungen der UdSSR Nach den Unterlagen des sowjetischen Amtes für Reparationen und nach Berechnungen westlicher Wirtschaftsexperten beliefen sich die Verluste für die östliche Volkswirtschaft bis zum Ende der Zahlungen 1953 auf die gewaltige Summe von über 70 Milliarden DM. 36 Die UdSSR beutete die DDR hemmungslos aus. Allein in Berlin wurden 460 Industriebetriebe demontiert, Brikettfabriken und Kraftwerke gingen komplett in die Ukraine. Alle Konten wurden gesperrt, sechs Milliarden Reichsbanknoten beschlagnahmt. Das zweite Eisenbahngleis wurde von den Schwellen gerissen, das Inventar der Zeiss-Werke komplett abtransportiert. Dann ließen sich die sowjetischen Machthaber noch ihre Besatzung bezahlen: jährlich neun Milliarden DM-Mark, die die DDR mit einem enormen Warenstrom zu quittieren hatte. „Raubt, so viel Ihr könnt", hatte Stalin aufgefordert. 37 Und: die Infrastruktur samt Logistik, für ein gesundes Wirtschaftswachstum unerlässliche Faktoren, waren durch den Krieg fast völlig zerstört.
Der ostdeutsche Nachbarstaat ordnete sich allein dem wirtschaftspolitischen Willen seines Besatzers unter. Die sozialistische Planwirtschaft war von Moskau als nationales Credo verordnet worden, ausschließlich die Sowjetische Militäradministration (SMAD) entschied bis zur Staatsgründung 1949 über die Binnen- und Außenwirtschaft. Mit dem „Sequesterbefehl" 1946 wurden die wichtigsten und effektivsten Betriebe beschlagnahmt und zu „sowjetischen Aktiengesellschaften" umgewandelt. Die Bodenreform enteignete alle Privatbesitzer von mehr als 100 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche entschädigungslos von Grund und Boden. 38 So waren die Startbedingungen für einen internationalen Handel in der DDR wesentlich ungünstiger als in der BRD, obwohl die Wirtschaftsstruktur einiger Regionen wie z.B. Sachsen und Thüringen seit langer Zeit einen traditionell hohen Industriestandard aufwiesen. 39
Als 1949 schließlich die DDR gegründet wurde und die zentrale Planwirtschaft in die Verfassung verankert wurde, war auch der Außenhandel der DDR zum staatlichen Monopol geworden. Der erste Außenhandelsminister, Heinrich Rau, begründete mit bekannt leeren Worthülsen führender SED-Funktionäre, warum dieses Prinzip in die Staats- und Wirtschaftsordnung der DDR aufgenommen wurde: „Das Vorhandensein des staatlichen Außenhandelsmonopols ist für jeden sozialistischen Staat eine politische und ökonomische Notwendigkeit, die sich daraus ergibt, dass alle außenwirtschaftlichen Operationen unseres (...) Staates (...) den Interessen, der Festigung und Stärkung unserer Arbeiter- und Bauernmacht dienen müssen. Nur auf der Grundlage des staatlichen Außenhandelsmonopols können die außenwirtschaftlichen Beziehungen entsprechend den Erfordernissen unseres Staates geplant, gelenkt, kontrolliert und mit dem höchsten volkswirtschaftlichen Nutzeffekt geleitet und durchgeführt werden." 40
Die ordnungspolitischen Institutionen zur Durchsetzung dieser monopolistischen Ansprüche waren rasch installiert: das „Ministerium für Außenhandel und innerdeutschen Handel (MAI)" wurde 1949 gegründet, 1967 in „Ministerium für Außenwirtschaft" umbenannt, um dann 1973 wieder „Ministerium für Außenhandel" zu heißen. Als handelspolitische Instrumente des Ministeriums wurden im ganzen Land sog. „Außenhandelsbetriebe" (AHB) gegründet, die ihren Hauptsitz in Ost-Berlin hatten. 41 Alle Produktionsmittel waren „gesamtgesellschaftliches Volkseigentum", das von der staatlichen Plankommission (SPK) kontrolliert wurde.
Zusammen mit dem Ministerium für Außenhandel und innerdeutschen Handel gab die SPK den Außenhandelsbetrieben Zielprogramme vor, deren verlässliche Erfüllung Voraussetzung für weitere Aufträge war. In den 60er Jahren erfuhr das Wirtschaftssystem zwar einige Veränderungen, doch an den strukturell bedingten ökonomischen Defiziten sozialistischer Planwirtschaften änderte sich, wie zu sehen sein wird, wenig. 42 So wurde z.B. der Außenhandel 1963 durch die Reform des „Neuen Ökonomischen Systems (NÖS)" grundlegend neubewertet. 43 Bis dahin kamen den Importen die bloße Funktion zu, nur das einzuführen, was die eigenen Betriebe nicht herstellen konnten. Die Exporte hatten die Aufgabe, diese Importe zu finanzieren. So war der Außenhandel streng von der Binnenwirtschaft getrennt. Der Handel wurde ausschließlich durch das MAI abgewickelt, das die Waren durch die AHB auf den Märkten ein- oder verkaufte. In- und ausländische Preisrelationen aber wichen z.T. so erheblich voneinander ab, dass die entstandenen Verluste aus dem Staatshaushalt getragen werden mussten. Mit dem NÖS, im DDR-Jargon als „wissenschaftlich-technische Revolution" ausgerufen, übernahmen die Kombinate und VEB selbständig den Import und Export ihrer Waren. Dazu wurden Kommissionsverträge zwischen dem zuständigen AHB und den Produktionsbetrieben abgeschlossen. Der AHB verkaufte zwar immer noch die Waren, aber auf Rechnung der Betriebe. Die neuen Handels- und Organisationsformen wurden im Laufe der Jahre in verschiedene Wirtschaftsbereiche eingeführt. Einige exportstarke Betriebe waren dadurch sogar in der Lage, ihre Waren ohne Mitwirkung der AHB auf den Weltmärkten zu veräußern, so z.B. die WB Schiffbau, das Uhrenkombinat Ruhla, das Kombinat Carl Zeiss Jena, Robotron und das Strumpfkombinat ESDA in Thalheim. 44
Der Außenhandel war seit drei Jahren staatliches Monopol, als der 20jährige Schalck von Hans Fruck im Sommer 1952 in den Außenhandelsbetrieb „Elektrotechnik" delegiert wurde. Der Betrieb hatte darüber zu entscheiden, wie viele Radiogeräte in den Wirtschaftsraum des RGW exportiert werden sollten. Generaldirektor dieses Betriebes war Fritz Koch, einer der zuverlässigsten Agenten Frucks. Glaubt man den Aussagen ehemaliger Mitarbeiter im MAI, so wurde der 1910 in Dresden geborene Koch von Fruck erpresst. Koch hatte demnach seine Mitgliedschaft in der NSDAP verschwiegen, in die er 1940 eingetreten war. 43 Schalck sollte von Koch lernen. Fruck aber wollte vor allem wissen, ob sein Lehrling auf Dauer den westlichen Einflüssen würde widerstehen können. können. Der Ost-West-Konflikt verschärfte sich in dieser Phase zunehmend. Frucks Agentenringe spionierten im Westen, gegnerische Geheimdienste infiltrierten die eigenen Ministerien. Im Oktober enttarnte das Fruck-Team den Abteilungsleiter „Export" im Außenhandelsministerium, Franz Krause, als Agent des britischen Geheimdienstes. Das hochsensible, weil technische Standards offenbarende Ressort musste neu besetzt werden, und Fruck bestimmte Koch, auf dessen Immunität dem Klassenfeind gegenüber er sich verlassen konnte. Fruck verfügte ebenso, dem jungen Schalck eine Aufgabe im Außenhandelsministerium anzuvertrauen.
Die Hauptabteilung „Export" wickelte den Maschinenbau ab. Schalck erkannte rasch, dass der Handel vornehmlich ein logistisches Problem war und sehr viel Zeit in Anspruch nahm. Der bürokratische Aufwand war enorm, denn Preisverhandlungen, Kalkulationen, Lieferspezifikationen und Planzahlen mussten über die hauseigene „Abteilung B" stets verschlüsselt und in versiegelten Umschlägen übermittelt werden. Die Benutzung eines Telefons war grundsätzlich verboten. Ähnlich hinderlich waren die Bedingungen in der „Abteilung Geschäftsreisen". Auf vier Karteikarten hatte der Antragsteller aufzulisten, mit wem, wo und warum er geschäftlich kontaktierte. Eine Ausfertigung blieb im Ministerium, je eine erhielten das Außen- und Innenministerium. Die vierte schließlich gelangte dorthin, wo auch entschieden wurde, ob der Antragsteller berechtigt ist, ins feindliche Ausland zu reisen: sie wurde im Ministerium für Staatssicherheit archiviert. Gelehrig ordnete sich Schalck diesen Bedingungen unter. Er fertigte Dossiers über Mitarbeiter seiner Abteilung an, informierte Fruck detailliert über alles, was er sah und hörte. Von Fruck gefördert, avancierte Schalck so in den Reisekader. Er sollte für die Volkswirtschaft Umsätze erzielen und Kontakte knüpfen, die sich zur Spionage eignen könnten.
Auf der Internationalen Messe vom 30. März bis 8. April 1954 in Utrecht vertrat Schalck zum ersten Mal in offizieller Mission den Außenhandel der DDR. Er kam mit namhaften Beauftragten und Managern der niederländischen Wirtschaft zusammen, u.a. mit der Amsterdamer Handelscentrale, mit der Firma Nehandor aus Sassenheim und dem Chef der Prodag in Den Haag. Es sollten die ersten Unternehmen sein, die später in anderen Gesellschafterformen als SED-Briefkastenfirmen die Anteile einiger KoKo-Firmen im westlichen Ausland hielten. Schalck war begeistert, er genoss seine neue Aufgabe. Ihn faszinierte der Umgang mit den ideologischen Gegnern der DDR Fern ab von der Tristes in seinem Ministerium offenbarte sich in ihm durch die ungezwungene Atmosphäre auch eine lebenslustige Seite. Es wurde fein gegessen, man hob die Gläser zu kameradschaftlichen Trinksprüchen und gab sich gewandt. Schalck besaß fortan eine wichtige Funktion. Als einer von wenigen Protagonisten vertrat er die DDR im Handel mit westlichen Industrieländern. Es beginnt damit die Zeit, in der Schalck auch intensiv politisch zu denken bemüht ist. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er fast ausschließlich die eigenen volkswirtschaftlichen Engpässe vor Augen.
Fruck, der Schalcks Berichte las, seinen Schützling aber auch mehrfach privat aufsuchte, um sich berichten zu lassen, registrierte mit größter Genugtuung, dass Schalck die Gegensätze zwischen der ärmlichen DDR und dem protzenden Westen annahm. Genau dieser Kontrast zog Schalck an, berauschte ihn nahezu in seinen Berichten. Er hielt eine Symbiose aus den guten Errungenschaften seiner Partei mit den materialistischen Prinzipen des Westens für möglich. Fruck missfiel diese von vielen SED-Ideologen als „Diversion" ausgelegte Wertung keinesfalls. Im behagte, dass Schalck politisch überzeugt war, ihn erfreute, dass Schalck scheinbar bis zur Selbstaufgabe die Interessen der DDR vertrat, ihm gefiel, dass Schalck präzise Gesprächsnotizen über seine westlichen Bekanntschaften ablieferte und dabei den allergrößten Wert auf scheinbare Nebensächlichkeiten legte: Anzahl der Kinder, Name der Ehefrau, beruflicher Werdegang usw. 46 Durch dieses nachrichtendienstliche Potential empfahl sich der junge Schalck. Nur fünf Wochen nach seiner ersten Auslandsreise vertrat er die Interessen seines Landes erneut, auf der Pariser Messe, vom 22. bis zum 29. Mai 1954.
Frankreich hatte schon früh eine nicht ganz uneigennützige Affinität zur DDR entwickelt, denn der neuen Bundesrepublik misstrauten die Franzosen, noch. Das französische Interesse am sozialistischen Deutschland bezog sich vor allem die Handelsbeziehungen. Der westdeutsche Nachbar exportierte Obst, Kaffee, Kakao, Wein, Wolle, Edelhölzer und Walzwerkzeuge. Ost-Berlin lieferte Pressglas, Bleikristall und Molkereiausrüstungen. 1954 erreichte der Handel zwischen beiden Nationen einen stattlichen Umfang von über 8 Milliarden US-Dollar. 47 Die Banque Commercial pour L'Europe, in den DDR-Fachkreisen bereits damals schon ehrfurchtsvoll „unsere Eurobank" genannt, war als einziges Finanzhaus in Europa Vertragspartner der Deutschen Notenbank der DDR. Schalck fand also für seinen Frankreichbesuch die günstigsten Voraussetzungen. Wieder informierte er präzise und penibel über seine Unterredungen mit französischen Geschäftspartnern. Einige der damaligen Gesprächspartner Schalcks erinnern sich heute daran, dass Schalck im Gegensatz zu seinen mitgereisten Genossen sein neues Feld unkonventionell und gelöst betrat. Spontaneität und Flexibilität machten ihn zu einem beliebten und verlässlichen Unterhändler. 48
„In der Deutschen Demokratischen Republik, dem ersten Arbeiter- und Bauernstaat in Deutschland, werden auf allen Gebieten unseres friedlichen Aufbaus entscheidende Erfolge errungen. Im Kampf um die Verwirklichung des neuen Kurses hat der Staatsapparat ständig größere Aufgaben zu erfüllen. Die richtige Kaderpolitik ist ein wichtiger Schlüssel dieser Aufgabe." 49 Schalcks Qualitäten entsprachen dieser von Walter Ulbricht verordneten Rekrutierung der Führungselite. Folgerichtig sollte Schalck SED-Mitglied werden. Das aber war nicht so einfach. Niemand konnte so einfach in diese Partei eintreten. Der Antragsteller wurde zuerst „Kandidat". Das aber auch nur, wenn ein SED-Mitglied als Bürge für den Anwärter auftrat. Ausnahmen waren nur dann möglich, wenn der Bewerber Produktionsarbeiter war oder sich am Widerstand gegen die Nationalsozialisten aktiv beteiligt hatte. Bis zu zwei Jahre mussten die Aspiranten in den 50er Jahren warten, um in die Partei aufgenommen zu werden. Bei Schalck dauerte es nicht einmal sechs Monate, Koch, also wesentlich Hans Fruck, der jedoch aufgrund seiner Position nicht in Erscheinung treten durfte, bürgten für ihn. 1955 wurde Schalck Mitglied der SED.
Die noch junge DDR steckte in einer schweren Krise, als Schalck Stärke, Zuverlässigkeit und das rechte Klassenbewusstsein zeigte. Der Tod Stalins am 5. März 1953 schockte die Staats- und Parteiführung, denn die neuen Machthaber im Kreml forderten eine Kurskorrektur. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wuchs. Unterdrückung, Repressalien und perspektivlose Lebenslage: die Menschen hatten genug vom „verschärften Klassenkampf zum Aufbau des Sozialismus". Allein 1953 flüchteten über 300.000 von ihnen in die Bundesrepublik, bis zum Ende Jahres 1955 waren es sogar über eine dreiviertel Million DDR-Bürger. In erster Linie gingen diejenigen, die die DDR-Führung besonders umwarb: Jugendliche, Arbeiter und Bauern. Unter sowjetischen Druck beschloss das Politbüro einen „Neuen Kurs". 50 Der sah im Kern eine bessere Versorgung mit Konsumgütern vor. Gegenüber der Arbeiterschaft aber blieb die SED hart. Der Protest gegen die im Mai 1953 drastisch erhöhten Arbeitsnormen gipfelte in den Aufstand vom 17. Juni, den die DDR-Regierung und sowjetische Truppen blutig niederschlugen. Die Menschen in der Ost-Republik mussten die bittere Erfahrung machen, dass der Versuch einer gewaltsamen Veränderung des politischen Systems keinerlei Aussicht auf Erfolg hatte, solange die Sowjetunion das bestehende Regime stützte. Gänzlich folgenlos blieb der Aufstand dennoch nicht, so wurde die Produktion in der Schwerindustrie zugunsten der Erzeugung von Konsumgütern und Lebensmitteln gedrosselt. Die Preise wurden gesenkt, und die UdSSR-Regierung erklärte sich bereit, ab 1954 auf alle Reparationen zu verzichten. Die Besatzungskosten wurden auf 5% des Staatshaushaltes begrenzt, SAG-Betriebe der DDR als Staatsbetriebe übereignet.
Parteiintern folgte eine umfassende „Säuberung". Die DDR-Bürger, die ihre persönlichen Perspektiven eher mit dem westdeutschen Wirtschaftswachstum verbanden und in die BRD übersiedelten, waren aus allen Bereichen gekommen: aus der Polizei, dem Staatsapparat, den kommunalen Behörden. Selbst die Staatssicherheit verlor vertraute Mitarbeiter, die natürlich westdeutschen Institutionen und auch Geheimdiensten berichteten. Sie legten Personen und Strukturen offen. Ulbricht, gestärkt durch die neuerliche Unterstützung aus dem Kreml, setzte auf diese neue Kaderpolitik, und da kam Schalck gerade recht. Nur die zuverlässigsten Mitglieder der SED erhielten die Möglichkeit, höhere Aufgaben zu übernehmen. Das MfS wurde zur Auswahl und Überprüfung dieser Kandidaten immer intensiver eingebunden. Schalck, ein Kind der so gefürchteten Staatssicherheit, erfüllte diese Kriterien des „Neuen Kurses".
Der Aufstand war erfolgreich überstanden, als im MAI einer neuer FDJ- Sekretär gesucht wurde. „Die Mitgliederversammlung der FDJ-Grundeinheit wählte mich am 3. Juli zum 1. Sekretär. Besonders durch diese Funktion konnte ich mir durch die starke Unterstützung der Genossen der Zentralen Parteileitung und der leitenden Mitarbeiter im MAI ein umfangreiches politisches und fachliches Wissen aneignen." 51 Es war der 21. Geburtstag Schalcks, an dem er als neuer FDJ-Sekretär in die Nomenklatura aufstieg.
Mit dem Aufstand vom 17. Juni 1953 verhärteten sich die Fronten zwischen beiden deutschen Staaten weiter. Die Regierung um Bundeskanzler Adenauer hatte nach ihrem triumphalen Wahlsieg im gleichen Jahr jegliche Kontakte zur DDR-Regierung abgelehnt, wie schon in den Jahren zuvor und auch im späteren Verlauf. Gegen die KPD war schon im November 1951 ein Verbotsverfahren eingeleitet worden. Die mündlichen Verhandlungen dazu begannen im November 1954, im August 1956 erfolgte schließlich das Verbot der Partei. In der DDR selbst ging der Strukturwandel weiter. Bei den Wahlen für die Volkskammer und die Bezirkstage im Oktober 1954 ergab sich ein fast schon gewohntes Bild: 99,45% Ja-Stimmen für die Einheitsliste. Ein Jahr später endete der erste Fünfjahresplan, der mit 105% erfüllt wurde. Unter schwierigen Umständen und nur mit erheblichen Anstrengungen verfügte das Land jetzt über eine schwerindustrielle Grundlage. 52 Zehn Jahre nach Kriegsende hatte die SED ihre Herrschaft dank der sowjetischen Unterstützung festigen können, ohne jedoch von der Bevölkerung akzeptiert zu werden. In einer krisenhaften Gesellschaft fehlte die allgemeine Zustimmung für die z.T. gewaltigen sozialen Umschichtungen. Breite Teile der Bevölkerung blickten voller Neid auf den wirtschaftlich weitaus erfolgreicheren Nachbarn.
Schalck störte das nicht, er war eingebunden. Unter Heinrich Rau war er Ende 1953 ins Ministerbüro des Ministeriums für Außenhandel und Innerdeutschen Handel vorgedrungen. Dort entwickelte er einen enormen Arbeitseifer. Nicht selten verließ er das Büro erst gegen Mitternacht, arbeitete häufiger auch am Wochenende. Von seinen Mitarbeitern forderte er ungeniert, gleichen Einsatz zu entwickeln. Freizeit gab es für Schalck nur selten. Im Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel arbeiteten etwa 300 Personen, und alle Abteilungen hatten reichlich zu tun. Als Anfang 1954 die Reparationen ausliefen und die beschlagnahmten Betriebe rück übereignet wurden, gab es plötzlich in der neu gewonnenen Selbständigkeit keine Abnehmer für die hergestellten Waren und Güter mehr. Zwar wickelte die DDR den Großteil des Außenhandels mit den Ländern des Comecons ab, doch Handelsstruktur- und Niveau waren von Beginn an unangemessen, zu Lasten der DDR-Volkswirtschaft. Die Sowjetunion fiel für einen intensiven Handel erst einmal aus, sie hatte sich bereits reichlich bedient. In den sozialistischen Bruderstaaten fehlten entweder die Valuta oder die Kompensationsbereitschaft, so dass der DDR schon frühzeitig nur ein Abnehmer blieb: der Klassenfeind im Westen.
Noch aber war Schalck kein diplomierter Ökonom. Der Schulabschluss der Neunten Klasse berechtigte ihn nicht zu einem Studium. Folgerichtig trieb es ihn an die Berliner Humboldt-Universität, an der er 1954 eine Sonderprüfung ablegte. Die Lehranstalt galt als „Arbeiter- und Bauern-Fakultät" und war genau zu jenem Zweck errichtet worden, eine fehlende Schulbildung begabter Kandidaten nachzuholen. „Auf Empfehlung der ZPL des MAI begann ich im Oktober 1954 an der Hochschule für Außenhandel in Staaken ein Intensivstudium." 53 Die Parteileitung seines Ministeriums hatte ihn für dieses Studium vorgeschlagen. Nachdem Schalck 1955, dank Hans Fruck, endlich in die Partei aufgenommen war, begann er auch an der Hochschule für die allgegenwärtige SED zu arbeiten. Schon im März 1955 wurde er zum zweiten Sekretär der Grundeinheit seines Studienjahres gewählt. 54
Jetzt war Schalck nicht mehr aufzuhalten, nicht nur als politischer Aktivist. Als Hundertschaftsleiter der „Gesellschaft für Sport und Technik (GST)", einer paramilitärischen Organisation als Vorstufe zur Armee, die genauso allgegenwärtig existierte wie die SED, bildete er seine Kommilitonen im Umgang mit Waffen aus. „Zur Qualifizierung der militärischen Ausbildung unter den Studenten wurde ich zu einem Sonderlehrgang „Kampfsport" der GST zur Zentralschule nach Rechlin delegiert. Hier habe ich mir in 8 Wochen eine militärische Grundausbildung angeeignet. (...) Meine Abschlussprüfung im Dezember 1955 bestand ich mit der Note „sehr gut". Mit der Ausbildung erwarb ich mir das Mehrkampfabzeichen und das Schießabzeichen in Gold." 55
Auch an der Universität zeichnete sich Schalck durch politische Linientreue, Fleiß und Erfolg aus. Das dritte Studienjahr absolvierte er als Fernstudent, arbeitete daneben weiter im MAI. Hier lagen seine Stärken auf anderen Gebieten. Im Ministerium fiel er durch seine Improvisationskünste auf. So benötigte Ost-Berlin im August 1957 beispielsweise dringend 300 Kilogramm Nickel. Der Marktpreis lag bei sechs Dollar. Über das „Industriekontor 27", in Fachkreisen bereits damals schon als eine der wichtigsten Schieberorganisationen der DDR bekannt, organisierte Schalck den Kauf illegal und schmuggelte die Ware von West- nach Ost-Berlin. Der Preis jedoch hatte sich auf neun Dollar erhöht. Schalcks westliche Händler hatten rasch erkannt, dass der Zwang der Planerfüllung ein ideales Druckmittel war, Konditionen zu diktieren. Dennoch erntete Schalck Anerkennung und ein Prämie. Die nämlich hatte Außenhandelsminister Rau allen Staatshändlern bei unerwarteten Geschäftsabschlüssen versprochen. 56
Sein Fernstudium, das er im November 1957 mit „gut" abschloss, war durch einen zweiten Grund bedingt. Im Dezember 1955 heiratete Schalck. Die Lebensumstände im Internat der Hochschule in Staaken hatten ihm von Beginn an nicht genügt. Nun drängte ihn seine Frau, nach Berlin zurückzukehren, und Schalck fügte sich. Magarethe Becker war sieben Wochen jünger als Schalck, geboren am 23. August 1932 in Berlin. Sie lernte ihren Mann kurz nach seinen Auslandsreisen kennen und war fasziniert von den Berichten Schalcks über das für sie so unerreichbare Frankreich und Holland. Sie bewunderte diesen Mann, der sich auch Dank seiner Statur Respekt verschaffen konnte. 57
Schalck entwickelte auch in seinem Privatleben DDR-Standard. Schon zu früheren Zeiten gehörte keine Tochter aus dem verpönten Bürgertum zu seinen Freundinnen, sondern Mädchen der Arbeiterklasse. Magarethe Becker arbeitete als Schneiderin. Sie nähte und flickte die Uniformen der Ost-Berliner Volkspolizei. Erst in den 60er Jahren wurde sie dank der wachsenden Macht ihres Mannes in den Bundesvorstand des FDGB berufen. Die Familie Schalck wuchs. Am 28. November 1956 wurde Sohn Thomas geboren, am 21. Dezember 1966 Tochter Petra. Aus dem Alltag der folgenden Jahre ist wenig bekannt. Die Schalcks lebten zurückgezogen, der Position und Aufgabe des Vaters angemessen.
Alexander Schalck war nach der Wende von 1989/1990 umringt von zahlreichen Legenden. Sein Aufstieg zum „obersten Devisenbeschaffer der DDR" wurde gleichgesetzt mit der märchenhaften Gestalt des „Geistes aus der Flasche", dessen perfekt funktionierendes Imperium derart verschleiert nahezu ins Unermessliche wuchs. 58 Übersehen werden die Fakten. Schalck war von Beginn an ein Kind des DDR-Systems. Fünfzehnjährig durchlebte er die Nachkriegszeit wie viele tausende andere Jugendliche auch. Er erlag den vollmundigen Versprechungen von einer neuen Gesellschaft, die ihm suggerierten, einzig der soziale Erfolg stabilisiere die politische Einheit und demonstriere somit eine sozialistische Alternative gegenüber dem Westen. Die SED war angetreten, soziale Unterschiede erst gar nicht zuzulassen. Alles war sozial gerecht, weil alles auf sozialer Gleichheit basierte, wenn man bereit war, sich dem Führungsanspruch der Partei zu unterwerfen. Schalck war es, wie Millionen andere auch. Erste Erfolge schienen der sozialistischen Alternative Recht zu geben, ließen Schalcks vorsichtige Zweifel verschwinden. Erst mit seiner Aufgabe im MAI kam er in den Genuss von unzähligen Privilegien der Nomenklatura, des begünstigten Zugangs von knappen und höherwertigeren Gütern und Waren. Auch diese verdeckte Ungleichheit, die den propagierten Leistungsanspruch ins genaue Gegenteil verkehrte, war nicht seine Idee gewesen. Selbst diese Eitelkeiten hatte er übernommen, von Männern wie Fruck, Wolf und auch von Ulbricht. Als es galt, den Herrschaftsanspruch der SED nicht in bloßer Theorie verkommen zu lassen, da bedurfte es unterhalb der obersten Führungsebene dienstwilliger Befehlsempfänger. Genau dazu gehörte Schalck in den Jahren seines Aufstiegs. Und er sollte sich fortan genau dadurch profilieren.
Der Arbeitsstätte kam in der DDR eine besondere Rolle zu. Für Schalck muss dies mehr als für andere gegolten haben, waren die Betriebe für ihn doch eher ein zweites Zuhause als bloßer Produktionsort. Schnell dürfte ihm überdies bewusst geworden sein, dass sein weiteres Fortkommen an die Parteimitgliedschaft, Kirchenaustritt und Kampfgruppenbeitritt gebunden war. Er wollte Karriere machen. Derart involviert war für den zielstrebigen Schalck alles möglich. Sein systemkonformes Verhalten war der frühzeitige Garant für höhere Aufgaben.
Schalck war zwar seit seiner Kindheit mit einer gesunden Physis versehen, doch erst im Reifeprozess mag auch er selbst eingesehen haben, dass dies keine mangelnde Bildung ersetzt. Schritt für Schritt entwickelte sich der junge Schalck, bis ihm die Grenzen seiner schulischen Versäumnisse deutlich aufgezeigt wurden. Die durchschnittliche Schulbegabung, so wird zu sehen sein, vermochte er nicht immer zu kaschieren. Oftmals dürfte er selbst nicht mehr verstanden haben, was er in schauderhaftem Deutsch zu schreiben in der Lage war.