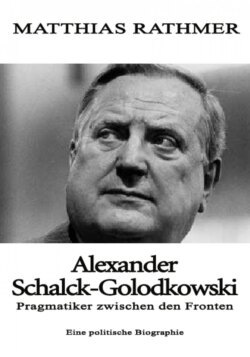Читать книгу Alexander Schalck-Golodkowski - Matthias Rathmer - Страница 9
Entwicklung in Kindheit und Jugend
ОглавлениеIn Polen herrschten 1932 bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Minderheiten im Staat, vornehmlich Litauer, Deutsche, orthodoxe Weißruthenen und Ukrainer, kämpften gegen die Minoritätenpolitik des Staatspräsidenten Jozef Pilsudski. Die außerparlamentarischen Oppositionellen organisierten immer wieder Streiks und Protestveranstaltungen, die vielerorts in blutigen Straßenschlachten endeten. Das polnische Bürgertum, nationale Kräfte, aber auch der Adel widersetzten sich den Parolen der für ihre nationale Unabhängigkeit kämpfenden Volksgruppen. Die erbitternsten Gegner, die „Organisation Ukrainischer Nationalisten" (OUN), führten seit 1930 einen wahren Guerillakrieg. Anschläge und Kampfhandlungen gehörten in zahlreichen Städten Polens zum Alltag. Die nationalistisch gesinnte Regierung unter Pilsudski bekämpfte ihrerseits die radikale Untergrundorganisation mit zunehmender Härte. Es war die Zeit des politischen Extremismus in Polen, in der die Revolutionäre zwar geschwächt, aber nicht minder brutal den polnischen Staat und seine Gutsherren attackierten. 1 Die Weltwirtschaftskrise, ohnehin schon globaler Auslöser von Unzufriedenheit und Verarmung, schürte diese Konflikte weiter.
Als Polen und die Sowjetunion am 25. Juli 1932 einen Nichtangriffspakt unterzeichneten, verschärfte sich gleichfalls die politische Auseinandersetzung mit der Regierung Brüning. Die deutsche Außenpolitik war mehr denn je auf Grenzrevision zum Ost-Nachbarn und militärische Aufrüstung ausgerichtet. Pilsudski setzte auf die Politik der Abschreckung, um Deutschland zur Einhaltung der Grenz- und Rüstungsbestimmungen aus dem Versailler Vertrag zu zwingen. Er ließ im März 1932 verstärkt Truppen in Ostpreußen stationieren und im Juni den Zerstörer „Wicher" in den Danziger Hafen einfahren. 2 Beide Ereignisse wurden in Deutschland als Teil der außenpolitischen Schwächen der ohnehin instabilen Präsidialkabinette Brünings und Papens bewertet.
Die Weimarer Republik ging ihrem Ende entgegen, als Alexander Schalck vor dem Hintergrund dieses geschichtlichen Kontexts am 3. Juli 1932 in Berlin geboren wurde, wohin seine Eltern aus dem krisengeschüttelten Polen geflüchtet waren. Der Vater Schalcks, Peter Golodkowski, wurde am 25. Januar 1895 in Surasch geboren, die Mutter, Agnes Eue, am 25. August 1889 in Hamburg. Beide hatten sich gegen Ende der 20er Jahre in Danzig kennen gelernt und geheiratet. Schalcks Mutter kam aus bürgerlich-kaufmännischen Verhältnissen und wuchs in St. Petersburg auf, wo ihr Vater die Filiale des Stinnes-Konzerns leitete. Ihr Lebenslauf ist lückenhaft. Aus einer ersten Ehe entstammte Sohn Slawa, der noch heute in Berlin unter dem Nachnamen Kostareff lebt. Zum Zeitpunkt der Geburt war Schalcks Mutter 43 Jahre alt. In einem Dokument der Staatssicherheit aus dem Jahr 1966, Schalck wurde hier zur Einstellung eines „Offiziers im besonderen Einsatz" vorgeschlagen, gibt es jedoch keine weiteren Hinweise auf die elterlichen Lebensverhältnisse. 3 Lediglich das Geburtsdatum des Halbbruders, der 19. April 1919 in Jekaterinoslaw, erlaubt vorsichtige Einschätzungen zur mütterlichen Vergangenheit.
Schalck selbst jedenfalls wertete die biographischen Daten seiner Mutter als weniger beachtenswert. „(...) Mein Vater war Kraftfahrer und hat diesen Beruf bis kurz vor Beginn des 2. Weltkrieges ununterbrochen ausgeübt (...)". 4 Alle seit dem Umsturz des SED-Regimes gefundenen Lebensläufe Schalcks begannen stets mit der sozialen Herkunft seines Vaters. Denn wer in den Gründungsjahren der DDR erfolgreiche Bewerbungen schreiben wollte, der musste, wenn irgendwie möglich, aus der Arbeiterklasse stammen und als „faschistisch unauffällig" gelten. Schalcks Mutter führte ein „von" in ihrem Namen. Ein solcher Namenszug wies auf ihre adelige Herkunft hin, ein Umstand, der so gar nicht zum späteren Selbstverständnis Schalcks passte. Ein Kraftfahrer zum Vater, der zudem 1948 für tot erklärt wurde, versprach da schon eher, gleich zu Beginn des Lebenslaufes einer der wichtigsten Prämissen der Diktatur des Proletariats zu entsprechen. Wie und wann die Mutter dieses Adelsprädikat erwarb, ist unklar. „(...) Meine Mutter war gelernte Buchhalterin, hat aber bis 1940 keinen Beruf ausgeübt (...)." 5 Schalck begnügte sich mit einem bloßen Hinweis auf ihren Beruf, der allein schon gewisse Rückschlüsse auf die soziale Stellung, ihre Ausbildung und somit auf die gehobenen Vermögensverhältnisse ihrer Eltern zu Zeiten des Deutschen Kaiserreiches und der Weimarer Republik erlaubte. Er schränkte jedoch sofort beschwichtigend ein, dass sie diese Tätigkeit ja nicht ausgeübt habe.
In Danzig jedenfalls heiratete Schalcks Mutter zum zweiten Mal. Peter Golodkowski war ein Staatenloser russischer Abstammung, ein Status, der ihm das Leben im sog. Danziger Korridor erheblich erschwerte. Hier schlug ihm Fremdenhass entgegen. Polen und Deutschland stritten um diesen Landstreifen, der zusammen mit der Freien Stadt Danzig Ostpreußen vom übrigen Reichsgebiet trennte. So mag der Wunsch, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen, verständlich wirken, als Peter Golodkowski die Ehe einging. Es existieren jedoch mehrere, unabhängig von einander gemachte Aussagen, dass der Vater Schalcks für seine Einbürgerung weitere Hilfen in Anspruch nahm. Danach bat er einen Freund, nämlich Fritz Schalck, einen Offizier der SS, ihn zu adoptieren. Schriftliche Quellen, Dokumente über diese Adoption, liegen nicht vor. Ein Umstand, der in der Vergangenheit zu den wildesten Spekulationen über die Herkunft Schalcks führte. Eine Version ging soweit, dass Schalck selbst von jenem SS-Angehörigen in Krakau adoptiert wurde und nicht sein Vater. Glaubhaft scheinen andere Quellen zu sein. Danach diente der Vater als Offizier in der Armee des russischen Zaren, flüchtete vor den Bolschewisten und arbeitete schließlich für die Deutsche Wehrmacht als Leiter der russischen Dolmetscherschule in Moabit. Der Hinweis auf diese mögliche, für einen späteren Werdegang in der SED belastende Vergangenheit Alexander Schalcks soll Anlass für die spätere DDR-Staatssicherheit gewesen sein, alle verfügbaren Unterlagen aus den Archiven zu entfernen. 6
Alexander Schalck wuchs in Berlin-Treptow auf. „(...) Meine Erziehung war überwiegend meiner Mutter überlassen. Beide Elternteile und auch mein Halbbruder waren nicht Mitglied der NSDAP (...)." 7 Knapp nur beschrieb Schalck die eigene Kindheit. Nach der Machtübernahme Hitlers 1933 befürchtete die Familie mehr denn je, in die allgemeine Hetzjagd nationalsozialistischer Rassenpropaganda zu geraten. Die Schalcks lebten zurückgezogen und unauffällig, in bescheidenen Verhältnissen. Der Beruf des Vaters dürfte ein Grund gewesen sein, warum sich eher die Mutter seiner Erziehung annahm. 8
Ehemalige Mitschüler, Schalck wurde sechsjährig 1938 in die Volksschule Treptow eingeschult, erinnern sich an einen ängstlich gehemmten und schweigsamen Jungen, der sich, gehänselt ob seiner behäbigen Art und fülligen Masse, auf dem Schulhof eher mit den Fäusten durchzusetzen verstand als mit Verstand und verspieltem Kinderwitz. Seine Schulnoten waren zudem nicht die besten, lediglich Fremdsprachen weckten sein schulisches Interesse. 9 Darüber hinaus ist von dem jungen Schalck nichts bekannt. Wann und wo der Vater mit Beginn des Krieges getötet wurde, ist nicht bekannt. 10 So wurde der neunjährige Schalck 1942 in eine Internatsschule geschickt. Dies geschah wohl in erster Linie, um dem Sohn in Zeiten allgemeiner Kriegswirren doch noch eine solide Schulausbildung zukommen zu lassen. „Ich besuchte die Internatsschule in Waldsieversdorf bei Buckow/ Märkische Schweiz bis zum Jahre 1947 mit einer kurzen Unterbrechung zum Kriegsende, als die Schule nach Brandenburg an der Havel ausgelagert wurde. Nach Abschluss der neunten Klasse im Internat Waldsieversdorf, später Einheitsschule, habe ich eine Voluntär-Tätigkeit bei der Firma Hopstock in Berlin-Treptow, Herstellung von Kinovorführgeräten, aufgenommen, in der mein Bruder als Feinmechanikermeister tätig war." 11 Mehr teilte Schalck über seine Kindheit und Jugend nicht mit.
Der Krieg war vorüber, Deutschland geteilt. In der sowjetischen Besatzungszone unterstützte Schalck seine Familie mit Hilfsarbeiten. Ende 1946 beispielsweise arbeitete er als Türsteher im „Cafe Astoria, Unter den Linden". Der junge bullige Schalck hatte sich zur Respektsperson entwickelt. Eine Lehre als Bäcker, die er nach Kriegsende begonnen hatte, brach er ab. In einem späteren Vernehmungsprotokoll des BND gab er weiter an: „Nach Abschluss der Volontär-Tätigkeit habe ich 1948 eine Berufsausbildung als Feinmechaniker bei den Elektroapparate-Werken Berlin-Treptow, ehemals AEG, zu diesem Zeitpunkt SAD-Betrieb, aufgenommen und im Rahmen des Berufswettbewerbes 1950 vorzeitig erfolgreich abgeschlossen. Ich habe danach noch kurze Zeit in dem Betrieb als Feinmechaniker gearbeitet und später als Arbeitsvorbereiter. 1951 habe ich den Betrieb gewechselt und bin zum RFT-Anlagenbau Berlin (VEB Radio- und Fernmeldetechnik, d.A.) als Arbeitsvorbereiter gegangen. Diese Tätigkeit übte ich bis Mai 1952 aus." 12 Schalck entwickelte ein überdurchschnittliches technisches Geschick im Umgang mit Messgeräten.
Die Fähigkeiten des 18jährigen und die Position des Arbeitsvorbereiters deuteten frühzeitig an, dass er mehr zu leisten im Stande war als ein normaler Facharbeiter. Die meisten Betriebe wurden in dieser Zeit als deutsch-sowjetische Aktiengesellschaften unter strenger Kontrolle geführt. Sie waren Teil der Reparationsleistungen an die sowjetischen Besatzer. Nur wer als faschistisch unbelastet und kommunistisch gesinnungstreu in Erscheinung trat, konnte in den Gründungsjahren der DDR eine derartige Vertrauenspositionen erhalten. „Aufgrund meiner Erziehung im Elternhaus und im Internat war mein Klassenstandpunkt 1947 nicht ausgeprägt. Erst mit Beginn meiner Lehre in den Elektro-Apparate-Werken Treptow bekam ich Kontakt zur FDJ und zur Sportbewegung. Bereits 1948 wurde ich Mitglied des FDGB und der BSG EAW-Treptow-Sektion Boxen." 13 Mit gewisser Enttäuschung skizzierte Schalck sein Elternhaus. Er, der Sohn eines Kraftfahrers, hatte eine bürgerlich-konservative Erziehung genossen. Dass es ihm dennoch frühzeitig gelang, den Ansprüchen der sozialistischen Ideologie eines Arbeiter- und Bauernstaates zu entsprechen, führte er auf sein ausgeprägtes politisches Interesse zurück. Mit 19 Jahren schien Schalck erkannt zu haben, dass er ohne die allgegenwärtige Partei keinerlei Entwicklungsmöglichkeiten besaß. Fraglich dabei bleibt, wie er sein politisches Bewusstsein in jenen Jugendjahren reflektierte. Er war eben nicht zum sozialistischen Kämpfer erzogen worden, der mit Vehemenz für die neu gegründete DDR eintrat. Weit mehr hatte Schalck die eigenen Existenzsorgen vor Augen, als er den Kontakt zu den führenden SED-Genossen suchte.
„Im Herbst 1950 wurde ich mit einigen Sportlern des Widerstandes gegen die Staatsgewalt in Westberlin angeklagt. Nach Beratung mit einem zuständigen Justitiar im Nationalrat der Nationalen Front nahm ich am Prozess teil und wurde aufgrund meines Alters freigesprochen." 14 Schalck wurde von der Westberliner Polizei verhaftet, weil er Wahlpropaganda für die SED gemachte hatte, Plakate geklebt hatte. Die Genossen hatten den robusten Boxer Schalck für diese Einsätze angeworben. Im Gegenzug, quasi als Auszeichnung für jene nicht ungefährlichen Politausflüge über die Sektorengrenze, durfte der parteilose Jugendliche am Parteilehrjahr der SED teilnehmen. "Hier stellte ich bereits meinen ersten Antrag zur Aufnahme als Kandidat der SED, der aufgrund einer Aufnahmesperre für Angestellte zu diesem Zeitpunkt noch nicht berücksichtigt werden konnte." 15
Die Kinder- und Jugendjahre Schalcks dürften sich im wesentlichen tatsächlich so ereignet haben, wie Schalck sich selbst mehrfach, in Nuancen zwar unterschiedlich, erinnerte. Alle Schilderungen verweisen auf einen zentralen Aspekt: aus eigenem Antrieb hatte Schalck die sozialistischen Ideale des Arbeiter- und Bauernstaates für sich verbindlich gemacht und der Partei die Führungsrolle zu dessen Errichtung und Festigung uneingeschränkt zuerkannt. In einem zentralen Punkt seines Lebenslaufes aber tauchen Widersprüche auf.
Es sind Zeitzeugen, Weggefährten Schalcks und ehemalige Mitarbeiter der Staatssicherheit, die darauf aufmerksam machen: als Alexander Schalck im Herbst 1950 von der Westberliner Polizei kurzzeitig verhaftet wurde, dann deshalb, weil er einträchtigeren Geschäften nachgegangen sein soll, als allein den Lebensunterhalt in einer schwierigen Zeit durch eine solide Berufstätigkeit zu erwerben. Schalck soll Lebensmittel von West nach Ost geschmuggelt haben, mit Zigaretten, Medikamenten und Alkohol einen schwunghaften Handel betrieben haben. Gewiss: private Tausch- und Schmuggelgeschäfte gehörten in dieser Phase des Nachkriegsdeutschlands zwar zum Existenzkampf vieler, in der Version des jungen Schalck jedoch soll der illegale Gütertransfer über die Sektorengrenzen nahezu perfekt organisiert gewesen sein. Tagelange Untersuchungshaft und stundenlange Verhöre durch Mitarbeiter einer Sonderkommission der Alliierten, die den Schwarzhandel zwischen den Besatzungszonen bekämpfen sollten, zeugten davon, so verschiedene Quellen übereinstimmend, dass Schalck in kurzer Zeit einen ansehnlichen Umfang mit seinen Schmuggelgeschäften erzielt haben muss. 16 Die Angst vor einer unsicheren Zukunft soll-
Schalck später auch dazu getrieben haben, den MfS-Verantwortlichen Personen und Strukturen seiner Schmugglerringe preiszugeben. Beeindruckt ob der präzisen, peniblen vor allem aber verlässlichen Angaben Schalcks über den illegalen Handel, wollen die Ost-Ermittler Schalck angeworben haben. In ihrem Auftrag soll er neue Partner und Schmuggelwege entdeckt und sich so in kurzer Zeit als loyaler Denunziant verdient gemacht haben. Diese Kreativität und die Fähigkeit Schalcks, seine Handelspartner zu täuschen, hatten sich danach frühzeitig auch im Ministerium für Staatssicherheit herumgesprochen. 17
Es ist letztlich zweifelhaft, ob der junge Schalck tatsächlich diesen Schmuggelgeschäften nachging. Einige Fakten jedenfalls sprechen für diese Darstellung. Schalck lebte in den Zeiten allgemeiner Not gut, sehr gut sogar, glaubt man den Berichten. 18 Er hatte es kurz nach dem Krieg zu Wohlstand in Form einer beheizten Wohnung, einem gebrauchten Auto, Kleidung und reichhaltigen Nahrungsmitteln gebracht. Er pflegte freundschaftliche Verhältnisse zu seinen Vorgesetzten, die ihn bevorzugt mit nötigen Arbeitsmaterialen ausstatteten, auf die seine Kollegen schon seit Tagen warteten, um ihre Arbeit erledigen zu können. Und er schwelgte mitunter in bescheidenem Luxus, dann nämlich, er in Nachtlokalen und Bars der Westzonen zu alkoholfreudigen Exzessen einlud, die für einige Begünstigte noch heute in bleibender Erinnerung sind. Schalck war begehrt, auch oder gerade bei dem anderen Geschlecht. Von mannhafter Statur und ausgestattet mit einer gesunden Portion Berliner Mutterwitzes, ließ es sich an seiner Seite aushalten. 19 Noch einmal: was von diesen Überlieferungen stimmt, was sich beispielsweise als Legende entpuppt, oder was Zeitzeugen aus der Jugendzeit eines der mächtigsten Männer der DDR an Anekdoten über vierzig Jahre glaubhaft überliefern wollen, ist nur schwerlich zu kontrollieren. Die Darstellungen gewinnen aber gerade deshalb an Bedeutung, weil sie selbst in Details so überraschend übereinstimmen, dass sie bei aller Subjektivität durchaus glaubhaft erscheinen. Auch die späteren Stationen Schalcks im nachrichtendienstlichen Gefüge des Staatsapparates, einer alles umfassenden Kaderpolitik, bedingten nahezu einen frühen Kontakt zum MfS, auch wenn Schalck zu diesem Zeitpunkt kein offiziell geführter MfS-Mitarbeiter war.
Wie auch immer die Darstellungen letztlich korrekt zu bewerten sind, entzieht sich profunder Kenntnisse. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung jedenfalls betrieb auch der neu gegründete Ost-Staat den Schwarzhandel. Walter Ulbricht hatte diesen Weg der Deviseneinnahmen angeordnet, um in den westlichen Besatzungszonen so dringend benötigte Waren wie Stahl oder Textilien bezahlen zu können. Die „operative Abwicklung" dafür übernahm offiziell die Hauptabteilung „Handelspolitik" im Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel, dahinter aber verbarg sich tatsächlich die Abteilung „U9" des ZK und das Ministerium für Staatssicherheit. 20 Chef der Berliner Verwaltung der Staatssicherheit war Hans Fruck, der spätere Stellvertreter von Markus Wolf. Unter Frucks Leitung und Führung sollte der junge Schalck seine einmalige Machtposition erreichen.
Bisweilen wurde das Bild vermittelt, immer wieder auch von ihm selbst, Schalck sei ein Zögling der DDR-Gesellschaft gewesen, der es auf geradezu geniale Art und Weise verstand, der maroden Staatswirtschaft Devisen um jeden Preis zu verschaffen. Zweifelsfrei verfügte er dabei über eine große praktische Intelligenz, doch Schalck war kein Analytiker. Den Prozess seiner politischen Sozialisation hat er vermutlich gar nicht wahrgenommen. Längere Zeit muss er gerade in seinen Berliner Jugendjahren daran gedacht haben, den Ostteil Berlins zu verlassen und sein Glück beim späteren Klassenfeind zu versuchen. Jedenfalls gehörte er nicht zu den Männern der ersten Stunde, die, wie etwa die Ulbricht-Gruppe, das politische und wirtschaftliche System des sowjetischen Kommunismus installierten. 21 Schalck dachte praktisch, organisierte sein Leben eigenständig und selbstbewusst, eher das eigene Wohl vor Augen, wie viele andere auch.