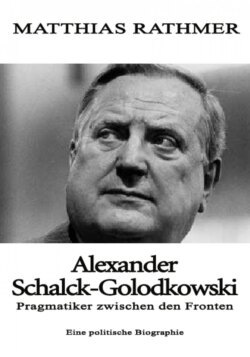Читать книгу Alexander Schalck-Golodkowski - Matthias Rathmer - Страница 7
Einleitung
ОглавлениеDer Auftritt ist gelungen, und das Gelächter im Sitzungssaal verhallt nur langsam. Gerade hat Dr. Alexander Schalck-Golodkowski im besten Berlinerisch einen Frontalangriff auf parlamentarischen Dilettantismus erfolgreich abgeschlossen. „Sie bestimmen die Fragen, und ich bestimme die Antworten." 1 Die Cleverness dieses Mannes ist beeindruckend. Während der Vorsitzende Mühe hat, die Ernsthaftigkeit dieser Veranstaltung aufrecht zu erhalten, sitzt Schalck mit seiner fast zwei Meter hohen Gestalt und großem, rundem Gesicht gelöst an einem Tisch. Er wirkt gepflegt. Der Anzug ist maßgeschneidert. Entgegen einiger Darstellungen scheint er körperlich gesund. Mehrere überregionale Zeitungen titelten zuvor, ihn plage die Gicht. Da präsentiert er sich also nun, einer der angeblich größten Wirtschaftsverbrecher deutscher Geschichte, der Oberbösewicht. Sein Anwalt begleitet ihn, obwohl Schalck gewandt genug ist und diesen nicht wirklich braucht. Die Rückkopplungsgeräusche der Mikrofonanlage pfeifen erneut durch den Raum, und der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses wartet auf eine Antwort Schalcks. Der nimmt die Brille ab und wendet sich zur Seite. Erneut in bestem Berlinerisch gibt er zurück: „Ihre Fragen klingen interessant. Gibt es auch Beweise?" 2 Wieder lachen alle Anwesenden. Dr. Alexander Schalck-Golodkowski hat während seines ersten Auftritts vor den nach Aufklärung bemühten Bonner Parlamentariern im September 1991 alles fest im Griff. Gut beraten schweigt er über sein Wirken und über die, die einst mit ihm waren.
Schalck-Golodkowski zählt sicher zu den schillerndsten Figuren der Zeitgeschichte. Nachdem im Dezember 1989 und in den darauf folgenden Monaten mehr und mehr von seiner Mission bekannt geworden war, wucherten beispiellos eine Fülle von Legenden und Halbwahrheiten über den ehemaligen Außenhändler der DDR. Für viele war er ein gerissener Gauner des ostdeutschen Regimes. Andere bezeugten ihm aufrichtiges Engagement in seinem Bemühen um eine effiziente Devisenerwirtschaftung außerhalb des Staatsplans. Für andere wiederum gehört er zu den Verantwortlichen sozialistischer Misswirtschaft wie z.B. Günter Mittag und Gerhard Schürer. Für jene, die mit ihm Geschäfte machten, war er ein ungewöhnlich dynamischer Pragmatiker, der das ökonomische Lenkungssystem des real existierenden Sozialismus mit kapitalistischen Methoden überwand. Als Unterhändler in deutsch-deutschen Verhandlungsgesprächen war er schließlich Ansprechpartner westdeutscher Politik. Fast immer aber wurden bislang sein Stellenwert und sein Einfluss innerhalb des politischen Machtapparates der DDR überschätzt. Allenfalls der Aufschub des Untergangs der DDR war ihm gelungen.
Mit rechtsstaatlichen Mitteln scheint der ehemalige Leiter des Bereichs Kommerzielle Koordinierung (KoKo), MfS-Offizier im besonderen Einsatz und Staatssekretär nicht zu fassen zu sein. Zwar muss sich der einstige Devisenbeschaffer der DDR im September 1995 vor dem Berliner Landgericht wegen der illegalen Einfuhr von Waffen und Militärgütern verantworten, doch eine Verurteilung ist fraglich. 3 Schalck soll, so die Ermittler, zwischen 1987 und 1989 insgesamt 102 Pistolen, Flinten und Gewehre für 330.000 US-Dollar sowie 246 Nachtsichtgeräte im Wert von 2,8 Millionen Mark aus der Bundesrepublik in die DDR eingeführt haben. Die rechtliche Konstruktion der Berliner Staatsanwaltschaft scheint jedoch grundsätzlich zweifelhaft, da selbst das diese Importe verbietende Militärregierungsgesetz Nr. 53 der Alliierten in seiner Gültigkeit vom Rechtsbeistand Schalcks angezweifelt wird. Gegen Alexander Schalck liegen bis heute drei weitere Anklagen vor, wegen der Sonderversorgung der SED-Prominentensiedlung Wandlitz, wegen Steuerhinterziehung und wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.
„Was ich gemacht habe, hätte auch ein anderer machen können. Ich hatte das Glück, dass ich ausgesucht wurde." 4 Mit Dr. Alexander Schalck-Golodkowski (nachfolgend der Einfachheit wegen Schalck genannt) trat in den Wirren der Wiedervereinigung eine Figur ins deutsch-deutsche Rampenlicht, die widersprüchlicher kaum sein konnte. Die von ihm immer wieder geäußerten Erklärungen, nicht ohne einen gewissen Hauch von schicksalhaftem Pathos vorgetragen, glauben viele nicht. Seit November 1989 sammelte Schalck Superlative wie andere seltene Briefmarken. Da war die Rede vom „obersten Devisenbeschaffer der DDR" 5, vom „mächtigsten Mann Ost-Berlins" 6 und „von einem der besten Spione der HVA" 7. Andere wiederum nannten ihn den „Totengräber der DDR" 8, und für wieder andere war er nach AI Capone der „größte Kriminelle des Jahrhunderts" 9.
Die Gründe, warum Schalck mit derlei ungleichen Titeln bedacht wurde, liegen vor allem in zwei seiner Tätigkeitsfelder begründet. Schalck war ein Offizier im besonderen Einsatz des Ministeriums der Staatssicherheit (MfS) der DDR, ihn umgab ein einzigartiges nachrichtendienstliches Fluidum. Schalck arbeitete hochgradig konspirativ, abgedeckt und geschützt durch das MfS-Schmuckstück, die Hauptabteilung Aufklärung (HVA). Arbeits- und Funktionsweisen der HVA zwangen zur eisernen Verschwiegenheit, zu einer eigenartigen Mischung aus sozialistischem Gehorsam und gewitzt geschäftlicher Agilität. Waren die deutsch- deutschen Beziehungen Zeit ihres Bestehens ohnehin schon von Zwielichtigkeit und Sensibilität geprägt, so zeigten die Enthüllungen um den „Meisterjongleur von Milliardenbeträgen" 10 eine völlig neue politische Kultur der Ost-West-Beziehungen. Mit der Devisenerwirtschaftung Schalcks verbanden HVA und SED-Führung eine umfangreiche wirtschaftliche Kooperation mit dem „Klassenfeind" im Westen, der seinerseits nichts unversucht ließ, das diktatorische System Honeckers zu schwächen. Hinter den Kulissen jahrzehntelang inszenierter deutschlandpolitischer Aufführungen der Regierungschefs standen die eigentlichen Hauptakteure: Staatssekretäre, Unterhändler, Agenten, Verfassungsschützer, die Creme bundesdeutscher Unternehmen und Politiker jeglicher Gesinnung. Ihre Ziele: das Machbare zu erreichen und dafür so wenig wie möglich zu zahlen. Genau in diesem Dunstkreis wirkte Schalck. Diskretion ist noch heute sein oberstes Gebot. „Ein kluger Mann hat mir geraten: Verkaufe nicht Dein Wissen gegen Geld, und haue die Politiker der BRD nicht in die Pfanne." 11
1966 machte sich Schalck daran, zusammen mit dem MfS die Grundsteine für den Bereich Kommerzielle Koordinierung (KoKo) zu legen. Langsam, Schritt für Schritt, wurde die Abteilung aus allen politischen Zuständigkeiten herausgelöst und stattdessen in die Strukturen und Hierarchien des MfS eingebunden und abgesichert. Dabei war KoKo alles andere als ein kapitalistisches Wirtschaftssystem innerhalb der sozialistischen Planwirtschaft. Der Pragmatiker Schalck war in erster Linie ein typischer Parteisoldat und sein anfänglicher Auftrag bestand allein darin, Devisen für die SED zu erwirtschaften, außerplanmäßig. Erst später, von Jahr zu Jahr stärker, wurde KoKo auch damit beauftragt, Devisenlöcher der Volkswirtschaft zu stopfen, High-Tech-Produkte fernab jeglicher Embargobestimmungen zu beschaffen und zum Ende alles in begehrte Valuta umzusetzen, was der Staat noch hergab. „Die Delikatesse war, dass immer Geld fehlte. (...) Die Masse der Kredite scheiterte wegen fehlender Devisen. Also wich man auf uns aus. Da liegt das Geheimnisvolle unseres Bereiches."12
Es ist, wie es ist und kaum zu glauben. Dr. Alexander Schalck-Golodkowski lebt heute, im Mai 1995, seit nunmehr über fünf Jahren mit Ehefrau Sigrid nahezu unbehelligt am bayerischen Tegernsee. Vorbei sind die Zeiten, als sich der Beschuldigte selbst in die Öffentlichkeit begab, vor Parlamentariern, Ermittlungsbeamten und einem Millionenpublikum stets seine Unschuld beteuerte, die ihm zwar so recht keiner abnehmen wollte, sich aber auch niemand fand, der diese zweifelsfrei zu widerlegen vermochte. Und erst recht vorbei sind jene Zeiten, als sich die bundesdeutschen Kommentargazetten buchstäblich von allein füllten, weil sein sagenumwobenes Wirken förmlich danach verlangte, ein deutsches Märchen in Serienform zu erzählen. Es ist, wie es ist und kaum zu glauben. Die Deutschen, getrennt wie vereint, entlasten sich wieder einmal gegenseitig. Schon wieder droht die Aufarbeitung ihrer jüngsten Geschichte in Archive verbannt zu werden. Die Politiker beruhigen die Öffentlichkeit mit einem Schalck-Untersuchungsausschuss, der schon von Beginn an zum Scheitern verurteilt war, weil diesmal alle Parteiinteressen schonungslos hätten aufgedeckt werden müssen, politische Kultur aber darin bestand, den Widersacher in Ruhe zu lassen, um selbst nicht attackiert zu werden.
Es ist, wie es ist und kaum zu glauben. Selbst über fünf Jahre nach dem Mauerfall sind Regierung und staatliche Institutionen nicht bereit, ihr umfangreiches Wissen über die deutsch-deutsche Wirklichkeit preiszugeben, ihre Panzerschränke zu öffnen und ihre Computerdateien herauszugeben. Was man an wichtigen Dokumenten finden würde, wäre in erster Linie der Wahrheitsfindung dienlich, mit der sich alle ermittelnden Behörden bislang so schwer getan haben. Gewiss sind die „humanitären Bemühungen" der Bonner Regierungen nicht pauschal zu verurteilen, immerhin lösten sie die drückenden Probleme vieler tausender Menschen. Andererseits aber entwickelten sich die „Pro-Kopf-Zahlungen" der BRD für die Häftlinge und Familienzusammenführungen zu einträglichen Devisenquellen für die DDR. Dass die bundesrepublikanische Seite damit auch eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Ost-Berliner Regime zugunsten eines angenehmeren Verhandlungsklimas und innenpolitischen Prestigegewinns vernachlässigte, war mehr der westdeutschen Strategie gezollt, Ostdeutschland ökonomisch „aufzuweichen" und langfristig zu destabilisieren. Genau dazu bedurfte es einen Unterhändler wie Alexander Schalck, der den DDR-Führungspolitikern die wirtschaftliche West-Öffnung empfahl und sich selbst für höhere Aufgaben.
Gerne wird dabei argumentiert, dass Rechtsvorschriften einer solchen Veröffentlichung westdeutscher Strategien in Bezug auf ihre ökonomische Ostpolitik zuwider stünden, etwa der Quellenschutz für Materialien des Bundesnachrichtendienstes oder des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Gerade diese Unterlagen, an Brisanz vermutlich kaum zu überbieten, würden aber die ganze Selbstherrlichkeit der Regierungen Kohl und Schmidt offenbaren und ihr gesamtes Wissen dokumentieren. Wer aber Dr. Alexander Schalck-Golodkowski auf ein nachrichtendienstliches Problem beschränkt, hat Angst vor diesen Enthüllungen und scheint mitnichten an einer sauberen Vergangenheitsbewältigung interessiert zu sein. Eine ehrliche Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit bzw. des Wirkens Schalcks ist u.a. vor allem deshalb notwendig, um jene pauschale Vorverurteilungen zu differenzieren, mit denen der KoKo-Leiter in seiner Doppelrolle als MfS-Offizier und Außenhändler voreilig bedacht wurde. So zeichnete Schalck eben auch für eine Reihe von Geschäften verantwortlich, die nicht nur der Politbürokratie, sondern auch der ostdeutschen Bevölkerung zugute kamen, etwa bei der medizinischen Versorgung vieler Krankenhäuser mit Computertomographen, die über den offiziellen Außenhandel nur schwerlich zu beziehen gewesen wären. Und schließlich war Schalck ein Ansprechpartner des Westens, um die DDR ökonomisch zu stabilisieren, damit nach westdeutscher Strategie gleichfalls größeres Unheil von der DDR-Bevölkerung abgewendet werden konnte. Dass in diesem politischen und ökonomischen Klima auch Grauzonen entstanden, die von einigen Akteuren genutzt wurden, um mit illegalen und z.T. kriminellen Mitteln ihren Geschäften nachzugehen, darf weder vernachlässigt, aber auch nicht überbewertet werden.
Als die ersten Manuskripte dieser Arbeit vorlagen, meldeten kritische Stimmen Bedenken ob des Sinns an. In der Tat. Rein volkswirtschaftlich betrachtet ist Schalck längst schon abgeschrieben, die Verluste der Vereinigungskriminalität, als es darum ging, sein Erbe aufzuteilen, schmerzen heute so recht keinen mehr. Vergessen wird dabei, dass Schalck einflussreiche Freunde in Ost und West hatte, dass es bundesdeutsche Politiker, mit Ausnahme der Grünen, und Manager gleich welcher parteipolitischen Couleur waren, die das Unrechtregime Honeckers, Mittags und Schalcks gewollt oder ungewollt unterstützten. Schalck ist heute mehr denn je auch Symbolfigur eines deutschlandpolitischen Sumpfes und wirtschaftspolitischen Filzes. Schalck wurde gebraucht und benutzt, von beiden Seiten. Auf bislang einzigartige Weise ist es den Bonner Politgrößen gelungen, sich und die Wirtschaftscliquen führender bundesdeutscher Unternehmen aus der öffentlichen Schalck-Diskussion weitgehend herauszuhalten. Genau dadurch aber wird fälschlicherweise die westdeutsche Strategie der Systemüberwindung durch wirtschaftliche Destabilisierung vielfach mit obskuren Gaunergeschäften gleichgesetzt.
Bei der Erstellung dieser Arbeit war ein Umstand ganz besonders zu beachten. Ist bei der Untersuchung von Materialien und Akten des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit ohnehin schon grundsätzlich Vorsicht geboten, so gipfelt die Verwendung der Schalck-Unterlagen in ein inszeniertes Chaos. Nicht in jeder MfS-Akte, die als „geheim" eingestuft wurde, steckt auch automatisch Wahrheit; dies gilt übrigens für die Quellen des Bundesnachrichtendienstes und anderer Behörden gleichermaßen. So manch angebotenes Dokument stellte sich schon bei einer ersten Durchsicht als Fälschung heraus, als zweifelhafte Angabe dubioser Zeitzeugen und Mittäter. Enttäuschend war zudem, was sich in den Archiven der einstigen SED-Diktatur fand, im Gauck-Archiv genauso wie im Parteiarchiv. Die wichtigsten zeitgeschichtlichen Dokumente sind ohnehin in den Wirren der Wende 1989 vernichtet worden. Andere bedeutsame Unterlagen lagern noch immer bei ermittelnden Staatsanwaltschaften. Da sie schwebende Verfahren gegen Schalck und andere ehemalige KoKo-Verantwortliche betreffen, konnten sie nur sehr bedingt in dieser Arbeit berücksichtigt werden.
Eine politische Biographie befasst sich grundsätzlich mit dem politischen und sozialen Verhalten eines Hauptakteurs und analysiert seine Interaktionen mit anderen Akteuren in wechselnden Umfeldern. Gerade für Schalck gilt hierbei, neben der Untersuchung seiner Rollenwahl und deren verschiedenen Gestaltungen vor allem die unterschiedlich motivierten Legenden um ihn herum zu entzerren bzw. abzubauen. Dabei konnte sich die Recherche und Ausarbeitung auf einige bislang unveröffentlichter Dokumente stützen, die dem Autor von ehemaligen Protagonisten zur Verfügung gestellt wurden. Dazu kommen alle zur Verfügung stehenden und bereits vorliegenden Darstellungen und Quellen, wie etwa die Anlagenbände des Abschlußberichts des Untersuchungsausschusses. Außerordentlich ergiebig waren zahlreiche Gespräche mit Weggefährten Schalcks. Viele der Befragten waren erstaunlich auskunftsfreudig, gleichwohl sie nicht genannt werden wollen, um juristischen Auseinandersetzungen vorzubeugen. Ihre Erkenntnisse und Einschätzungen sind sowohl in der Darstellung selbst als auch im Archiv des Autors unter Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte berücksichtigt worden. Auf diese Sammlung wird an entsprechenden Stellen verwiesen.
Abgesehen von zahlreichen öffentlichen Auftritten vor dem Bonner Untersuchungsausschuss hat der Verfasser dieser Arbeit Alexander Schalck-Golodkowski nie persönlich erlebt. Er selbst ließ durch seinen Rechtsbeistand verlauten, keinerlei Interesse an dieser Arbeit zu haben, weil er schließlich noch lebe und Biographien gemeinhin dann geschrieben würden, wenn der betreffende Hauptakteur verstorben sei. Diese Haltung akzeptiert der Autor, mehr nicht.
Mein Dank gilt allen, die mich bei dieser Arbeit unterstützt haben. Herrn Prof. Dr. Jürgen Bellers möchte ich für die stets ermunternde und geduldige Begleitung danken. Seine Ratschläge halfen, so manches Hindernis zu überwinden. Herrn Prof. Dr Ulrich Thamer danke ich für seine spontane Bereitschaft, diesem Werk ein prüfendes Urteil zu verleihen. Ohne Herrn Harald Woynar und insbesondere Herrn Martin Steinhoff, die sich dieses Vorhabens mit moralischem Engagement, historischer Sachkunde und Korrekturfleiß angenommen haben, wäre dieses Werk so manches Mal zwischen Witz und Wahnsinn versackt. In der Danksagung darf letztlich einer nicht fehlen, der nämlich, der mich, und das ist durchweg ehrlich gemeint, auch wenn auf seine Namensnennung aus möglichen zukünftigen atmosphärischen Spannungen verzichtet wird, mit überzeugender Entsch(l)usskraft im März 1994 förmlich dazu nötigte, mit den Vorbereitungen und der Fertigstellung dieser Arbeit zu beginnen.
Hamburg, im September 1995
Matthias Rathmer