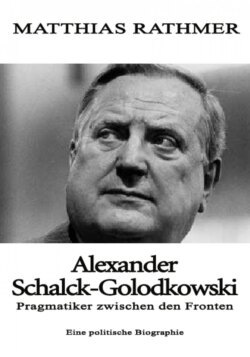Читать книгу Alexander Schalck-Golodkowski - Matthias Rathmer - Страница 6
Vorwort
ОглавлениеAls mit dem Mai 1995 diese politische Biographie in den Bibliotheken und Seminaren deutscher Universitäten zu lesen war, erreichte mich nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung das Schreiben einer angesehenen Anwaltskanzlei aus Süddeutschland. Mir war eine Unterlassungsverpflichtungserklärung zugestellt worden. Mit der Auflage, im Falle der Nichtbeachtung eine Millionenzahlung als Entschädigung zahlen zu müssen, sollte ich fortan nicht mehr behaupten dürfen, dass ein bestimmter, in dieser Darstellung angeführter, japanischer Konzern im Handel mit der DDR willentlich Embargovorschriften gebrochen hatte. Arg verwundert tat ich, wie ich noch heute tue, wenn mich Frechheiten wie diese belästigen. Ich kritzelte „Empfänger unbekannt verzogen“ auf den Umschlag und gab den Brief zurück in die Post.
Ein paar Monate später meldete sich ein angeblicher Journalist aus Bonn bei mir. Gegen eine Schutzgebühr von fünftausend Mark wollte er mein Exemplar des alternativen Berichts der Fraktion Bündnis90/Die Grünen zum Schalck-Untersuchungsausschuss erwerben. Den hatten Mitglieder der Partei als Antwort auf den offiziellen Abschlussbericht verfasst. Weil sie in diesem Dokument vor allem Aktenmaterial verwendet hatten, dass von den zuständigen Behörden als „streng geheim“ deklariert worden war, hatte Rita Süssmuth in ihrer Eigenschaft als Bundestagspräsidentin alle bis dato veröffentlichen Exemplare wieder einsammeln lassen.
Dann und wann wurden in der Folge ein paar Wissenschaftler verschiedener Fakultäten vorstellig und drängten gleichfalls nach einer Kopie dieses Berichts. Andere Anfragen und Bemerkungen wurden mir, sie beinhalteten sowohl Lob wie auch Tadel für das Werk, über die zugestellt, die den Druck der Arbeit finanziert hatten. Zum Dank hatte ich eine kleine Widmung notiert. Mitunter gibt es bis zum heutigen Tag Rückmeldungen auf das Werk von einst, dann nämlich, wenn mein Name gegoogelt worden ist, und Wikipedia seine Darstellung über Alexander Schalck-Golodkowski öffnet, in der neben anderen Untersuchungen auch diese politische Biographie erwähnt wird. Als sei die Erwähnung eine Art Krönung für wissenschaftliche Arbeiten, wird von vielen wie selbstverständlich angenommen, dass auf dieser Plattform wie auch in den angeführten Werken unverrückbar Wahrheit geschrieben steht. Mit der Wahrheit und ihrer Findung über den Hauptakteur und seiner Begleiter aber ist es gerade in diesem Fall erst recht so eine Sache. Immer noch.
Alexander Schalck-Golodkowski war in der DDR Genosse, Außenhändler, Staatssekretär und Offizier im besonderen Einsatz der Staatssicherheit. Seine Abteilung Kommerzielle Koordinierung im ehemaligen SED-Regime erwirtschaftete Milliarden, mit zweifelhaften Methoden und mäßigem Erfolg. Als „Fanatiker der Verschwiegenheit“ machte er Schlagzeilen. Honeckers oberster Devisenbeschaffer geriet vom „Retter zum Sündenbock“, und die „Schalck-Connection“ kannte zahlreiche ranghohe Politiker und Wirtschaftsbosse aus dem Westen. Was er tat, tat er heimlich. Legenden und Phänomene ranken sich so bis heute um einen Mann, der als aufrechter Sozialist jenseits der Mauer zum Kapitaljäger mutierte. Die, die ihm dabei halfen, schweigen gleichfalls beharrlich. Aus guten Gründen.
Ross und Reiter zu nennen, die Verantwortlichen und deren Motive im Wirtschaftsgeflecht zwischen Ost- und Westdeutschland vor dem Hintergrund des einzigartigen Umfelds der deutschen Teilung zu demaskieren, war bereits damals ein zentrales Anliegen der Darstellung. Zwanzig Jahre nach ihrer Veröffentlichung bleiben zwingende Fragen immer noch unbeantwortet, sind wesentliche Kapitel deutscher Vereinigungsgeschichte immer noch nicht geschrieben, ist die Wahrheit immer noch nicht heraus.
„Hallo, Herr Schäuble!“ drängt es mich mitunter, wenn ich verfolge, wie eifrig unser Finanzminister um eine europäische Einheit kämpft und dabei unaufhörlich eine Sparpolitik von allen Mitgliedsstaaten fordert, die einige, gerade im Süden des Kontinents, schon vor ihrem Beitritt zu leisten nicht in der Lage waren. „Wollen wir uns nicht doch noch einmal über Schalck und Ihre Beiträge im Filz und Sumpf um diesen Mann unterhalten? Über Ihre Vergesslichkeiten? Über Ihre Mitwirkung und Verantwortung als Kanzleramtsminister? Oder über den Ausverkauf der DDR?“ Nein. Wollen wir nicht, höre ich ihn harsch sagen und verstehe nur allzu gut, dass zu schweigen das Beste ist, was gerade er dazu sagen kann. Erinnern und erzählen sind seine Sache nicht.
Auch nicht, wenn es um Günther Krause geht, einem Wendehals aus der eigenen Partei, einem jener widerlichen Emporkömmlinge wirrer politischer Zeiten. Erinnern wir uns. Krause war parlamentarischer Staatssekretär des letzten Ministerpräsidenten der DDR. Zusammen mit Wolfgang Schäuble unterschrieb ausgerechnet er 1990 den deutsch-deutschen Einigungsvertrag, er, ein Mann, der zweifelhafter kaum sein konnte. Zweieinhalb Jahre später trat Krause als Verkehrsminister zurück. Die Affäre um den Verkauf der ostdeutschen Autobahnraststätten und die „Putzfrauenaffäre“ entzauberten ihn als eher einen um den eigenen Vorteil bemühten Ostdeutschen denn als integren Demokraten und machten ihn als Politiker unglaubwürdig. Wegen Untreue, Betrug und Steuerhinterziehung aufgrund von Bankrottdelikten und Insolvenzverschleppung wurde einer der beiden „Väter des Einheitsvertrages“ schließlich, als er sich, ohne alte Seilschaften bestens vernetzt, der Marktwirtschaft zu stellen versucht hatte, zusätzlich in den folgenden Jahren zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. „Ach, wie schade! Über Herrn Krause wollen Sie auch nicht mehr reden, Herr Schäuble! Wie wäre es dann mit Herrn Rohwedder oder Frau Breuel, den ehemaligen Präsidenten der Treuhandanstalt, Sie wissen schon, die, die den letzten Rest an Vermögen verschleudert haben, das, was von der DDR noch übrig war, als all die Schalcks und Krauses mit ihr fertig waren.“
Sicher. Am Ende, seit mehr als fünfundzwanzig Jahren, stand und steht das einmalige Geschenk der Einheit, mit allem, was sie wem auch immer wie gebracht hat. Die vielen Milliarden, die in einer Art Raubrittermanier verloren gingen, als dem politischen Untergang der DDR der totale Ausverkauf folgte, störten damals schon niemanden wirklich. Eine reiche Nation kann eben auch reichlich Verluste verkraften, und was Kriminologen White Collar Crime nennen, besitzt für viele Politiker die Qualität, das Machbare zu erreichen. Gehörig mehr wiegt da schon der Verlust von Glaubwürdigkeit. So stehen all die Schäubles, Schalcks und Krauses nach wie vor eben auch für eine Kultur bewusst unterlassener Vergangenheitsbewältigung.
Zweifelsfrei. Schalck hat politischen Schutz genossen, und er genießt ihn noch heute. Wenn eines Tages die Archive des Bundesnachrichtendiensts und des Kanzleramts Einblick gewähren, nur dann können die fehlenden Kapitel einer genauso einzigartigen Vereinigungskriminalität geschrieben werden. Auslandsgeheimdienst und die Ämter für Verfassungsschutz wollen den Offizier der Staatssicherheit vor dem Zusammenbruch des Honecker-Regimes nicht begleitet haben. Wenn das zutreffen sollte, haben sie in einer Qualität versagt, die an Dilettantismus nie mehr zu überbieten wäre und postum jedem beteiligten Stasi-Offizier einen dicken Orden samt großzügiger Rente einbringen müsste.
„Keine Sorge, Herr Schäuble! Wir kennen sie alle. Wir haben das alles im Griff. Sie machen nur Geschäfte. Krumme zwar. Aber denen steht das Wasser bis zum Hals. Müssen wir eben auch mal beide Augen zukneifen.“ Nur so oder ähnlich blind werden alle Kanzleramtsminister und Koordinatoren in gleichem Amt gewesen sein, eingestielt durch die Regierung Schmidt und schließlich vollendet durch die Regierung Kohl. Für die Einheit Deutschlands haben die Deutschen schon viel, viel früher kräftig bezahlt. Und zwar alle.
Man mag anführen, dass mittlerweile offiziell alle rechtsstaatlichen Ermittlungsverfahren gegen Schalck abgeschlossen sind. Fünf Wochen saß er nach seiner Flucht in den Westen in der Moabiter JVA ein, freiwillig. Zwei Verurteilungen brachten ihm Haftstrafen von insgesamt etwas mehr als zwei Jahren ein, die aber zur Bewährung ausgesetzt worden sind. In seinen Memoiren „Deutsch-deutsche Erinnerungen“, die im Jahr 2000 veröffentlicht wurden, besticht der „Mann, der die DDR retten wollte“, auf bewährte Weise. Zu wichtigen Ereignissen schweigt er nach wie vor beharrlich, zu vielen anderen Vorwürfen entwickelt er in Teilen Schutzbehauptungen, in wieder anderen Bewertungen wird er bekannt peinlich. Anlässlich seines 80. Geburtstags 2012 würdigten ihn zwei Autoren in einer Darstellung des Verlags „Edition Ost“ gleichfalls in unverbesserlicher Art. Die Generation der alten Stasi- und Parteiseilschaften kann einfach nicht anders. Wer einst derart stramm stand und wie Schalck denen hinterher lief, die eine politische Überzeugung wesentlich mit Unrecht, Lug und Betrug zu realisieren versuchte, ist Zeit seines Lebens von seiner verzerrten Wahrnehmung der Realitäten unheilbar verblendet. Der große Bruder, der mit dem vielen Geld in der Tasche, hatte nichts anderes gewollt.
Bis auf dieses Vorwort und kleinere Korrekturen, die der Formatierung und neuerer Software geschuldet waren, ist diese politische Biographie unverändert geblieben. Sie entstand 1995. Damals schon bestimmten die Erstellung wesentliche Fragen übergeordneter Art. Warum fehlt wieder einmal eine politische Kultur, wahrhaftig die eigene Geschichte erzählen zu können? Warum all dieses Schweigen, all die Verblendung und all die Lügen? „Wo soll das bloß alles enden?“ fragte mich ein Begleiter dieser Darstellung nach der ersten Lektüre.
Schalck ist heute ein alter, kranker Mann, der noch immer in Rottach-Egern lebt. Auf dem Friedhof des Ortes liegt Franz Josef Strauß begraben, einer der Männer, der Schalck in den Wirren des Untergangs der Ostrepublik geschützt und geholfen hatte. So wird zumindest eine der Fragen beantwortet. Ein schwer gewichtiger Teil deutscher Vereinigungsgeschichte endet im Grab. Dort, wo alles endet.
Kairo, im Februar 2015
Matthias Rathmer