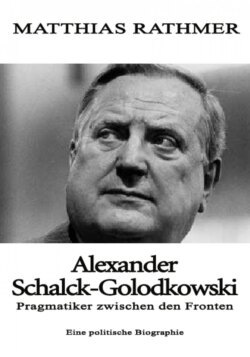Читать книгу Alexander Schalck-Golodkowski - Matthias Rathmer - Страница 12
Genosse und Tschekist
ОглавлениеSchalck durchlief, wie gesehen, bis zum Abschluss seines Studiums alle zur sozialistischen Erziehung installierten Organisationen: FDJ, Parteilehrjahr, GST und schließlich SED. Waren andere Jugendliche und junge Erwachsene beispielsweise nur in die GST eingetreten, um den Führerschein zu erwerben, tat es Schalck aus Überzeugung. Schalck ging niemals den Weg des geringsten Widerstandes, er übernahm Verantwortung, drängte sich bisweilen nahezu auf. Prägend und von entscheidender Bedeutung waren jene zwei Auslandsreisen nach Utrecht und Paris. Bis dato hatte er seine Umgebung als sozialistische Heilswelt begriffen, die im stetigen Kampf mit dem kapitalistischen Ausland stand. Die doppelte Staatsgründung verstand er als Resultat unterschiedlicher ideologischer Machtkonstellationen. Nun kam er direkt mit jenen in Berührung, die ihm im Staatsbürgerkundeunterricht als Klassenfeinde vorgestellt wurden. Neben dem illustren Ambiente und dem weltmännischen Flair faszinierte ihn erstmals vor allem die Bereitschaft, ideologische Ketten zu sprengen, wenn man ein gutes Geschäft machen konnte. Nicht Parteidiktionen führten Regie, sondern Absatz- und Umsatzzahlen. Die Gegensätze zu seinem System nahm er billigend an, vor allem reifte die Überzeugung, den Erzfeind im Westen, die verhasste Bundesrepublik, so zu schädigen, wie sie es seiner Meinung nach verdiente.
Schalck sah insbesondere zukunftsträchtige Handelspartner und Märkte, mit denen der Außenhandel das eigene Wirtschaftssystem stärken konnte. Als er ins MAI wechselte, war er ein studierter Ökonom. Er hatte alle sich bietenden Entwicklungsmöglichkeiten seines Staates genutzt und saß nun in verantwortungsvoller Position. Und er gehörte zur Führungselite seines gepriesenen Sozialismus. Der Parteisoldat Schalck dürfte dabei wie viele andere Mitglieder der Kaderpolitik auch Gedanken der Macht entwickelt haben, ideologischen genauso wie egoistischen Ursprungs. Nach wie vor trieb ihn der Ehrgeiz. Die realen Verhältnisse, d.h. die marode Binnenwirtschaft, uneffektive Außenwirtschaft, Bürokratismus und die Schwächen der Planung waren für den Praktiker alltäglich sichtbar.
Schalck wurde aus allen genannten Gründen also nicht - wie vielfach geschildert - frühzeitig aufgebaut, um diese wirtschaftlichen Defizite zu beheben. Er trat an, wie alle anderen Außenhändler auch, im Rahmen des Monopols Handel zu betreiben, mehr nicht. Immer noch leitete ihn die Ideologie. Zwar wurde ihm die Parteiarbeit zunehmend lästiger, doch er war gewillt, der einmal übernommenen Verantwortung gerecht zu werden. Parallel pflegte Schalck enge Kontakte zum MfS, zur HVA. Dies war ebenfalls keine besondere Variante Schalcks, sondern sozialistischer Alltag. Die meisten totalitären Systeme sahen und sehen in ihren außenwirtschaftlichen Beziehungen grundsätzliche Gefahrenmomente. In der DDR galt dies in besonderem Maße, da der „kapitalistische Nachbar" gleicher Nationalität war. Alle, die der Führungselite der Partei angehörten und zudem noch grenzüberschreitenden Aufgaben nachgingen, wurden überwacht. Der Führungsoffizier des MfS gehörte ganz einfach dazu, zur Kontrolle und Begleitung gleichermaßen. Ein Staat, dessen Führung soziale Gleichheit mit Unmündigkeit und Unterdrückung verwechselte, musste so handeln. Schalck indes faszinierten nicht ausschließlich die nachrichtendienstlichen Perspektiven, ihn begeisterten die Möglichkeiten, unter konspirativen Umständen schneller, effektiver und unkomplizierter arbeiten zu können. Der Handel, den das MfS mit Männern wie Fruck, Wischnewski und Goldenberg betrieb, blieb zunächst auf die Finanzierung der HVA und anderer MfS-Abteilungen beschränkt. Erst 1966 sollte Schalck dieses System auf die Devisenerwirtschaftung für die Partei und später auch für die leeren Valutakassen des Staatshaushaltes ausweiten. Dem MfS und seinen führenden Repräsentanten blieb Schalck jedoch im besonderen Maße verbunden. „Kaderpolitische Bedenken bestehen nicht", so begann Major Bücker seine Stellungnahme vom 26. September 1966, als Schalck durch die MfS- Hauptabteilung Kader und Schulung für seine bevorstehenden Aufgaben als KoKo-Leiter überprüft worden war. 59 Die Einschätzung des Kandidaten hätte besser kaum ausfallen können. „Genosse Schalk-Golodkowski gehört zu den Leitungskräften und Funktionären, die sich aufgrund ihrer Intelligenz und Fähigkeiten, eines wissenschaftlichen Studiums sowie politischer Überzeugung und Entwicklung, vom Arbeiter zu ihrer jetzigen Position kontinuierlich entwickelten. Auf seinem Fachgebiet als Diplomökonom gilt (er) als ausgezeichneter Kader mit guten politischen Qualitäten." 60
Schalck erfüllte die Kriterien, die ihn fortan als „Offizier im besonderen Einsatz" befähigten. „Durch langjährigen Kontakt zu den Organen des Ministeriums für Staatssicherheit und entsprechende aktive Mitarbeit für die Interessen desselben, konnte seine Zuverlässigkeit und Korrektheit festgestellt werden." 61 Zehn Tage zuvor hatte sich Schalck dem Ministerium verpflichtet. 62 Verband Schalck mit Fruck, Volpert, Libermann und Goldenberg schon in den Jahren vorher ein enger Kontakt, so wuchsen Intensität und Qualität seiner Verbundenheit mit dem Mielke-Ministerium von nun an mit jedem Auftrag, den er als KoKo-Leiter abwickelte.
Nahezu ehrfurchtsvoll blickte Schalck auf Erich Mielke, mit dem er nicht nur berufliche sondern auch private Probleme absprach. „Lieber Genosse Minister! Vorab auf diesem Wege möchten wir Ihnen recht herzlich dafür danken, dass wir die Möglichkeit haben im schönen Berghaus erlebnisreiche Urlaubstage zu verbringen. Wir betrachten diesen Urlaub als vorweggenommene Hochzeitsreise, da wir beabsichtigen am 13. September 1976 zu heiraten (zum zweiten Mal, d.A.). Diesen bedeutsamen Schritt haben wir uns reiflich überlegt und sind überzeugt, dass wir unser gemeinsames Leben erfolgreich meistern werden. Dabei wird uns, wie bisher, unsere gemeinsame Arbeit eine solide Grundlage sein. Ihre persönlichen Ratschläge und praktische Hilfe bei der Klärung unserer persönlichen Probleme haben uns sehr geholfen. Vielen Dank. Seien Sie gewiss, werter Genosse Minister, dass wir wie bisher alles in unseren Kräften stehende leisten werden, um die uns als Genossen und Tschekisten gestellten Aufgaben in Ehren zu erfüllen. In enger Verbundenheit (...)." 63
Der Brief, den Sigrid und Alexander Schalck ihrem Dienstherrn aus ihrem Urlaubsort geschickt hatten, landete geradewegs in die Kaderakte Schalcks. Er fühlte sich, durch alle ihm gewährten Prägungen gestärkt, als Tschekist, der im sozialistischen Verständnis einen „Angehörigen der außerordentlichen Kommission zum Kampf gegen Konterrevolution und Sabotage" bezeichnete. 1922, als die Tscheka durch die Staatliche politische Verwaltung (GPU) ausgetauscht und Stalin erster Generalsekretär der KP wurde, ersetzte man alle oppositionellen Kräfte durch zuverlässige, d.h. dem Politbüro genehme Sekretäre. Als ein solcher empfand sich Schalck, und er wusste, dass Mielke solche Zeilen gerne las.
Nachdem Schalck im September 1983 fast siebzehn Jahre lang seine absolute Verlässlichkeit unter Beweis gestellt hatte, da beförderte ihn Erich Mielke persönlich inoffiziell in den Rang eines Generals. „Der Offizier im besonderen Einsatz (...) wäre aufgrund seiner außerordentlichen Verdienste und Leistungen zum 34. Jahrestag der Gründung der DDR zur Ernennung zum Generalmajor eingereicht worden. Unter Berücksichtigung der besonderen Tätigkeit ist die Ernennung (...) gegenwärtig nicht möglich." 64 Innerhalb der MfS-Hierarchie war Schalck zum General ernannt worden, offiziell aber hat er diesen Titel nicht geführt. Mit der Ernennung zollte Erich Mielke seinen persönlichen Respekt gegenüber einem erfolgreichen Mitarbeiter.
Schalck galt von Beginn als loyal, gewissenhaft und präzise. In seinem familiären Umfeld sollte sich dies indes mit seinem Aufstieg in die Nomenklatura ändern. Seine soziale Integration genügte dem Außenhändler nicht mehr. Er hatte die Welt außerhalb der Postulate von Gleichheit und Bescheidenheit kennen gelernt. Schalck begann damit, sein Leben unter den kleinlichen, für ihn oftmals beengten Verhältnissen abzulegen. Äußeres Zeichnen dafür war die Trennung von seiner ersten Frau. Selbstbewusst genug, um zu wissen, dass Standesdünkel innerhalb der regierenden Kreise der Parteifunktionäre sehr wohl den ein oder anderen Vorteil brachten, suchte er fortan zu jenen freundschaftliche Kontakte, die ihn auch in seinem beruflichen Umfeld begleiteten. Er war fest entschlossen, den einmal erworbenen Status zu festigen. Je höher Schalck aber in den folgenden Jahren aufstieg, desto distanzierter wurde die Bindung zu seiner Frau, zu seiner Familie. Namen und Titel von Bekannten und Freunden, mit denen ihr Mann verkehrte und die im Partei- und Staatsmedium „Neues Deutschland" Beachtung fanden, waren Magarethe fremd. Auf die höheren Ansprüche ihres Mannes dürfte sie sich nicht mehr eingestellt haben und der bedürfnislose Habitus seiner Ehefrau mag für den mächtigen Schalck nicht mehr zeitgemäß gewesen sein. Längst schon bewunderten auch andere, jüngere und attraktivere Frauen den Genossen Schalck.
1965 lernte Schalck seine zweite Frau kennen, Sigrid Gutmann, Tochter der ehemaligen stellvertretenden Oberbürgermeisterin der DDR-Hauptstadt Berlin, Johanna Blecha und geschiedene Gattin des Leiters des Presseamtes beim Ministerpräsidenten Grotowohl, Kurt Blecha. Sigrid Gutmann arbeitete im Handelsunternehmen „Union", das Metallwaren und Sportartikel im- und exportierte. Sie verkaufte in der DDR produzierte Paddelboote. Schalck brachte sie schließlich in der Protokollabteilung des Außenhandelsministeriums unter, als Kollegin der Ehefrau von Harry Schutt, jenem Mann, der im Auftrag von Markus Wolf Agenten in die westlichen Geheimdienste entsandte. Später wurde Sigrid Gutmann als „wissenschaftliche Mitarbeiterin" in den unmittelbaren Wirkungskreis Schalcks versetzt und war bis zum Mauerfall für die Ausstattung der SED-Bonzensiedlung Wandlitz mit westlichen Konsumgütern aller Art verantwortlich. Erst 1975 ließ sich Schalck auf Drängen seiner Geliebten scheiden. Der sonst so zielstrebige Schalck war in seinem familiären Umfeld und seiner väterlichen Verantwortung über Jahre hinweg entschlusslos. Zuneigung und Fürsorge schenkte er seiner Familie von da an vornehmlich nur noch in Form von Bargeld, Autos, Wohnungen, Datschen und anderen materiellen Vergünstigungen.
Schalck glaubte mit Beginn seines Aufstiegs an das sozialistische System. Er war insbesondere ein Mann des in der DDR herrschenden Kommunismus in den Strukturen seiner Partei. Mit seinem eigenen Fortkommen besaß er gleichzeitig frühzeitig tiefe Einblicke in die Wahrheiten dieser deutschen Prägung eines Arbeiter- und Bauernstaates. Rasch wurde ihm klar, dass das DDR-System, vor allem dessen marode Volkswirtschaft, nicht ohne die Hilfe und Kooperation der ökonomisch überlegenen Bundesrepublik und anderer Nationen des Kapitalismus würde existieren können. Selbstbewusst, gewissermaßen zum Trotz, aus Gehorsam, Verpflichtung und eigenen Vorteilsnahme gleichermaßen, trat Schalck seine Aufgaben an.
So erinnerte sich der ehemalige Leiter des rechtswissenschaftlichen Forschungsinstituts, Wolfgang Seiffert: „Schalck, den ich bis dahin nie gesehen hatte, empfing mich leutselig. Ich heiße Schalck. Wer mich kennt, nennt mich Millionen-Schalck. Denn ich verschaffe der DDR die Millionen, die sie braucht, die aber das Planwirtschaftssystem nie zustande bringt." 65 Das Versagen der Planwirtschaft in der DDR wurde Schalcks Bestandsgarantie, und entgegen seines Wissens hielt Schalck an dem real existierenden Sozialismus fest. Als späterer KoKo-Leiter und Außenhändler sollte er sich kapitalistischer Methoden bedienen, um den darbenden Sozialismus der SED zu stärken. Und Schalck wäre nicht Schalck, wenn er damit nicht auch seinen persönlichen Aufstieg verknüpft hätte.