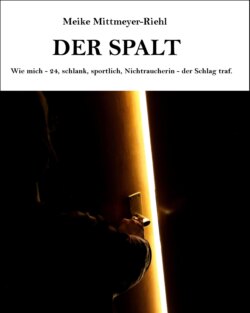Читать книгу Der Spalt: Wie mich – 24, schlank, sportlich, Nichtraucherin – der Schlag traf. - Meike Mittmeyer-Riehl - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3 : Glück? Was ist denn Glück?
Оглавление„Here am I floating round my tin can
Far above the moon
Planet earth is blue
And there's nothing I can do ”
David Bowie – „Space Oddity“5
Die Nacht war sehr unruhig. Jede Stunde kam jemand in mein Zimmer, um zu schauen, ob ich noch lebte. Man leuchtete mir in die Augen, maß Blutdruck. Dabei hätte irgendeines der Geräte, an die ich angeschlossen war, sicherlich angefangen zu piepsen, sobald mein Herz stehenbleibt. Aber wahrscheinlich ist das üblich auf der Schlaganfall-Station. Sicher ist sicher.
Die unruhige, schlaflose Nacht bot mir also immerhin ein paar Gelegenheiten zum Nachdenken. Ich muss immer noch unter Schock gestanden haben, denn ich fühlte eigentlich gar nichts. Ganz sachlich, ich würde sagen, fast wissenschaftlich – ja, eigentlich so, wie ich auch an die Recherchen meiner Diplomarbeit zwei Jahre zuvor herangegangen war – analysierte ich die Geschehnisse des vergangenen Tages. Versuchte, mir einen Reim auf die schreckliche, aber für mich in diesem Moment völlig ungreifbare Diagnose zu machen.
Ich rekapitulierte den Tag: Weil es der erste schöne Frühlingstag gewesen war, hatten Dennis und ich beschlossen, Tennis zu spielen. Ich war erst am Abend zuvor von einer Schulung für Volontäre (ich war seinerzeit Volontärin, also auszubildende Redakteurin bei unserer regionalen Tageszeitung) in Bonn zurückgekommen. Es war Dennis‘ Geburtstag, darum waren wir abends bei unserem Lieblingsitaliener essen gegangen und unser beider Lieblings-Fußballmannschat, Eintracht Frankfurt, hatte auch noch gewonnen. Es war ein perfekter Start ins Wochenende. An dem Samstag waren wir dann auf den Tennisplatz gefahren, mit den Rädern, wie immer. Ich spielte seit rund zwei Jahren, Dennis schon länger. Ich war nicht berauschend gut, hatte aber schon eine Begabung, denn ich lernte schnell. Wir hatten ganz normal angefangen zu spielen.
Und irgendwann, bemerkte ich nun bei meinen nächtlichen Analysen, hatte ich ein Stechen im Hals gespürt. Ich weiß noch ganz genau, dass mich das eine Sekunde lang irritierte. Dazu kamen leichte Schmerzen im Hinterkopf. „Vielleicht brüte ich eine Erkältung aus“, dachte ich mir. Als dann auch noch etwas Benommenheit dazukam, war die Sache für mich klar. „Mir ist nicht so gut“, sagte ich zu Dennis, „lass uns aufhören.“ Vielleicht hatte ich mir bei der Schulung in Bonn etwas eingefangen. Oder es war der Wetterumschwung. Wir fuhren mit den Rädern zurück zu Dennis‘ Eltern.
Als ich mir vor dem Haus die Schuhe auszog, fühlte ich mich komisch. So seltsam hatte ich mich bei einer anfliegenden Erkältung noch nie gefühlt, konstatierte ich rückblickend. Das Gefühl, nicht mehr so ganz im eigenen Körper drinzustecken, das ich bereits im ersten Kapitel beschrieben habe, nahm hier seinen Ursprung. Rückblickend weiß ich auch, dass ich zu diesem Zeitpunkt bereits Sprachschwierigkeiten hatte, obwohl Dennis da noch nichts auffiel. Es bereitete mir einfach unglaubliche Schwierigkeiten, einen normalen Satz auszusprechen. So, als hätte ich zu viel Alkohol getrunken und lallte. Ich musste mich auf jede einzelne Silbe konzentrieren. Völlig ungewöhnlich für mich. Eigentlich hätte ich schon längst Alarm schlagen und Dennis um Hilfe bitten müssen. Aber ich behielt meine seltsamen Gefühle für mich und beschloss, gleich nach Hause zu fahren und mich hinzulegen. „Dusch doch wenigstens noch hier“, sagte Dennis.
Wie dann alles ausging, wisst ihr schon. Gott sei Dank folgte ich seinem Rat und stieg nicht, wie eigentlich beabsichtigt, ins Auto. Nicht auszumalen, was passiert wäre, hätte die Lähmung am Steuer eingesetzt.
War das also wirklich ein Schlaganfall gewesen? Es passte vieles zusammen: die Kopfschmerzen, die Sprachstörung, die Benommenheit, die Lähmung. Und später im Krankenhaus, so wurde mir erst jetzt klar, hatte ich auch eine leichte (aber vorübergehende) Sehstörung. Das bemerkte ich erst, als ich irgendwo zwischen CT und MRT auf einem weißen Krankenhausflur lag und die Wand anstarrte. Da entdeckte ich nämlich plötzlich einen kleinen Regenbogen. Ich blinzelte und schaute nochmal hin, aber der Regenbogen war nicht etwa auf die Wand aufgemalt. Er bewegte sich, wenn ich die Augen bewegte. Auch eine Folge einer Unterversorgung des Gehirns, wie mir klar wurde.
Und dieses Stechen im Hals, das musste der Moment gewesen sein, in dem sich meine Ader aufspaltete. Aber warum? Und so vieles passte auch wiederum nicht zur Diagnose Hirninfarkt. Es konnte einfach nicht sein. Ich war jung und gesund, schlank und Nichtraucherin, hatte weder hohen Blutdruck noch zu hohe Cholesterinwerte, und war gestern noch putzmunter über den Tennisplatz gerannt. Es war unmöglich. Und doch war es wahr. Aber das begriff ich nicht. Phase zwei, die Schockstarre, hatte mich fest im Griff.
*
Am Morgen war ich so ausgelaugt und hungrig, dass ich mich richtig freute, als eine Frau mein Zimmer betrat, die einen winzigen Becher Apfelmus dabei hatte. Endlich Essen!
„Hallo Frau Mittmeyer“, sagte die Frau, die übertrieben deutlich sprach – sie betonte jeden einzelnen Buchstaben. Ihre Begrüßung klang also eigentlich eher wie „H-a-l-l-o F-r-a-u M-i-t-t-m-e-y-e-r“. Und weiter: „Ich bin Logopädin und möchte mit Ihnen ein paar Übungen machen.“
Ich setzte mich in meinem Bett auf und sah sie verwirrt an. Sie sprach mit mir, als wäre ich entweder ein Kleinkind oder minderbemittelt. Sie fragte mich, welches Datum wir hätten – „gestern war der 17., also ist heute der 18. März“, sagte ich. „Und welches Jahr?“ – „2012“, antwortete ich, nun noch mehr befremdet. Was glaubte die eigentlich, was mit mir los war? Wollte sie mich veräppeln? Zu der Zeit war mir immer noch nicht so ganz klar, wie schwer meine Erkrankung wirklich war. Ich fühlte mich blendend, wurde aber behandelt wie ein Todkranker.
Dann kam noch die Frage nach meinem Geburtsdatum. „11. April 1987“, sagte ich und kam mir vor wie im Kindergarten. Und endlich kam der Apfelmus-Becher zum Einsatz. „Probieren Sie, ob Sie schlucken können“, sagte die Logopädin, immer noch überdeutlich, obwohl sie so langsam begriffen haben musste, dass ich alles verstand und flüssig sprach. Ich riss den Becher auf und stieß gierig den Löffel hinein. Die Logopädin musterte mich, während ich den ersten Mundvoll hinunterschluckte. „Das klappt ja gut“, sagte sie. Danach bekam ich endlich ein richtiges Frühstück, sogar mit Kaffee. Ich fühlte mich wie im Himmel. Kurzzeitig wenigstens.
Ich weiß nicht mehr genau, wann das erste Mal an diesem Tag ein Arzt kam, um nach mir zu sehen. Was ich aber noch ganz genau weiß, ist, was ich ihn als erstes gefragt habe. Es war: „Kann ich in sieben Wochen in die USA fliegen?“ Das klingt jetzt ziemlich schräg, ich weiß. Dazu müsst ihr aber wissen, dass Dennis, ich und zwei gute Freunde bereits seit Monaten unsere dreiwöchige Reise in den Wilden Westen der USA geplant hatten. Wochenlang hatte ich die schönsten Ziele entlang der Route Denver – Rocky Mountains – Grand Canyon – Las Vegas – Salt Lake City – Yellowstone Nationalpark – Denver herausgesucht. Mietwagen und Flüge waren gebucht. Es sollte der erste gemeinsame Urlaub von uns vieren werden, einer aus unserer Truppe war sogar noch nie zuvor in den USA gewesen.
Und ich weiß, es ist komisch, denn eigentlich müsste ich im Krankenhaus mit einer so gravierenden Diagnose ganz andere Probleme haben, könnte man meinen. Aber ich klammerte mich derartig an dieser Reise fest und wollte sie so unbedingt antreten, dass ich gar keinen Platz für irgendwelche anderen Probleme hatte. Alles drehte sich darum, schnellstmöglich hier rauszukommen und in die USA fliegen zu können. Wenn ich diese Reise nicht antreten konnte, dann fühlte sich das so an, als wäre ich an dem ersten schönen Frühlingstag im März doch gestorben.
Der Arzt, ein sehr freundlicher, gesprächiger Typ, der aber kaum Zeit hatte, war von meiner Frage komischerweise gar nicht überrascht. Andere Ärzte hätten mich vielleicht entsetzt angeschaut und so etwas gesagt wie: „Das können Sie vergessen.“ Und es gab später in der Rehaklinik auch Ärzte, die mir dringend von der Reise abrieten. Denn allein schon ein so langer Flug nach einem akuten Schlaganfall stellt eigentlich ein erhebliches Risiko dar. Aber es war mein Glück, dass ich an einen sehr optimistischen, lebensfrohen Mann geraten war, der sich, so kam es mir zumindest vor, richtig darüber freute, dass ich Ziele hatte. „Na klar“, sagte er, als hätte ich nur einen Schnupfen, „das kriegen wir hin.“
Er erklärte mir in aller Kürze, was bei mir den Hirninfarkt ausgelöst hatte. Und bei ihm klang es, als sei das etwas ganz Alltägliches: der Riss in meiner Halsschlagader nennt sich spontane Dissektion. Betroffen war bei mir die Arteria Carotis Interna, also eine der wichtigsten Arterien im Hals, die das Gehirn mit Blut versorgen.
Kurz zum anatomischen Hintergrund: Die Hauptschlagader unseres Körpers, die Aorta, führt nicht als ein dicker Schlauch direkt ins Gehirn, sondern spaltet sich im Wesentlichen in vier wichtige hirnversorgende Halsschlagadern auf: die Arteria Carotis Interna links und rechts sowie die Arteria Vertebralis links und rechts. Das Wort Riss ist, obwohl es so schön anschaulich ist, eigentlich nicht ganz richtig: Ihr dürft euch das Ganze nicht so vorstellen, dass das Gefäß aufgerissen ist und Blut aus der Wunde austrat.
Die spontane Dissektion spielt sich innerhalb eines Gefäßes ab. Ich werde im Laufe meines Berichts trotzdem immer mal das Wort „Aderriss“ verwenden, das als Synonym für „spontane Dissektion“ verstanden werden sollte.
Abbildung 1: Bei einer Dissektion der Arteria Carotis interna „klappt“ die Mittelwand des Gefäßes nach innen um, in der Folge entsteht ein Hämatom, das den Blutdurchfluss einschränkt oder gänzlich stoppt. © Mit freundlicher Genehmigung von Karl C. Mayer, www.neuro24.de
Bei einer spontanen Dissektion ist es nun so, dass die innere Wand des Gefäßes – aus Gründen, die bis heute nicht geklärt sind – aufgespalten wird, so als würde man einen Reißverschluss öffnen. Durch diese Aufspaltung entsteht eine Art „Sackgasse“ zwischen innerer und mittlerer Gefäßwandschicht, in die nun Blut einströmt. Es entsteht ein Hämatom, also ein blauer Fleck (siehe Abbildung 1).
Das ist zwar eine ganz normale Reaktion des Körpers, innerhalb eines Gefäßes kann davon aber eine tödliche Gefahr ausgehen: Das Hämatom wirkt wie ein Stöpsel, der den Blutfluss durch die Ader erheblich einschränkt oder sogar ganz stoppt. Außerdem kann das Blut an der Stelle der Verletzung gerinnen, dadurch bildet sich ein Thrombus, der sich ablösen und weitere Hirngefäße verstopfen kann. Genau das war bei mir geschehen. Das Gehirn bekommt dann nicht mehr genügend Sauerstoff: Neurologische Ausfallerscheinungen wie Seh- oder Sprachstörungen (je nachdem, welche Hirnabschnitte betroffen sind) oder im schlimmsten Fall eben ein lebensgefährlicher Schlaganfall sind die Folge. Um die Verstopfung meines Gefäßes möglichst schnell wieder aufzuheben, war es so wichtig gewesen, dass ich rasch an einen Tropf mit Blutverdünnern angeschlossen wurde und diese auch weiterhin intravenös bekam (zu der Zeit Heparin).
Dieses Medikament verhindert, dass das Blut allzu schnell gerinnt. Der Nachteil ist, dass Wunden logischer Weise stärker und länger bluten. Das bewirkt nicht nur, dass man unter Einnahme dieser Medikamente oft dicke blaue Flecken hat, die nur langsam wieder verschwinden, sondern dass es auch zu schweren inneren Blutungen kommen kann.
Eine Operation an dem Gefäß sei nicht nötig, schilderte der Neurologe weiter. Die Ader musste von selbst wieder ausheilen, im Idealfall würde sich das Hämatom zurückbilden und das Blut wieder ungehindert fließen. In bis zu 90 Prozent der Fälle passiert das auch innerhalb von Monaten oder Jahren, wie ich später bei meinen eigenen Recherchen herausfand. Bei zwei Drittel der Patienten mit Karotisdissektion bleibt jedoch eine Ausstülpung, also ein kleines Aneurysma, zurück.6
Dass mein Gehirn eine Zeit lang von der Sauerstoffversorgung abgeschnitten war, war auf den CT-Aufnahmen ganz eindeutig zu erkennen, erklärte mir der Arzt weiter. Hinweise auf eine Hirnblutung gab es aber keine. Somit hatte ich – „mit sehr, sehr viel Glück“, wie er gleich betonte – keine bleibenden Schäden davongetragen. Vor allem auch dank meines Alters. Denn mein junger Körper hatte es offenbar schnell genug geschafft, die Blutversorgung des Gehirns über andere Wege sicherzustellen. Auf diese Weise war meine rechte Hirnhälfte nur sehr kurz unterversorgt gewesen, darum hatte auch die Lähmung auf der linken Körperseite nur wenige Sekunden angehalten.
Jugend allein schützt allerdings ganz und gar nicht vor gravierenden Auswirkungen eines Schlaganfalls: bleibende Lähmungen, schwere körperliche oder geistige Behinderungen oder im schlimmsten Fall der Tod können auch bei sehr jungen Patienten die Folge sein – wenn sie es nicht schnell genug in ein Krankenhaus mit Stroke Unit schaffen.
Glück hatte ich also vor allem deshalb gehabt, weil mir schnell genug geholfen wurde. Ich hatte es Dennis, der den Ernst der Lage sofort erkannte, den besonnen Rettungsassistenten des Deutschen Roten Kreuzes und dem schnellen Handeln der Neurologen in der Stroke Unit Darmstadt zu verdanken, dass ich diesen Hirninfarkt so unglaublich glimpflich überstanden hatte. Die Rettungskette hatte vorbildlich funktioniert - selbstverständlich ist das nicht immer.
„Aber warum ist das passiert?“, fragte ich meinen Arzt, als er mir die Hintergründe erklärt hatte. „Und warum mir?“ Er schüttelte nur leicht den Kopf. „Es ist immer noch nicht genau geklärt, warum das passiert“, sagte er. Es sei möglich, dass ich beim Tennisspielen eine ruckartige Bewegung mit dem Kopf gemacht hatte, vielleicht bei einem Sturz. Ob ich denn gestürzt sei? „Kann schon sein“, sagte ich, „aber nicht besonders schlimm.“ Ich begann zu grübeln, und der Arzt lächelte mir aufmunternd zu. „Sie haben sehr, sehr viel Glück gehabt“, brachte er es noch einmal auf den Punkt.
Tennis war für mich ab jetzt jedenfalls Geschichte. Weil man zumindest davon ausgehen musste, dass ich irgendeine Art von Schwachstelle an den Gefäßwänden haben könnte, bekam ich sozusagen eine lebenslange Sperre. Ich wäre aber auch ehrlich gesagt nicht im Traum auf die Idee gekommen, noch einmal den Schläger in die Hand zu nehmen, nach allem, was passiert war. Allein der Gedanke daran ließ mich schaudern. Auch alle Kontaktsportarten wie Fußball, Handball oder Kickboxen waren für mich nun gestorben. Ab sofort durften es nur noch sanfte Sportarten wie Schwimmen, Walken und Tanzen sein. Ich nahm dieses Sportverbot ziemlich emotionslos hin.
Einen kleinen Stich in der Magengegend versetzte es mir nur, als der Arzt hervorhob, dass natürlich auch Achterbahnen ein absolutes Tabu seien. Ich liebe Achterbahnen. Und ich bin schon mein ganzes Leben lang gern die höchsten, schnellsten und wildesten Achterbahnen gefahren. Nie war etwas passiert. Warum denn ausgerechnet jetzt? Und warum bei einem harmlosen Tennisspiel? Der vielbeschäftigte Arzt ließ mich grübelnd allein zurück.
Wie viel Glück ich an diesem 17. März 2012 tatsächlich gehabt hatte, wurde mir erst sehr, sehr viel später klar. Denn das Wörtchen Glück sollte in den kommenden Tagen, die ich noch auf der Stroke Unit verbringen musste, für mich erst mal zu einem Fremdwort werden. Von diesem Tag an ging es stetig bergab.