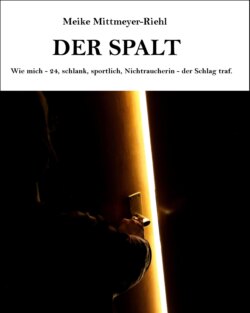Читать книгу Der Spalt: Wie mich – 24, schlank, sportlich, Nichtraucherin – der Schlag traf. - Meike Mittmeyer-Riehl - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 5 : Tschüss, Klinik
Оглавление„ One day your life will flash before your eyes.
Make sure it's worth watching . ”
Gerard Way 9
Wenn euer Leben eines Tages wie ein Film vor euren Augen abläuft, was für Szenen werdet ihr dann sehen? Habt ihr euch darüber schon mal ernsthaft Gedanken gemacht? Ein Schicksalsschlag macht diesen Film eures eigenen Lebens plötzlich auf unheimliche Art und Weise real. Es ist, als hättet ihr die ganze Zeit über nur in einer künstlichen Scheinwelt gelebt, und auf einmal seht ihr die Kameras um euch herum, die euch auf Schritt und Tritt aufzeichnen. So wie in der „Truman Show“, falls ihr den Film kennt. Euch wird schlagartig bewusst, dass die Aufnahmekapazität dieser Kameras begrenzt ist. Und dass es noch so viele tolle Szenen gibt, die ihr unbedingt einfangen wollt. Nur leider wisst ihr eben nicht genau, wie viel Speicherplatz ihr noch habt.
Mich zwang die Krankheit regelrecht dazu, mein Leben gedanklich zurückzuspulen und die Szenen zu rekapitulieren, die irgendwann einmal meinen Film ergeben. Und ich muss sagen, da waren schon etliche Szenen dabei, die mir eines Tages beim Zuschauen sehr, sehr viel Spaß machen werden. Aber leider gibt es natürlich auch die anderen Szenen, bei denen mir das Hinschauen schwerer fallen wird; Szenen, die ich vielleicht sogar lieber rausgeschnitten hätte, die aber eben nun mal genauso zu meinem Leben gehören wie die gelungenen. In den einsamen Nächten während meines Krankenhausaufhalts ließ ich einige dieser Szenen in meinem Kopf ablaufen.
„Dies ist kein Ort zum Sterben“: So begann ich einmal einen Reisebericht über die wunderschöne Küstenregion von Khao Lak in Thailand. Ich war dort auf einer Pressereise und schrieb eine Reportage für die Reise-Seiten unserer Zeitung über die Folgen des verheerenden Tsunamis genau sieben Jahre zuvor. Ziemlich verrückt an der ganzen Sache war, dass die Reise nur drei Tage dauerte.
Ich flog also über zwölf Stunden um den halben Erdball, um nur 72 Stunden dort zu bleiben. Aber ich erinnere mich auch heute noch so gern und lebhaft an die Zeit, dass sie mir im Nachhinein viel länger vorkommt. Vielleicht gerade weil die Reise so kurz war, erlebte ich sie so intensiv. Jedenfalls kam ich nach der langen Anreise logischer Weise ziemlich erschöpft am Hotel am Khuk Khak Strand an – diese Müdigkeit war aber sofort verflogen, als ich mein Zimmer betrat: Es kam mir eher wie der Raum einer kleinen Villa vor, mit glänzendem schwarzen Boden, einem riesigen Himmelbett, edlem, rundum verglastem Bad und einer eigenen Terrasse.
Ich bin beileibe kein Luxusurlauber und wohne in fremden Ländern viel lieber in kleinen, familiären, landestypischen Unterkünften, in denen man auch wirklich noch mit Einheimischen in Kontakt kommen kann. Aber diese Reise war eben auch für mich eine außergewöhnliche – und ich hatte noch nie zuvor in einem solchen Luxus-Zimmer wohnen dürfen. Ich fühlte mich, als hätte ich für diese kurzen drei Tage das Leben eines anderen ausgeliehen. Wir machten an diesem Anreisetag noch einen Ausflug in den Nationalpark ganz in der Nähe, schipperten in Bambus-Booten über einen Fluss, sahen vom Speedboot aus den berühmten James-Bond-Felsen und aßen abends direkt am Strand die köstlichsten Meeresfrüchte und Reisgerichte.
Das Schönste jedoch – und das ist auch der Grund, warum ich diese Szene hier überhaupt schildere – war ein Moment in der Abenddämmerung, ein kurzer Augenblick nur, der damals so schnell vorüberzog wie eine Wolke, der sich aber tief in mein Gedächtnis und mein Herz eingegraben hat: Zusammen mit fünf oder sechs anderen Journalisten aus der Gruppe beschloss ich, zwischen Rückkehr vom Ausflug und Abendessen schnell noch ins Meer zu springen. Das musste einfach sein. Wir zogen uns also rasch um (die Sonne war bereits am Untergehen und jeder, der schon mal in der Nähe des Äquators war, weiß, wie schnell das dort geht) und gingen, nein, rannten in den Badewannen-warmen, klaren, stillen Indischen Ozean.
Es war unvorstellbar, dass sich dieses Wasser vor genau sieben Jahren in eine todbringende, monströse Flutwelle verwandelt und Tausende in den Tod gerissen hatte. In diesem Moment dachten wir auch gar nicht an diesen Anlass unserer Reise. Wir, sechs oder sieben erwachsene Zeitungs-Journalisten, rannten kreischend und spritzend wie Kinder ins Meer, das sich in der untergehenden Sonne wie ein riesiger, rosa glitzernder Teppich vor uns ausbreitete. Nichts anderes existierte für mich in diesem Moment, ich war einfach nur glücklich.
Das war zweifellos einer der schönsten Tage in meinem Leben. Einer dieser Tage, bei denen man jetzt im Nachhinein fast bereut, sie nicht noch mehr genossen zu haben. Einer dieser Tage, die einen so glücklich machen, dass man bei der Erinnerung daran fast weinen muss: Zum einen aus Freude, aus Dankbarkeit, sie erlebt haben zu dürfen. Zum anderen aber auch aus Traurigkeit, weil man in den dunklen Momenten des Lebens ernsthaft daran zweifelt, je wieder so glücklich sein zu können. Als gäbe es jetzt anstelle von warmem Meerwasser nur noch kalte Schwärze. So jedenfalls kam es mir vor, als ich verkabelt auf der Stroke Unit des Klinikums lag und in den einsamen Nächten rein gar nichts hatte, das mich von meinen trüben Gedanken ablenken konnte.
Nicht gerade besser machte meine Situation die Tatsache, dass Maria an einem der nächsten Tage Besuch von ihren erwachsenen Kindern bekam. Ihr Sohn war ungefähr in meinem Alter, vielleicht ein paar Jahre älter, die Tochter ebenfalls. Ich hörte nicht zu, worüber die drei redeten, ich war viel zu sehr damit beschäftigt, mich meinem Leid zu ergeben. Es ging mir wirklich hundsmiserabel. Ich bekam nur mit, dass Marias Sohn die ganze Zeit ziemlich besorgt auf sie einredete.
Irgendwann, ich weiß nicht genau, wie lang die beiden Besucher schon da waren, bat ich eine Pflegerin um Hilfe. Die Natur meldete sich nämlich zu Wort, sprich: ich musste mal. Die Pflegerin reichte mir prompt die Bettpfanne, vor der es mir schon graute, wandte sich dann aber zunächst an die Besucher im Zimmer: „Ähm, entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mal kurz rausgehen?“, sagte sie ziemlich barsch. Es war eindeutig keine Frage. „Warum denn?“, wollte Marias Sohn wissen.
„Weil wir hier noch eine andere Patientin im Zimmer haben“, fuhr die Pflegerin ihn an und gestikulierte in meine Richtung. Die Situation war eigentlich ziemlich witzig, ich hätte gelacht, wenn mir nicht so sehr zum Heulen zumute gewesen wäre und ich mich nicht so unfassbar geschämt hätte mit meiner Bettpfanne in der Hand. „Ach so“, sagte der Sohn kleinlaut und verließ mit seiner Schwester das Zimmer.
Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass nach dieser kleinen Szene – und während ich genau wusste, dass die Besucher vor dem Zimmer nur darauf warteten, dass ich fertig war – gar nichts mehr lief. Ich gab der Pflegerin die Bettpfanne also unverrichteter Dinge zurück und weinte dabei. Als Marias Besuch wieder hereinkam, fühlte ich mich noch kränker, wenn es überhaupt noch eine Steigerung geben konnte. Und so unbeschreiblich hilflos.
Ich schämte mich so sehr und schäme mich noch heute, während ich das hier schreibe. Aber ich will es schreiben und ich will es euch sagen, auch wenn ihr es vielleicht gar nicht so gern hören wollt. Denn es gehört zu meiner Geschichte.
*
In den drei Tagen nach der Angiografie hatte ich eindeutig meinen Tiefpunkt erreicht. Ich wusste nicht, wie es noch weiter bergab gehen konnte, aber genauso wenig konnte ich mir vorstellen, dass es jemals wieder bergauf gehen könnte. Aber zum Glück ging es bergauf. Bald sogar ziemlich rasant. Nachdem die vier Tage strikte Bettruhe auf dem Rücken vorüber waren, überbrachte mir ein Arzt die frohe Botschaft, dass ich wieder aufstehen dürfe, um auf die Toilette zu gehen.
Nicht nur das, ich durfte sogar, begleitet vom Krankenhaus-eigenen Physiotherapeuten, ein wenig auf dem Flur auf- und abgehen. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass einen etwas so Banales in ein wahres Hochgefühl versetzen könnte, aber es war so. Ich glaube, mir liefen sogar ein paar Freudentränen über die Wangen, während ich ging; mich ganz bewusst auf meine Schritte konzentrierte, mein Gewicht spürte und den sanften Luftzug im Gesicht, der durch die Bewegung entstand. Noch nie zuvor hatte ich meinen Körper so bewusst gespürt, hatte gemerkt, dass ich ein Herz hatte, das schlug, und Beine, die mich trugen. Auch der Physiotherapeut war zufrieden mit mir.
Ein paar Tage später begleitete ich ihn in den Keller der Klinik, wo ich ein paar Runden auf dem Ergometer drehen durfte. Das Radeln war anstrengend, obwohl ich ein sehr sportlicher Typ bin. Was nur noch ziemlich nervte, war der Tropf, den ich ständig mit mir herumtragen musste, denn ich bekam die Blutverdünner ja immer noch in flüssiger Form. Ich musste ständig einen kleinen Koffer mit mir herumschleppen. Aber besser das als ans Bett gefesselt zu sein.
In meiner zweiten Krankenhaus-Woche durften meine Zimmernachbarin Maria und ich die Stroke Unit verlassen. Wir wurden auf ein normales Zimmer in der Neurologie verlegt und bekamen wieder eines zusammen. Ich werde nie vergessen, was das erste war, das Maria sagte, als wir unser neues, nur geringfügig schöneres (aber immerhin mit einem Fernseher ausgestattetes) Zimmer bezogen hatten: „Jetzt muss ich erst mal eine rauchen.“ Es war mir unbegreiflich, wie sie – kurz nach einem kleinen Schlaganfall! – auch nur ans Rauchen denken konnte. Aber ich kann so oder so nicht nachvollziehen, wie Raucher denken, darum ist es müßig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen.
Ich genoss es, TV schauen zu können und mit Dennis, meinen Eltern oder anderen Besuchern kleine Runden über das Klinikgelände drehen zu dürfen. Es war immer noch sehr schönes Wetter und wir konnten das eine oder andere Mal draußen auf einer Bank in der Sonne sitzen. Es ging mir gut in diesen Momenten.
Aber gleichzeitig war mir auch klar, dass ich vieles nur verdrängte. Dass ich mich regelrecht weigerte, mich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie man Leben künftig aussehen würde. Nicht nur mein Leben nach, sondern mit der Krankheit. Das ist ein feiner, aber bedeutender Unterschied. Ich glaubte noch, nein, war fest davon überzeugt, ich käme bald aus dem Krankenhaus raus und könnte wieder in die Hülle meines alten Lebens schlüpfen, die ich zuhause zurückgelassen hatte und die dort geduldig auf mich wartete. Dass ich einfach weitermachen könnte wie vorher, als sei nichts geschehen. Aber so funktioniert das leider nicht. Noch konnte ich das nicht erkennen, ich war ja schließlich noch in Phase zwei gefangen: der Schockstarre.
*
Weil ich mich so sehr auf eine schnelle Rückkehr in mein altes Leben versteifte, war ich sichtlich überrascht, als mir irgendwann in der zweiten Krankenhauswoche nahe gelegt wurde, einen Antrag auf eine Rehabilitation zu stellen. Im ersten Moment wehrte ich mich vehement dagegen. Rehabilitation – wovon denn? Ich war endlich aus dieser fürchterlicher Stroke Unit draußen und hatte – mit viel Glück, wie die Ärzte immer wieder betonten – keinerlei Folgeschäden zurückgetragen. Was also sollte ich mit einer Reha anfangen?
In Rücksprache mit meiner Familie kamen wir letztlich aber doch zu dem Schluss, dass eine Reha zumindest nicht schaden könne. Sie würde mir vielleicht helfen, Abstand zu gewinnen und wieder Kraft zu tanken, um dann frisch gestärkt in meinen Alltag zurückzukehren. Also gut. Ich ließ mich mehr oder weniger dazu überreden.
Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden war, durfte ich für eine Nacht zurück nach Hause. Am Tag darauf ging es in eine neurologische Rehaklinik nach Bad Orb. Mir war bei der Anreise noch nicht klar, dass mit meinem Aufenthalt hier auch wieder eine neue Phase begann.
Die Schockstarre löste sich langsam von mir. Und es begann eine wilde Phase voller Hochs und Tiefs, in denen sich Angst, Panik, mal brodelnd heiße, mal eiskalte Wut und wiederentdeckte Lebensfreude rasend schnell abwechselten; in dem ganzen Durcheinander manchmal sogar zusammenprallten. Ich nenne diese dritte Phase die Auseinandersetzung.