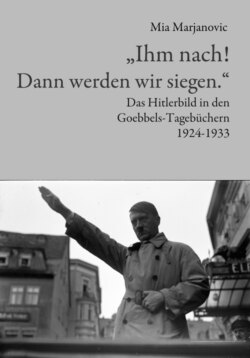Читать книгу "Ihm nach! Dann werden wir siegen." - Mia Marjanović - Страница 6
Einleitung
ОглавлениеAdolf Hitler nahm sich in Berlin am 30. April 1945 im Bunker unter der Reichskanzlei das Leben. Einen Tag später folgte Joseph Goebbels „seinem Führer“ zusammen mit seiner Frau Magda in den Tod. Zuvor hatte Magda die gemeinsamen sechs Kinder vergiftet. Die bedingungslose Treue und der unerschütterliche Glaube an Hitler ließen in Goebbels` Augen keinen anderen Ausweg als den des Selbstmords zu. Goebbels verschied als der Loyalste unter Hitlers Paladinen. Als unermüdlicher Propagandist hatte er Hitler zu dem „Führer“, der charismatischen Kultfigur gemacht. Mit seiner Hilfe war Hitler zu einem „Heilsbringer“, einem „neuen Messias“ emporgewachsen. Stellt man sich die Frage, wie Hitler möglich wurde, so muss daher auch auf Goebbels verwiesen werden.
Goebbels` Glaube an Hitler als den „Führer“ manifestierte sich Mitte der zwanziger Jahre und erhielt mit der „Machtergreifung“ am 30. Januar 1933 eine endgültige Bestätigung. Aufschluss darüber liefern die Tagebücher von Goebbels, die den Rang einer der wichtigsten Primärquellen aus jenen Jahren einnehmen. Goebbels begann mit seinen Aufzeichnungen am 17. Oktober 1923. Privates und Politisches vermerkte er nebeneinander. Bis zu seinem Selbstmord führte er Tagebuch,1 wobei der letzte erhaltene Eintrag auf den 10. April 1945 datiert ist. Die Tagebucheintragungen verfasste er zunächst handschriftlich, ab dem Sommer 1941 diktierte er regelmäßig dem Stenographen Richard Otte.2
Trotz der „eitlen Selbstbespiegelung und der autosuggestiven Lügenhaftigkeit“ des Autors bringen die Tagebücher dem Leser den Geist jener Zeit näher.3 Die Attraktivität, die von Hitler auf die damals vom Weimarer System Enttäuschten überging, wird verständlicher. Goebbels Aufzeichnungen ermöglichen Einblicke in seine Gedankenwelt, sein politischer Weg wird nachvollziehbar. Der Leser erhält Zugang zum inneren Zirkel der Macht innerhalb der NSDAP. Der Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung, die Phase der Machtübernahme, die Konsolidierung dieser Macht sowie die Kriegszeit werden dem Blick freigegeben. Hitlers Herrschaftstechnik offenbart sich.
Besonders interessant erscheint das in den Tagebüchern zwischen 1926 und 1933 vermittelte Hitlerbild, scheute sich Goebbels hier tatsächlich nicht, zum Teil harsche Kritik an „seinem Führer“ auszuüben. Seinen Unmut über Hitler äußerte er ganz offen. Der beredteste Verfechter des „Hitler-Mythos“ in der NSDAP zeigte sich zum Teil von Zweifeln geplagt. Noch wollte er Hitler, an dessen Seite er 1945 bis zum bitteren Ende bleiben sollte, nicht vorbehaltlos folgen. Zahlreiche Meinungsverschiedenheiten lassen sich nachweisen.
Keinesfalls führten die Kritik und die gelegentlichen Zweifel aber dazu, dass Goebbels sich von dem Parteiführer abwandte. Trotz aller Verstimmungen schien seine Knechtseligkeit Hitler gegenüber von Tag zu Tag gewachsen zu sein. Es hatte den Anschein, als wäre er geradezu auf Hitler, der ihn geschickt für die eigenen Zwecke instrumentalisierte und daher zu umwerben pflegte, „geprägt“. Die Tagebücher geben Aufschluss darüber, dass Goebbels zwischen 1924 und 1933 dem Hitler-Mythos verfiel, den er selbst 1926 zu formen begann. Die Wirkung des Mythos auf Goebbels war so stark, dass alle im Tagebuch geäußerte Kritik an Hitler letztendlich folgenlos blieb. Der Faszinationskraft, die von dem Parteiführer ausging, erlag er vollständig. Will man Goebbels` Selbstmord im Jahre 1945 verstehen, ist es daher unumgänglich, sich das von ihm in den Tagebüchern zwischen 1924 und 1933 entworfene Bild von Hitler anzuschauen. Hier liegt der Schlüssel für seinen unerschütterlichen Glauben.
Diese Arbeit macht es sich zur Aufgabe, dieses Hitlerbild zu beleuchten. Referierende Passagen über den historischen Faktenhintergrund sind zur besseren Einbettung des historischen Forschungsgegenstandes notwendig.
Der Aufstieg der NSDAP und das „Dritte Reich“ sind wissenschaftlich intensiv erforscht und bearbeitet worden. Die Literatur zu diesen beiden Themen ist kaum mehr überschaubar. Dennoch wird selbst in Biographien über Adolf Hitler und Joseph Goebbels lediglich am Rande und äußerst punktuell auf die Beziehung der beiden zueinander eingegangen.4 Eine Ausnahme bildet Erwin Barths veröffentlichte Dissertation.5 Anhand der Tagebücher, Reden, Artikel und sonstiger Aufzeichnungen Joseph Goebbels` setzt er sich mit der Mythisierung Hitlers durch Goebbels auseinander, die er als einen entscheidenden Faktor für den Erfolg der Nationalsozialisten in den letzten Jahren der Weimarer Republik ansieht.
Weiterhin beachtenswert sind die beiden Darstellungen von Claus-Ekkehard Bärsch, die mittels eines psychobiographischen und religionspsychologischen Ansatzes die ideologischen Komponenten von Joseph Goebbels untersuchen.6 Mit der „Führersehnsucht“, die hierbei nachgewiesen wird, beschäftigen sich des Weitern Ian Kershaw in seiner Abhandlung über den „Hitler-Mythos“7 sowie Kurt Sontheimer, der das antidemokratische Denken in der Weimarer Republik im Gesamten dokumentiert und eingehend analysiert hat.8
Thomas Friedrichs in seinem Werk „Die missbrauchte Hauptstadt“ aufgeworfene These, Goebbels sei bei wirklich entscheidenden strategischen Fragen von Hitler nie zu Rate gezogen worden,9 wird eingehend überprüft werden. Es stellen sich die Fragen: Inwieweit stilisierte sich Goebbels zum engsten Vertrauten Hitlers, ohne dieser tatsächlich zu sein? Welche Rolle in der NSDAP wurde ihm von Hitler zugeteilt?
Im Jahre 2006 wurde die Edition sämtlicher vorhandener Goebbels-Tagebücher abgeschlossen. Die bereits 1987 fragmentarisch publizierten handschriftlichen Aufzeichnungen, die für die hier zu behandelnde Zeit von Bedeutung sind, wurden neu und vor allem vollständig herausgegeben. Somit können in dieser Arbeit die zwischen 2004 und 2006 erstmals veröffentlichten und daher noch in der Forschung weniger beachteten Tagebuchpassagen im Hinblick auf das sich dort bietende Hitlerbild beleuchtet werden. Die nun neu zugänglichen Tagebucheintragungen betreffen folgende Zeitabschnitte: 17. Oktober 1923 bis 26. Juni 1924, 31. Oktober 1926 bis 14. April 1928 sowie 21. August 1931 bis 31. Dezember 1931. Da die ursprünglich verfügbare Tagebuchüberlieferung des Jahres 1932 zum Teil stark gestört ist, wurde in der Forschung ersatzweise das den nationalsozialistischen Machtkampf verherrlichende Dokument „Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei: eine historische Darstellung in Tagebuchblättern“10 zur Interpretation herangezogen. Dieses Goebbels-Buch deckt den Zeitraum zwischen dem 1. Januar 1932 und dem 1. Mai 1933 ab. In der folgenden Arbeit werden jedoch die seit 2006 vollständig publizierten Original-Tagebucheintragungen der stilistisch und inhaltlich nachgebesserten Version vorgezogen.
Um Goebbels` Haltung gegenüber Hitler nachvollziehen zu können, wird in dieser Darstellung zunächst auf die Herkunft und Mentalität des späteren Berliner Gauleiters eingegangen. Die Arbeit endet mit seiner Ernennung zum Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda am 14. März 1933, dem Tag, an dem Goebbels` Annahme, dass nur an der Seite Hitlers sein Weg in die Zukunft erfolgen könne, sich zu bewahrheiten schien.