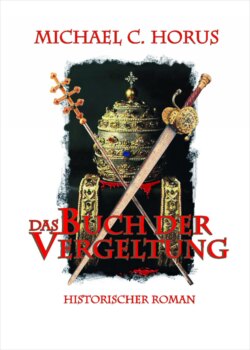Читать книгу Das Buch der Vergeltung - Michael C. Horus - Страница 5
1. Kapitel
ОглавлениеAls wir die Straßen Roms am Nachmittag der siebenten Kalenden des Oktobers1 im Jahre 963 des Herrn betraten, überfiel uns zunächst ein übler Gestank. Ich erinnere mich noch, als wäre es gerade eben gewesen, dass mir die Berge von Unrat, Exkrementen und die zerfallenen Gebäude auf dem Collis Quirinalis sofort ins Auge fielen. Die Außenbezirke dieser ehemals großen und starken Stadt boten ein Bild des Verfalls und des Elends. Zwischen Ruinenfeldern, viele Stadien lang, abgebrochenen Kirchenbauten, ehemaligen Patrizierhäusern mit kaum mehr erkennbarer Eleganz und eingestürzten Arkaden grasten Kühe und Ziegen. Vermummte Karrenschieber in lumpigen Kleidern kippten widerwillig die Leichen der armen Sünder ab, die die dahinsiechende Stadt ausgespuckt hatte. Alles hier ringsum war so voller Abscheulichkeiten, dass an einigen Stellen Wolken von Verwesung und entsetzlichen Ausdünstungen umherwaberten.
Zwielichtige Gestalten, Aussätzige und Sterbende jedweden Alters und Geschlechts trieben sich zwischen den Ruinen herum, wohl auf der Suche nach Essbarem oder Verwertbarem aller Art, und plünderten, wo es längst nichts mehr zu plündern gab. Schwärme von gierigen Krähen und fetten Möwen bevölkerten den Himmel und stürzten sich auf die Reste, die selbst in den Augen der Ärmsten und Verwahrlosesten keine Beachtung mehr fanden, stritten sich um Aas oder hackten den Toten die Augen aus.
Dünne Rauchfahnen kreuzten immer wieder von links und von rechts unseren Weg, aber wir konnten nicht erkennen, dass sich jemand der Mühe hingab, die rußenden Feuer zu löschen. Woher hätte er das Wasser auch nehmen sollen? Der einstmals große und mächtige Fluss Tevere glich einer einzigen Kloake, und man durfte eher befürchten, jeglichen Brand mit so viel schlammigem Unrat eher noch anzuheizen.
Je weiter wir uns von den von frischem Wind umwehten Hügelspitzen, die zu meinem Erstaunen noch einige gänzlich unversehrte Häuser aufwiesen und offenbar auch bewohnt wurden, entfernten und ins Tal herab begaben, desto unangenehmer wurde der Anblick, der sich uns bot und damit einhergehend der Gestank. Auch die meisten der großen Aquädukte, deren massive Pfeiler sich als einzig sichtbarer Rest schierer Größe und Reichtums der Vergangenheit in den von Wolken verhangenen Himmel erhoben, brachten schon längst kein frisches Wasser mehr aus den umliegenden Bergen in die Stadt, weil das Geld für ihre Reparatur und Unterhaltung fehlte, wie überhaupt die Geldknappheit eines der wichtigsten Attribute des sterbenden Roms geworden zu sein schien.
Das Bild besserte sich ein wenig, je näher wir der Tevere-Niederung kamen, welche träge zwischen dem Mons Capitolus, dem Mons Palatinus und dem Mons Aventinus dahinlag. Auch hier war Verfall allerorten zu sehen, aber eine unsichtbare ordnende Hand schien dafür Sorge zu tragen, dass die gröbsten Übel und Verdrießlichkeiten sich nicht hier vor den Augen aller vollzogen und ein Mindestmaß an Würde und ein Rest vom alten Glanze gewahrt blieb. Frisches Wasser plätscherte aus einer steinernen Rinne, die sich auf sorgsam gehauene und ehemals mit Marmorplatten verzierte Sandsteinquader stützte und quer über den Marktplatz zog, woraus ich herleiten konnte, dass wenigstens eine der großen Wasser führenden Leitungen noch intakt und zumindest diesen Teil der Stadt zu versorgen imstande war. Ich hoffte, es würde hier noch viele weitere Orte wie diesen geben.
Der Krieg in Italien ging nunmehr in sein drittes Jahr. Ich muss aber wohl anmerken, dass im Sommer 962 nach der Einnahme der Stadt Pavia durch König Otto und der nachfolgenden Krönung zum Kaiser des Regnum Francorum2) eine kurze Zeit der Ruhe eingekehrt war. Dies war nach all dem Ungemach sehr wohltuend und gab allen beteiligten Parteien Gelegenheit und Zeit, sich mit den neuen Machtverhältnissen zu arrangieren.
Der Allgemeine Papst und oberste Bischof von Rom Johannes XII. zählte damals noch zu unseren treuen Verbündeten. Doch nun hielt sich Kaiser Otto mit einem großen Heer im Montefeltro auf und belagerte die Burg San Leo nahe San Marino. Denn dorthin hatte sich der grausame italische König Berengar von Ivrea mitsamt seiner gierigen Gattin Willa und seinem ungehörigen Sohne Adalbert nach der Anstiftung einer Revolte gegen den heiligen Kaiser zurückgezogen und leistete heftigen Widerstand. Dem Adalbert gelang mit ein paar Getreuen unerkannt die Flucht nach Rom, wo er sogleich den Papst Johannes aufsuchte und ihn dazu brachte, sein loyales Versprechen, welches er Otto gegeben hatte, preiszugeben und ihn schändlich zu hintergehen. Der Papst sicherte nun seinerseits dem Adalbert Unterstützung zu und übergab ihm weitere Soldaten, auf dass er und seine Getreuen länger dem kaiserlichen Ansturm standhalten oder ihn gar zurückschlagen könnten.
Alsbald erfuhr unser gerechter und geliebter Kaiser von dieser schändlichen Tat und er sandte meine bescheidene Niedrigkeit Liutprand, Bischof von Cremona, und den ehrwürdigen Landward, Bischof von Minda in Sachsen, aus, um den abtrünnigen Papst zu bekehren. An meiner Seite ritten einige weitere ehrenwerte Herren, die in anderer Mission unterwegs waren und an deren Namen ich mich heute nicht mehr zu erinnern vermag, außerdem mein junger und in solchen Dingen noch vollkommen unerfahrener Schüler Franco de Ferrucius, von dem hier gleich noch zu reden sein wird.
Meine niedrige Person war damals Hofkaplan und Königlicher Gesandter in diplomatischen Diensten des großen fränkischen Herrschers Otto, zudem ein guter Freund der Familie Ferrucius. Ich bot dem Bruno an, den jungen Franco, der schon von frühen Jahren an für eine geistliche Laufbahn vorgesehen war, zu mir zu nehmen und ihn zu unterrichten und zu erziehen – ein Angebot, welches Bruno überaus dankbar annahm, konnte er dem aufgeweckten und klugen Jungen doch nur wenig mehr bieten als ein Leben unter zunehmenden Entbehrungen und mit einem kranken Vater an der Seite. So kam es also, dass jener Junge, schmal in den Schultern und von kaum scheinbarer Statur, mit wachen Augen, die größtenteils unter wilden schwarzen Locken verborgen waren, zum ersten Mal in seinem Leben die Tore der Heiligen Stadt erblickte, ohne jemals zu erahnen, dass dieser Ort eines Tages zu seinem Schicksal werden würde.
Wir passierten soeben die kleine Kirche San Clemente in der Vicus Papessa, einer engen Gasse, die von den monumentalen Wohnhäusern zweier alter römischer Adelsfamilien, den Papes und den Crescentiern, beherrscht wurde, und näherten uns dem Mons Vaticanus, der aber ein so platter Hügel war, dass er diesen Namen kaum verdiente. Vor uns, auf dem großen freien Platz vor dem Palacio San Giovanni in Laterano3), erhob sich ungewohnt würdevoll und stolz die marmorne Statue des ehrbaren und huldvollen Marcus Aurelius, einem der wenigen immer noch hochverehrten Imperatoren der alten Zeit, die sich um die wahre Größe und den ehemals hohen Ruhm des Sanctum Imperium Romanum verdient gemacht haben.
Auf den Stufen der Basilika Sankt Peter, wir hatten uns bereits von der restlichen Reisegesellschaft getrennt, erwartete uns ein guter alter Freund, dessen Wiedersehen nach mehr als acht Jahren in der Ferne mich von ganzem Herzen mit Glück und Zufriedenheit erfüllte.
„Liutprand! Landward! Meine lieben Freunde! Wie schön, Euch zu sehen!“, rief er schon von Weitem, kam auf uns zu und begrüßte zuerst mich mit einer herzlichen Umarmung. „Wie ich sehe, seid Ihr wohlauf und guten Mutes. Ich hoffe, Ihr hattet einen nicht allzu beschwerlichen Weg und wurdet verschont von allerlei Unbill. Pax vobiscum!“
“Et cum spirito tuo. Keine Sorge, ehrwürdiger Leo, um uns steht es gut und die Reise war bei weitem nicht so beschwerlich, wie man ob der schlimmen Zeiten glauben mag. Der Krieg hat einen Bogen um uns gemacht“, antwortete ich.
„Ganz sicher, weil er weiß, welch friedliebende und gottesfürchtige Menschen Ihr seid, ehrwürdiger Liutprand und ehrwürdiger Landward!“, sagte Leo lächelnd und verneigte sich sanft vor uns.
„Ihr übertreibt wie immer, mein lieber Leo, aber auf eine, wie ich zugeben muss, sehr schmeichelhafte und willkommene Art.“
Der ehrwürdige Protoskriniar Leo war, ebenso wie sein verehrter Vater, der lange Zeit mein Mentor war und mit dem ich die Ehre hatte, in enger Freundschaft verbunden zu sein, ein sehr gebildeter und vielbelesener Mann, ein Bibliothekar durch und durch und ein ebenso guter Notarius. Seit vielen Jahren stand er dem päpstlichen Archiv als Direktor vor und ward von allen Seiten hoch angesehen. Als oberster Kanzler der heiligen Römischen Kirche war er dem Bischof von Rom einerseits sehr nah, andererseits auch nicht. Er gehörte, wenn man es ganz genau nahm, nicht einmal zum engsten Kreise seiner Vertrauten, was bei dem schlechten Rufe des amtierenden Papstes durchaus als Kompliment zu verstehen war. Allein Leos unendlich hohes Ansehen im Klerus und im römischen Adel bewahrte ihn davor, zu sehr in des Papstes Abhängigkeit zu geraten und ein Opfer seiner unsäglichen Attitüden und Intrigen zu werden. Denn der Papst hatte keine taugliche Macht über ihn. Niemand in Rom wäre verwundert gewesen zu hören, dass es eigentlich der Leo war, der Macht über das heilige Amt ausübte und insgeheim die Geschicke der Kirche lenkte, auch wenn er dies kaum für sich persönlich ausnutzen wollte.
Leo führte uns einen kurzen Weg durch die Arkaden zu einem Seitenportal, was mir Gelegenheit gab, ihm meinen neuen Schüler Franco de Ferrucius vorzustellen, der mir zur Ausbildung und Erziehung an die Seite gegeben worden war. Franco, er mochte damals gerade zwölf Jahre alt geworden sein, verneigte sich ehrfürchtig, wie ich es ihn gelehrt hatte. Er war ein ungewöhnlich aufmerksamer und wissbegieriger Schüler, einer, wie ich ihn noch nie zuvor gekannt habe, ausgestattet mit der besonderen und durchaus neidenswerten Fähigkeit, in fremden Gesichtern und in kleinen Gesten wie auf Pergament lesen und sich in Windeseile auf seinen Gegenüber einstellen zu können, wenn er nur wollte. Leider hatte ich aber auch schon früh bemerkt, dass er seine erstaunlichen Fähigkeiten, von denen er noch einige mehr besaß und auf die ich im Folgenden auch noch zu sprechen kommen werde, nicht immer zu unserem Vorteil einsetzte, sondern zumeist nur dann, wenn es ihm danach gelüstete. Er war überdies launisch und wechselhaft und glich in jenen Momenten den Weibern, deren ewiges Gezänk ich als Kind in der Webstube meiner lieben Mutter oft mit anhören musste. Alle meine Ermahnungen waren schon von frühester Zeit an nutzlos. Franco verfügte über einen unbändigen Willen und eine starke Seele, aber er schaffte es nicht, damit seine Störrigkeit zu besiegen. Nun, für mich war es eine lässliche Sünde, die in den Augen Gottes ganz sicher Gnade und Vergebung finden würde.
„Kommt, meine lieben Brüder“, sagte Leo, nachdem er die schwere, mit Bronze beschlagene Türe hinter sich geschlossen hatte, „der Heilige Vater erwartet Euch bereits.“
„In seinen Privatgemächern?“, fragte ich und blickte mich um. Leo hatte uns nicht zu einer der üblichen Audienzen in den Lateranensischen Palast geführt, sondern in den weit ausladenden Seitenflügel des päpstlichen Schlosses, den jener mit seinen engsten Vertrauten und Bediensteten bewohnte.
„Bitte verzeiht mir, verehrter Liutprand, es ist nicht leicht zu erklären", antwortete Leo zögernd und sah sich ebenfalls um. Als er sicher war, dass wir allein waren und von niemandem belauscht wurden, fügte er leise hinzu:
„Es ist so, dass der Heilige Vater den Audienzen und offiziellen Terminen tatsächlich nicht sehr viel Zeit widmet. Er hasst diese Dinge und ebenso die schwere Robe, die zu tragen ihm ein Gräuel ist.“ Er machte eine lange, vielsagende Pause, in der er seinen Blick mehrmals zwischen Franco, Landward und mir pendeln ließ, wobei er auf seltsam beirrende Weise länger auf den Zügen meines Schülers verweilte als bei Bischof Landward und mir.
„Nun ja“, fuhr er fort, „Ihr werdet es ja gleich selbst sehen. Der Heilige Vater ist … wie soll ich sagen … den weltlichen Dingen ein wenig zu sehr zugeneigt … wenn Ihr versteht, was ich meine, ehrwürdiger Liutprand und ehrwürdiger Landward?“
Ich nickte und gab ihm wortlos zu verstehen, dass es von meiner Seite aus keiner weiteren Erläuterungen bedurfte. Ich hatte über den jungen Papst Johannes XII. und seine überaus weltlichen Vorlieben von vielen Seiten bereits genug gehört, um mir ein gutes Bild machen zu können, wie es um ihn bestellt war. Zumindest glaubte ich das zu jener Zeit.
„Aber ich bitte Euch, schweigt und erzählt es niemandem außerhalb dieser Mauern“, fügte Leo eilig hinzu. „Ich fürchte ernsthaft um das Seelenheil unseres geliebten Heiligen Vaters. Der Herrgott möge ihm gnädig sein und sich dereinst seiner Seele erbarmen.“ Dabei bekreuzigte er sich voller Demut. Wir taten es ihm gleich und folgten ihm behutsamen Schrittes in den zweiten Stock.
Johannes XII., der einmal mit gewöhnlichem Namen Octavian von Spoleto hieß, war der einzige Spross einer der ältesten und angesehensten Adelsfamilien des Landes. Sein Vater, der römische Senator und mächtige Fürst Alberich, Markgraf von Spoleto, hatte kurz vor seinem Dahinscheiden im Jahre des Herrn 954 den versammelten römischen Adel schwören lassen, seinen Sohn bei der nächstfolgenden Sedisvakanz4) zum Obersten Bischof und damit auch zum Allgemeinen Papste zu wählen, um seinen weltlichen und geistlichen Einfluss auch über den eigenen Tod hinaus abzusichern. Über zweiundzwanzig Jahre lang war Alberich zuvor als princeps ac senator omnium Romanorum der Herrscher über die Stadt Rom und den Heiligen Stuhl. Unter seiner Herrschaft kehrten Ordnung und Anstand nach Rom zurück. Alle während seiner Regentschaft amtierenden Päpste waren erst nach seiner Fürsprache in das heilige Amt gewählt worden.
Nun, in den Kalenden des Septembers jenes Jahres verstarb jener Alberich, gerade als er im Begriff war, die Verbindung mit seiner Frau Alda, der Tochter des verstorbenen Königs Hugo von Italien, nach beinahe zwanzig Jahren Ehe aufzulösen.
Octavian war damals eben sechzehn Jahre alt geworden und folgte, wie es Alberich in die Hand versprochen wurde, dem ehrwürdigen Agapitus II. nach dessen Ableben auf den Stuhl Petri nach. Ein großes Fest ward gegeben im Dezember des Jahres 955 und Rom feierte ganze dreißig Tage lang ohne Unterlass und in nie zuvor gesehener Pracht und Verschwendung.
Als wir die Gemächer des Papstes betraten, umfing uns ein süßlicher Duft von Weihrauch und allerlei Essenzen. Leo rümpfte angewidert die Nase und er tat es durchaus so, dass wir es gut sehen sollten. Ein ferner Gesang, keinesfalls eine Liturgie, eher ein Schwärmen (so empfand ich es) war zu hören. Leo schloss die schweren Flügeltüren so kräftig, dass der dumpfe Knall von den Wänden widerhallte. Der Gesang erstarb augenblicklich. Ein junger Mann, höchstens fünfundzwanzig Jahre alt und in rotes Tuch gekleidet, erschien zwischen zwei marmornen Pfeilern am Ende des Raumes.
„Leo, was gibt es? Warum unterbrichst Du mich mit diesem Lärm?“
Der altehrwürdige Protoskriniar und Kanzler verneigte sich tief und vollkommen wortlos vor dem jungen Manne, der langsam näherkam. Wir taten es ihm gleich, darauf bedacht, alles genauso zu tun, wie Leo es empfohlen hatte. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich immer wieder meinen Schüler Franco, aber es gab keinen Anlass zur Sorge. Er gehorchte und hielt sich genauestens an meine Worte.
„Wen hast Du mir mitgebracht? Ich brauche frischen Wein, Leo. Geh und hol ihn mir! Und bring Trauben mit, recht viele von den roten.“
„Ehrwürdiger Papst, es sind Besucher aus Pavia. Sie sind Gesandte des Kaisers“, sagte Leo, immer noch gebeugt und ohne aufzusehen. Johannes XII. winkte ihm zum Zeichen, dass er sich nun entfernen dürfe, um das Verlangte zu holen.
„Ich mag ihn nicht so sehr“, sagte der Heilige Vater zu uns, als Leo außer Sichtweite war, „er ist so verbiestert und ich habe ihn noch nie scherzen sehen. Doch, nun erhebt Euch und sprecht: Wer seid Ihr und welch Begehr führt Euch zu mir, Ihr lieben Bischöfe?“
Landward, dem das gebeugte Stehen nicht mehr ganz so leichtfiel, ächzte schwer und stellte sich mühsam gerade. Ich richtete mich ebenfalls auf und blickte in das knabenhafte Gesicht des Papstes. Ein weicher Bartflaum umschloss seine Wangen und sein Kinn, kaum so viel, dass man es hätte abschaben können. Seine dunklen Augen stierten mich neugierig, aber auch misstrauisch an, so als hätte ich ein großes Geschwür an der Nase, welches jeden Moment aufbrechen könne. Das mit dicken goldenen Borten bestickte rote Tuch, in welches er gewandet war, wirkte aus der Nähe sehr viel feiner und ansehnlicher. Ein schmales, mit herrlichen Gold- und Silberstickereien verziertes und bis zu den Knien herabfallendes Pallium, in Form und Tragart unserer Stola nicht unähnlich, schmückte seine Brust und Sandalen aus sehr edlem, rot eingefärbtem Flechtwerk umhüllten seine Füße. Er mochte ein gar übler Papst sein, doch in Kleiderfragen zeigte er Geschmack, wie ich unschwer feststellen konnte.
„Ich bin Liutprand“, begann ich, „Bischof von Cremona in Italien und das ist der ehrwürdige Landward, Bischof von Minda in Sachsen. Wir sind Gesandte des großen Otto, von Gottes Gnaden ehrwürdiger Kaiser des Regnum Francorum und Herrscher über die Sachsen, die Franken und die Bayern, Herr über die Völker des Nordens und des Südens, von dem ich Eurer Exzellenz, dem Heiligen Vater aller Christen, die freundschaftlichsten und ehrfürchtigsten Grüße überbringen darf.“
Gemeinsam mit Landward verneigte ich mich erneut, diesmal aber nur leicht, um unserem Gegenüber Zeit zu geben, die Begrüßung mit einer ebensolchen zu beantworten, wie es in diplomatischen Protokollarien üblich war. Johannes jedoch schien nicht sonderlich daran interessiert, unsere Höflichkeiten zu erwidern oder auf Protokolle zu achten. Stattdessen musterte er aufmerksam meinen Schüler.
„Ja, ja, erhebt Euch schon, werte Herren“, sagte er. „Wen hast Du mir dort mitgebracht, Bischof Liutprand?“
Höflich lächelnd, aber doch ein wenig irritiert, wandte ich mich zur Seite, wo Franco einen halben Schritt hinter mir stand. Ich gebot ihm, sich ebenfalls zu erheben, so dass er nun erstmals in seinem noch jungen Leben dem Heiligen Vater und obersten Bischof der Christenheit von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten konnte. Ich ahnte zu dieser Zeit nicht, welche Bedeutung diese erste Audienz schon damals für ihn hatte und was sie in ihm bewirken würde.
„Eure Exzellenz“, begann ich, „dies ist mein braver Schüler Franco de Ferrucius, der zweitgeborene Sohn des angesehenen Verwalters Bruno de Ferrucius aus Pavia. Ihr werdet vielleicht von ihm gehört haben.“
Johannes richtete seinen Blick für einen kurzen Moment an die hohe und wundervoll bemalte Decke und sagte, wie zu sich selbst: „Bruno de Ferrucius? Nein, nie gehört.“ Dann wandte er sich wieder an mich und fügte hinzu: „Ich sehe einen wertvollen Ring an der Hand Eures Schülers. Es scheinen wohlhabende Leute zu sein?“
Es war nicht so sehr als Frage gestellt, sondern glich mehr einer Feststellung. Sein Blick aber schien mich um Bestätigung zu bitten. Doch gerade als ich anhob, die mir sehr gut bekannte Geschichte der Familie de Ferrucius auszuführen, unterbrach er mich mit einer gelangweilten Handbewegung.
„Genug! Ich habe genug gehört. Und merken werde ich es mir jedenfalls nicht, wer auch immer diese Leute sind. Dein Schüler wird mir zeigen müssen, wozu er in der Lage ist. Danach werde ich mir ein Urteil über ihn und seine vermutlich erbärmliche Verwandtschaft bilden.“
Nun, zugegeben, als ich diese Worte hörte, überkamen mich zwiespältige Gefühle. Wie sollte ich ihn verstehen? Kannte er nun die Familie Ferrucius oder kannte er sie nicht? Sprachen eher Zuneigung oder Ablehnung aus seinen Worten? Hatte dies nichts Gutes zu bedeuten oder war es nur so dahingesagt, wie, wenn es einem zuwider ist? Und auch auf den Ring an rechter Francos Hand konnte ich mir keinen Reim machen. Zu jener Zeit wusste ich nur, dass er ihn ständig bei sich trug, ihn nie ablegte und sorgsam darauf achtgab, ihn nicht zu beschädigen. So warf ich Franco einen sorgenvollen Blick zu, den er mit einem Schulterzucken und hochgezogenen Augenbrauen quittierte.
Dem ehrwürdigen Leser dieser Zeilen sei es erzählt, weil es dem gesamten Verständnis der Sache dienlich sein mag: Jener Franco de Ferrucius entstammte der alteingesessenen lombardischen Familie gleichen Namens, die es am Königlichen Hofe von Pavia, etwas südlich vom schönen Milano gelegen, zu einigem Ansehen und zu gediegenem Wohlstand gebracht hatte. Der preiswürdige und ehrenwerte Bruno de Ferrucius war Hofkämmerer unter König Lothar und später erster Dienstherr unter seinem Nachfolger König Berengar. Im Jahre 948 hatte sich Bruno nach Pavia begeben, um die vornehme Stellung antreten zu können. Zur selben Zeit lebte und diente auch ich am Hofe König Lothars, der seinerzeit mit Adelaide di Borgogna verheiratet war, aber schon im Jahre 950 von einem überaus boshaften Widersacher vergiftet wurde, sodass die wunderschöne Adelaide bereits in jungen Jahren zur Witwe wurde.
Der Junge, der mich nun als mein Schüler auf meinen Wegen begleiten sollte, war das fünfte von sechs Kindern und der mittlere von drei Söhnen der Familie Ferrucius und wurde im Sommer des Jahres 951 vom Allmächtigen Herrn in die Welt gerufen.
Zwei Jahre später verstarb die Mutter bei der Geburt seines jüngsten Bruders. Der kleine Franco wuchs nun gemeinsam mit seinem kleineren Bruder bei der Schwester seines Vaters auf, bis er zehn war und auch die Tante zu seinem und des Vaters allergrößten Entsetzen zu Gott befohlen wurde.
Im gleichen Jahre erhielt Bruno einen schweren Schaden, als er von einem Pferdewagen überrollt wurde. Fortan an den Beinen gänzlich gelähmt konnte er seinen Dienst bei Hofe nicht mehr ausüben und erhielt vom König, der sich selten einmal großzügig und gnädig zeigte, eine kleine Rente, um sein Leben zu fristen, aber es reichte längst nicht für alle. Die beiden älteren Jungen des Bruno fanden als Spielkameraden der etwa gleichaltrigen Königssöhne einen guten Unterhalt bei Hofe, die Schwestern hingegen heirateten kurz hintereinander und zogen zu ihren Ehemännern nach Benevent und nach Aragon. Francos jüngerer Bruder Heribert wurde in ein Milaneser Waisenhaus gegeben, wo sich sein späterer Verbleib jedoch nicht mehr aufklären ließ, obschon ich beinahe ein ganzes Jahr nach ihm suchte.
Aus dem Hintergrunde des Raumes war ein leises Kichern zu vernehmen. Es war das Kichern heller Mädchenstimmen, wie ich unschwer auszumachen vermochte. Franco wurde plötzlich heftig durchzuckt. Als ich mich zu ihm umdrehte, vermochte ich jedoch nichts Absonderliches an ihm festzustellen. Er war durchaus ein wenig angespannter als noch zuvor, aber das mochte ich dem heiligen Moment dieser Begegnung und der Prächtigkeit der päpstlichen Gemächer mit all ihrem Prunke und von Gold glitzernden Gewölbe zuschreiben.
Das liebliche Kichern aus der Ecke kam näher und zeigte sich wenig später in Gestalt zweier hübscher, von langen dunklen Locken gerahmter Mädchenköpfe, die neugierig hinter einem der Pfeiler hervorlugten und sich offenbar ein besseres Bild von der edlen Gesandtschaft des Papstes machen wollten, als sie es von ihrem ursprünglichen Platz aus hatten tun können. Ich wollte ihnen dieses Vergnügen durchaus gewähren, stellte mich entsprechend in Positur und meine teuren Kleider gut geordnet zur Schau, ohne zu bemerken, dass ihr Blick weder mir noch meiner Kleidung galt, sondern einzig und allein dem jungen Schüler an meiner Seite. Franco war plötzlich über alle Maßen rot angelaufen, so sehr, dass es, um es zu bemerken, nicht einmal des zusätzlichen Lichtes bedurft hätte, welches von dem Feuerschein einiger Öllichter ausging.
Leo indes war mit einem vergoldeten Tischlein zurückgekehrt, welches er auf drei ebenfalls vergoldeten Rädern, sie mochten wohl ursprünglich aus Holz gemacht sein, vor sich hinschob. Das Wägelchen war beladen mit vielerlei Obst und Krügen, die mit Wasser und Wein gefüllt waren. Er stellte die Ladung ganz in der Nähe ab, verbeugte sich vor dem jungen Mann im roten Tuch und trat dann einen Schritt näher an ihn heran, um etwas in sein Ohr zu flüstern. Johannes XII. nickte geflissentlich und erteilte ihm sogleich einen neuen Auftrag, woraufhin Leo sich erneut ehrerbietend tief verbeugte und verschwand.
Der Papst ließ die beiden Lockenköpfe mit einem Handstreich verstummen und wandte sich dem vergoldeten Tischlein an seiner Linken zu.
„Meine lieben Bischöfe“, sagte er, während er zwei Becher mit Wein füllte und an Landward und mich reichte, „Ihr werdet Euch noch ein wenig gedulden müssen, bevor wir auf Eure Gesandtschaft zu sprechen kommen. Seid morgen zur selben Stunde wieder hier, tragt das Anliegen Eures Herrn vor und hört, was ich Euch und ihm dazu zu sagen habe. Ich habe mich derweil um anderes zu kümmern. Nun trinkt von diesem köstlichen Wein und dann geht. Mein treuer Camerlengo5) Salek wird Euch Eure Herberge zuweisen und für alles Sorge tragen, dessen Ihr begehrt. Sagt es nur frei heraus und es wird Euch gegeben.“
Daraufhin trat aus einer bisher dunklen Nische wie auf ein geheimes Zeichen ein Mann hervor, verneigte sich in leichter Weise vor dem Papste und wandte sich dann mir und meinem Schüler zu.
Dieser Salek, von Geburt an wohl ein Bulgare, aber von der Erziehung her ein Ungar, war zu jener Zeit der vertrauteste Freund des Papstes. Er mochte etwas älter und etwas reifer gewirkt haben, weil er beständig schwieg und nur das Nötigste seiner inneren Gefühlswelt auf seinem Gesichte zum Vorschein kommen ließ. Auch während des Weges zu unserer Herberge sprach Salek nicht ein einziges Wort, was man, wenn ich es recht bedenke, durchaus als eine Ungehörigkeit bezeichnen könnte. Da er aber so eng vertraut mit dem Herrn Papste und sein Camerlengo war, wagte ich nicht, ihn meiner Kritik zu unterziehen, und schwieg ebenfalls, denn ich wollte nicht schon in der ersten Stunde unserer Gesandtschaft Misstöne und Feindseligkeit aufkommen lassen. Der Auftrag, den zu erfüllen wir vom Kaiser geschickt worden waren, erforderte von mir in höchstem Maße diplomatisches Geschick und hing nicht ganz unerheblich von dem äußeren Rahmen ab, den zu schaffen wir vermochten, um mit dem obersten Bischof und Allgemeinen Papste ins Vernehmen zu kommen. Dieser unheilige Moment, das empfanden sicherlich nicht nur der gute Landward und meine bescheidene Niedrigkeit so, sondern wohl auch mein braver Schüler, erschien uns gänzlich ungeeignet, ein Anliegen, gleich welcher inneren Art und welcher äußeren Gestalt, vorzutragen und zu einem erfolgreichen Abschluss führen zu können.
Der Franco ging drei Schritte hinter uns, ebenfalls schweigsam. Als Salek uns zur Pforte eines beträchtlichen Anwesens geführt hatte, klopfte er einen schweren Messingknauf dreimal gegen die Tür und verneigte sich dann, immer noch ehern schweigend, vor uns, um auf dem gleichen Wege, den wir gekommen waren, zu seinem Herrn zurückzukehren.
Der Tageslauf war indes noch nicht so weit vorangeschritten, dass wir die Absicht hatten, uns zur Ruhe zu betten. Im Gegenteil: Unsere Reise war weit weniger beschwerlich und ermüdend gewesen als befürchtet, und so sprachen wir mit dem Hausherrn des Anwesens, einem vornehmen römischen Adligen namens Stephanus de Imiza, und seinem jüngeren Bruder Rikhardus. Stephanus zeigte überaus große Liebenswürdigkeit, als ich ihm versicherte, dass wir in Gesandtschaftsdingen unterwegs waren, und außerdem großes Interesse an seinem Weinlager offenbarte. Ich erklärte ihm auf sein Nachfragen, während wir im angenehm kühlen Kellergewölbe unter seinem Haus köstlichen Nektar tranken, dass uns an nichts mehr gelegen war, als den unseligen Krieg im Norden zu beenden, und dass wir unseren Teil dazu beitragen wollten, wenn der Herr in seiner unendlichen Gnade uns darin beistehen wolle.
Stephanus war ein gebildeter Mann mit Mut zum offenen Wort, wenn es sich geziemte. Ich gestehe, dass mir diese Eigenart sehr imponierte und ich sie auch gern an mir gehabt hätte, doch zweifle ich daran, dass jemand wie ich, der aber sein Herz auf offener Zunge trüge, gleichsam ein guter Diplomat und Gesandter sein könne. Ist die Kunst der Diplomatie nicht immer und zuallererst auch die Kunst des Täuschens und Verbergens, frage ich? Wie dem auch sei, Stephanus und sein nicht minder gebildeter Bruder Rikhardus, der für Speisen und Tanz sorgte, indem er eine Schar bezaubernder Jungfrauen aufbot, die sich ganz um unser leibliches Wohl sorgten und auch dem Auge ein ums andere Mal einen besonderen Schmaus darboten, hatten ihre eigene, wohl durchdachte Sicht auf die Dinge.
Wir ließen uns bei Wein und lieblicher Musik auf einem Diwan im schönsten Raum seines Hauses nieder und er sprach zu uns: „Es kommt mir vor, als wenn der Teufel den Schöpfer hasst, wenn ich sehe, wie Papst Johannes den heiligsten Kaiser, seinen Erretter aus den Händen Berengars und Adalberts, verabscheut und hintergeht. Vom geliebten Kaiser wissen wir, dass er erkennt und tut und liebt, was Gottes ist. Er schützt die geistlichen und weltlichen Dinge mit seinem Wissen und seinem Schwerte. Aber Papst Johannes ist all diesem Feind. Er verschenkt ungerührt, was nicht seins ist, und er nimmt, wo und wie es ihm beliebt. Und ich sage Euch, verehrter Bischof Liutprand und verehrter Bischof Landward, das ist beileibe kein Geheimnis! Das Volk weiß längst über alles Bescheid.“
Ich blickte wohl gar zu ungläubig, so dass mein Gegenüber sich genötigt sah, diesen letzten Satz und einige weitere zum Beweis heranzuführen. Der gute Franco, der neben mir auf einem weniger bequemen Kissen hockte, schien sich indes für das Gerede der Erwachsenen nicht allzu sehr zu interessieren. Er wickelte unablässig eine dünne goldene Schnur um seine Finger, um sie kurz darauf wieder abzuspulen. Seine Blicke galten mehr den Jungfrauen und ihrem manchmal frivolen Gebaren, so dass ich ihn mit strengem Gebot ermahnen musste, sich in seinem Interesse ein wenig zurückzunehmen. Ich ließ ihm einen Teller mit Obst und einen Krug Bier bringen, damit er sich auf diese Art etwas amüsieren und ein wenig Zerstreuung finden konnte.
Sodann fuhr Stephanus fort: „Wie man zuletzt hörte, war Johannes für die junge Witwe eines Dienstmannes, den er zuvor aus ganz nichtigen Gründen ermorden ließ, in blinder Leidenschaft entbrannt. Er verfolgte die arme Frau über viele Städte hinweg und ließ ihr goldene Kreuze und Kelche, welche doch eigentlich dem unantastbaren Schatze des Heiligen Petrus zugehören, als Geschenk zukommen. Und noch etwas: Die Frau Stephana, seine Geliebte, verlor bei der Abtreibung einer von ihm empfangenen Leibesfrucht vor kurzem das Leben! Bedenkt nur, edle Bischöfe: Der Lateranensische Palast, einst der Wohnort heiliger Männer, ist jetzt der Tummelplatz unzüchtiger Weiber! Denn dort haust als sein Weib die unzüchtige Schwester einer anderen Beischläferin, genannt Stephania.“
Erneut wandte ich mich zu meinem Schüler um, der sich bei der Erwähnung der Weiber im Lateranensischen Palast wohl ebenso an unseren kürzlichen Besuch erinnert gefühlt haben dürfte wie ich. Unsere Blicke kreuzten sich für einen Moment vielsagend. Stephanus brachte noch weitere Beispiele der Verrufenheit und Lasterhaftigkeit, denen sich der Papst mit jedem neuen Jahr seiner Amtszeit immer offener und verschwenderischer hingab. Er berichtete ebenso von grauenhaften Taten, die der Papst noch vor wenigen Tagen an Ehefrauen und Witwen vollbringen ließ, deren Männern er auf die eine oder andere Art Gewalt und Tod angetan hatte, um sie gefügig zu machen. Mich erschauerte das Gehörte derart, dass ich nicht einmal in der Lage war, es mir in meinem inneren Bilde vorzustellen.
„Der Tod herrscht in den Kirchen!“, fuhr er in Eifer entbrannt fort. „Allerorten stürzen ihre Dächer ein. Uns ängstigt das morsche Gebälk, wie es knarrt und knirscht. Das Regenwasser kommt nicht etwa tropfenweise, sondern wie ein Platzregen auf die geheiligten Altäre hernieder! Er behindert uns, die wir viel zu bitten haben in diesen Zeiten und zwingt uns, das Haus des Herrn so schnell wie möglich wieder zu verlassen.“
Stephanus hatte sich mit der Zeit und dem Wein so in Rage geredet, dass es ihm schwerfiel, einen anderen Sinn zu finden. Er hatte es denn auch verstanden, mir einen guten Eindruck zu vermitteln, warum zwischen dem Herrn Papste und dem Heiligen Kaiser eine solche Feindschaft herrschte wie in der Natur zwischen Wolf und Lamm. Noch am Ostertag des Jahres 962 hatte der Papst Johannes XII. in schönster Einhelligkeit mit dem Kaiser dessen Krönung vollzogen. Die beiden Männer waren trotz des großen Altersunterschiedes von beinahe dreißig Jahren durch eine enge Freundschaft verbunden. Sie war aber nur von kurzer Dauer. Ich verstand, dass der ungeheure Machthunger des Kaisers Otto und seine immer wieder aufflammenden Herrschaftsansprüche in der Provinz Capua und im Benevent6), welche jedoch dem oströmischen Reiche des mächtigen Kaisers Nikephoros untertan waren, den Papst verdrießlich machten und ihn nun umso mehr um seine eigene Position fürchten ließen. Um sich die Feindschaft des Kaisers ungestraft erlauben zu können, machte er sich den mächtigen Berengar von Ivrea und dessen gierigen Sohn Adalbert zum Vormund, zum Beschützer und Verbündeten.
Kaiser Otto, der von dem unerwarteten Kurswechsel des noch jungen Papstes zunächst überrascht war, brachte schon kurz darauf väterliches Verständnis für ihn auf: Er sei noch ein Kind, sagte er zu mir, er werde leicht durch das Beispiel guter Männer zu bessern sein. Und er hoffe noch, fügte er hinzu, dass jener sich durch einen Tadel in Ehren und freimütige Ermahnung mühelos von diesen argen Dingen freimacht.
Doch schon bald waren die Prioritäten für den Kaiser anders gesetzt. Vor der Hand forderte die Reihenfolge, den untreuen Berengar aus den Bergen zu vertreiben, da er sich noch in der Feste San Leo hielt, dann erst wollte er dem Herrn Papste mit väterlicher Ermahnung zureden. Wenn nicht aus freien Stücken, so fügte er dem Gesagten hinzu, so wird der Papst doch aus Scham sich in einen vollkommenen Mann verwandeln. Und wenn er so vielleicht gezwungenermaßen bessere Sitten annimmt, so wird er sich schämen, sie wieder abzulegen. Ich stimmte dem Erhabenen Kaiser zu und machte mich, wie oben beschrieben, mit dem Bischof Landward und den anderen auf den Weg nach Rom, um zu sehen, was wir für ihn ausrichten konnten.
Als die Stunde des nächsten Tages nahte, in der wir erneut vor den Papst treten sollten, um unsere Gesandtschaft zu erfüllen, wurden wir vom Diener Salek direkt vor der Herberge in Empfang genommen. Der Guten-Morgen-Gruß, den er uns etwas mürrisch entbot, war überhaupt das erste Wort, welches er an mich richtete. Nun gut, er mochte uns offenbar nicht, wir ihn aber auch nicht. So taten wir uns wenigstens nichts, da wir das nun voneinander wussten.
Zu meiner und auch Bischof Landwards allgemeiner Überraschung war der Herr Papst auch bei diesem Empfang nicht allein anwesend. Aber weniger dieser Umstand, als vielmehr die erstaunliche Tatsache, um wen es sich bei seinem Besucher handelte, vermochte uns wahrhaftig zu verwundern. Kein anderer als Adalbert von Ivrea, Sohn des Berengar und der Willa, saß seitlings des in goldenem Samte glänzenden Papstthrones auf einem bequemen Stuhle, welcher aber nicht dem Papste, sondern uns zugewandt war, so als wäre er nicht Gast, sondern Gastgeber in diesem Hause.
So kam es, dass wir unsere Ehrerbietung gegenüber dem Herrn Papste in gewisser Weise auch an ihn richten mussten, denn wie es sich gehört, verneigten wir uns tief und lange vor dem obersten Bischofe. Adalbert nahm es mit sichtbarer Genugtuung und Freude auf, worunter ich sehr litt. Dem braven Franco jedoch machte dies nichts aus – er lächelte einfach zurück.
Johannes XII. forderte sodann Bischof Landward auf, des Kaisers Anliegen nun vorzutragen. Der brave Bischof begann etwas umständlich mit der Einleitung, bevor er ein Schriftstück entrollte und daraus des Kaisers Botschaft verlas:
Dass der Papst sich zu bessern und sein Betragen zu ändern verspricht, dafür sage ich ihm meinen Dank. Wenn er mich aber beschuldigt, mein Versprechen nicht gehalten zu haben, so urteilt selbst, ob das wahr ist. Wir versprachen ihm das ganze Gebiet des Heiligen Petrus7), welches in unsere Gewalt kommen würde, zurückzugeben. Und das ist der Grund, weshalb wir uns jetzt darum bemühen, den Berengar mit seinem Anhang aus dieser Festung zu vertreiben. Denn wie sonst können wir ihm dieses Gebiet zurückgeben, wenn wir es nicht vorher den Händen der Räuber entreißen und in unsere Gewalt bringen? An der Festnahme des Zachäus in Capua trifft uns ebenso wenig eine Schuld. Wir wissen aber auch, dass der Herr Zachäus, obwohl er ein verworfener Mensch ist, der göttliche und menschliche Schriften nicht kennt, vom Herrn Papste erst kürzlich zum Bischof geweiht wurde, jetzt aber zu den Ungarn abgesandt ist, um ihnen zu predigen, dass sie über uns herfallen sollten. Dass der Herr Papst solches getan hat, würden wir nicht glauben, wenn es nicht durch einen Brief mit seiner Bleibulle und seinem Namenszuge bestätigt würde.
Als wir dies der Ordnung gemäß vorgetragen und beeidet hatten, sahen wir weder Einsicht bei dem Herrn Papste noch beim Herrn Adalbert. Schon bei der Erwähnung des Berengars sah ich in den Zügen Adalberts eine verabscheuungswürdige Grimasse, die der Papst mit einer ebenso entsetzlichen Geste beantwortete. Ich konnte dem Adalbert dies nicht verdenken, denn schließlich hört niemand gern Unbilliges über seine engsten Verwandten. Aber dem Herrn Papste verüble ich dies sehr wohl!
Johannes XII. schickte uns hinaus, um sich mit seinen Getreuen und seinem neuen Kumpan zu beraten. Auch dies war ein sehr ungebührliches Verhalten, wie mir Bischof Landward, der ebenfalls sehr kundig und geübt in gesandtschaftlichen Angelegenheiten war, bestätigte. Als wir ohne jede Form durch die verschlossenen Türen wieder hereingerufen wurden, standen neben Adalbert auch der Camerlengo Salek und zwei Männer des römischen Klerus beim Herrn Papste, die ich zuvor nicht gesehen hatte. Ich suchte den Raum nach dem Kanzler Leo ab, konnte ihn aber nirgends entdecken.
Der Herr Adalbert teilte uns mit, dass er dem heiligen Kaiser seine Versprechungen und Eide nicht glauben werde und dass er aus sicherer Quelle wisse, dass der Kaiser auf Rom marschieren werde, kaum, dass er den von Gottes Gnaden einzigen und gerechten König von Italien, wie er seinen Vater Berengar benannte, verjagt oder, was der Herr verhindern möge, gar Schlimmeres angetan hätte. Die anwesenden Kleriker nickten stumm und auch der Papst stimmte dem ohne ein weiteres Wort zu, womit klar war, dass unsere Gesandtschaft an diesem Punkte gescheitert war. Landward und ich sahen uns einige Augenblick lang unschlüssig an, aber genau genommen war er ebenso überzeugt davon, hier nichts mehr ausrichten zu können. Was uns blieb, war nur der Rückzug.