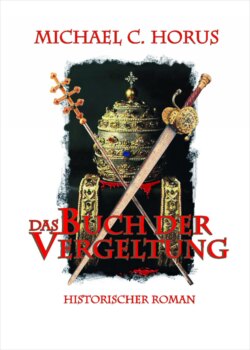Читать книгу Das Buch der Vergeltung - Michael C. Horus - Страница 7
3. Kapitel
ОглавлениеDer große Kaiser Otto und seine Gemahlin Kaiserin Adelheid waren mit einer gewaltigen Streitmacht nach Italien gekommen, sodass es ihnen möglich war, sie ohne Besorgnis hälftig aufzuspalten und damit an zwei Orten gleichzeitig aufzutreten. Einen Teil seiner Truppen ließ der Kaiser in Rom zurück, wobei er sorgsam darauf bedacht war, die Belastungen für die Stadt durch Unterhalt und Plünderungen so gering wie möglich zu halten. Das meiste Volk Roms pries ihn dafür in hohen Worten, ein anderer, viel kleinerer Teil hatte auch daran wieder etwas zu meckern, beschimpfte und bespuckte die Soldaten auf das Übelste und trat sie mit den Füßen, bis sie sich auf ihre Art wehrten und zurückschlugen.
Es war sehr unruhig in diesen Zeiten. Schnell konnte man in einen Tumult geraten, ganz ohne eigenes Verschulden.
Währenddessen gelang es dem Kaiser mit der anderen Hälfte der Armee, die Bergfeste San Leo einzunehmen und den Berengar samt seiner gierigen Frau Willa gefangen zu nehmen. Dies sollte ein Glückstag für alle Bewohner des Reiches sein, bedeutete die lebendige Festsetzung der Rebellen doch nicht nur das Ende des unseligen Krieges, sondern auch einen guten Ausgangspunkt, um den mächtigen Freunden des Königs mit Vernunft und Augenmaß Verhandlungen über die Zukunft Italiens anzubieten.
Kaiser Otto und Kaiserin Adelheid waren sich nach Gottes Willen durchaus im Klaren darüber, dass der Frieden nur so lange hielt, wie sie selbst hier vor Ort waren, wenn es ihnen nicht gleichzeitig gelang, die wichtigsten Machtpositionen südlich der Alpenberge mit loyal gestimmten Anhängern zu besetzen. Dass diese nur aus den Reihen der lothringischen oder italischen Herrscherfamilie kommen konnten, wagte niemand in Zweifel zu ziehen. Kaiserin Adelheid sollte hierbei als Witwe des verstorbenen Königs Lothar II. und damit Erbin des italischen Thrones eine besondere Rolle spielen.
Allein Berengars und Willas aufrührerischer Sohn Adalbert von Ivrea ließ sich nicht einfangen. Er versteckte sich allerorten, tauchte hier und da auf (man sah ihn auf Korsika und Sardinien ebenso wie in der Ebene des Eridanus9) und in Rom) und scharte beständig neue Truppen um sich, mit denen er Unruhen anstiftete und das römische Volk gegen den Besetzer, wie er den großen und gerechten Kaiser nannte, aufhetzte.
Auf Bitten der römischen Bischöfe und des Volkes von Rom, welche den unwürdigen Papst Johannes XII. nicht länger ungestraft sehen wollten, versammelte sich in den Nonen des Novembers in der Kirche des Heiligen Petrus eine große Anzahl heiliger Männer und hoher Herren der Stadt in Gegenwart des Erhabenen Kaisers. Meine geringe Niedrigkeit selbst zählte zu den Versammelten, woraufhin ich mit gutem Wissen sagen kann, dass sich an die vierzig Bischöfe und Erzbischöfe, viele Dutzende ehrwürdiger und heiliger Brüder aus allen Teilen Italiens und des Reiches, auch die vornehmste Spitze des römischen Adels mit Demetrius Meliosi, Crescentius Caballi marmorei und weiteren ehrenwerten Herren, hier eingefunden hatten.
Der Patriarch Ingelfred von Aquileja, den eine in Rom plötzlich ausgebrochene Krankheit ergriffen hatte, sandte als seinen Statthalter den Diakon Rudolf, und ich musste mich nach einem kurzen Gespräch mit dem Diakon ernsthaft um den ehrwürdigen Ingelfred sorgen.
Ich sah viele der mir bestens vertrauten Brüder, so die Erzbischöfe Waldpert von Mailand, Petrus von Ravenna und aus Sachsen den Adeltac, überdies die Bischöfe von Parma, Reggio, Pisa, Siena, Florenz, Pistoia, Camerino, Spoleto, alle Bischöfe aus dem römischen Sprengel, dann die von Gallese, Civita Castellana, Alatri und Orte, von Trevi und Terracina, Forum Clodii und Ferentino, den Landward von Minda und den Otger von Spira. Viele weitere Namen und Orte könnte ich aufzählen, Kardinäle und Anwälte, Werkmeister, Vorsteher und Schatzmeister. Sie alle stehen für heilige und ehrwürdige Männer, die in dieser schwierigen Stunde nach Rom gekommen waren, um miteinander und mit dem Heiligen Kaiser zu beratschlagen. Der Gemeine Petrus Imperiola, Anführer der römischen Miliz, war mit einer gehörigen Abteilung seiner besten Männer ebenfalls zugegen. Besonders bemerken möchte ich aber die Anwesenheit des ehrwürdigen Herrn Leo von der päpstlichen Kanzlei, der mir stets ein besonders guter und loyaler Freund war.
Mein braver Schüler Franco war von der Heiligkeit und dem Glanze der vielen hohen Herren so bewegt und gerührt, dass er ihnen staunend und mit offenem Munde folgte, bis ich ihn zurückrief und ihm einen Platz, am Rande schräg hinter mir, zuwies. Dort setzte er sich artig und konnte seinen Blick nicht vom Kaiser wenden.
Ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, die Worte des Kaisers, die er in seiner sächsischen Sprache sagte, an die Versammlung zu übersetzen und ebenso zurück, was die Versammlung dem Kaiser zu sagen hatte.
Als all diese werten Herren nun ihre Plätze genommen hatten und auf ein Zeichen des Heiligen Kaisers in größte Stille fielen, begann er, indem er sich feierlich erhob.
„Wäre es nicht diesem großen Moment angemessen, wenn der Herr Papst bei dieser herrlichen und Heiligen Versammlung zugegen wäre?“, fragte er in die Versammlung.
Ein Raunen und Murmeln erfüllte den Raum, bis auf sein erneutes Zeichen wieder alles Laute erstarb.
„Ich bitte Euch, hochverehrte heilige Männer, die Ihr mit ihm gelebt und gearbeitet habt, sagt mir, warum er aber einer so ansehnlichen Synode ausgewichen ist?“
Die hohen Herren entgegneten ihm darauf erstaunt, dass das wohl kein Geheimnis mehr sei. Der Papst sei keiner, der in Schafskleidern komme, inwändig aber ein reißender Wolf ist. Längst treibe er so offen des Teufels Werk, dass er auf alle Umschweife verzichte.
Nun wurden die Anschuldigungen gegen den Papst einzeln vorgebracht, wobei ich mit den Übersetzungen aller Wörter in die eine wie in die andere Richtung kaum mehr hinterherkam.
Der Kardinalpriester Petrus erhob sich aus den Reihen und bezeugte, dass er gesehen habe, wie der Papst die Messe gefeiert habe, ohne zu kommunizieren. Bischof Johannes von Narni erklärte, er wäre Zeuge gewesen, wie der Beschuldigte einen Diakon in einem Pferdestall und nicht zu der festgesetzten Zeit geweiht habe. Der Kardinaldiakon Benedictus und die übrigen Priester und Diakone sagten, nach dem Kirchenraube brauche man wohl nicht zu fragen, denn darüber belehre uns der allgemeine Augenschein besser als alle Worte. Über seine ehebrecherischen Handlungen sagten sie aus, sie hätten dergleichen zwar nicht mit eigenen Augen gesehen, wüssten aber ganz gewiss, dass er mit der Beischläferin seines Vaters, der Witwe Anna und ihrer Nichte und außerdem mit der Frau Stephana Unzucht getrieben habe. Den Heiligen Palast habe er zu einem Hurenhaus gemacht. Überdies habe er des Teufels Minne getrunken (was alle, Geistliche wie Laien, bezeugten) und beim Würfelspiel die Venus, den Jupiter und andere Dämonen um Hilfe angerufen.
Nachdem der Kaiser all dies vernommen hatte, beriet er sich mit seinen Getreuen und sagte dann: „Nun, wenn es so ist, will ich es gern glauben. Bedenkt aber, edle und heilige Herren, was wir an uns selbst schon oft erfahren haben: Männer in hohen Würden werden von Neidern und Feinden verleumdet und verrufen. Der Gute missfällt den Bösen ebenso sehr wie der Böse den Guten.“
Er machte eine Pause, um mir Gelegenheit zu geben, alles wortgetreu zu übertragen, und auch den heiligen Herren, das Gesagte gut zu verstehen.
„Und das ist der Grund“, fuhr er sodann fort, „warum uns die Anklagen, welche hier vorgebracht wurden, bedenklich erscheinen. Zweifelhaft ist uns, ob dieselben vom Eifer für das Recht oder von gottloser Missgunst eingegeben sind. Deshalb beschwöre ich, kraft der mir anvertrauten Würde, Euch alle bei Gott, den auch Ihr nicht täuschen könnt, und beim kostbaren Leichnam des Apostelfürsten Petrus, in dessen Kirche dies hier vorgetragen wird, dass niemand den Herrn Papst einer Sünde bezichtige, die nicht wirklich von ihm begangen wurde und die zudem von glaubwürdigen Männern bezeugt wurde.“
Hierauf entgegneten alle Anwesenden gleichzeitig wie ein Mann, dass sie verflucht sein wollen und am Jüngsten Tage auf eine Seite gestellt werden wollten mit jenen, denen Gott das Tor zum Himmelreiche verwehrt, wenn nicht all dies und noch viel Schlimmeres von unserem Herrn Papste Johannes tatsächlich verübt und begangen worden ist. Zum letzten Beweis führten sie noch an, was sich tatsächlich fünf Tage zuvor am Ufer des Tevere ereignet hatte. Der Papst, mit dem Schwert umgürtet und mit Schild, Helm und Panzer bekleidet, trat dem ganzen Heere des Kaisers Otto entgegen und entblößte ihnen sein Hinterteil, nur getrennt durch den Tevere-Strom, der verhinderte, dass er in diesem Aufzuge gefangen wurde. Nun schien auch der Kaiser, da er von dieser schändlichen Tat schon durch seine Heerführer erfahren hatte, überzeugt von der Schuld des Papst Johannes.
Die versammelten Herren setzten ein Schreiben an den Obersten Bischof und Allgemeinen Papst auf, in welchem sie ihm eine Vorladung schickten. Auf Wunsch des Kaisers sollte es einige der aufgeführten Anschuldigungen enthalten, aber gerade nur so viele, dass der Herr Papst sich gezwungen sähe, Argumente zu seiner Verteidigung persönlich vorzubringen und der Einladung somit folgte und nicht schon vorab verprellt würde. Die adligen und heiligen Herren stimmten dem geschlossen zu und priesen den Kaiser in seiner Weisheit und Gerechtigkeit.
Als der Papst Johannes diesen Brief erhalten und gelesen hatte, schrieb er der Heiligen Synode folgende Antwort:
Bischof Johannes, der Knecht der Knechte Gottes, an sämtliche Bischöfe. Wir haben gehört, dass ihr einen anderen zum Papste erwählen wollt. Wenn ihr das tut, so banne ich euch vor Gott dem Allmächtigen, dass ihr nicht die Macht habt, keinen zu weihen und die Messe zu feiern.
Noch bevor dieser Brief verlesen wurde, kamen weitere hohe und ehrenwerte Männer hinzu: aus Lotharingien Heinrich, der Erzbischof von Treveris, aus Emilien und Ligurien Wido von Modena, Gezo von Tortona und Sigulf von Piacenza. Mit ihrem Ratschlusse verfasste die Synode nunmehr eine Antwort an den Papst. Zunächst wurde nur festgestellt, dass der Herr Papst keinerlei begründete Entschuldigung für sein Fernbleiben von der Synode vorgebracht habe. Es ging weiter mit den folgenden Worten:
Auch enthielt Euer Brief noch etwas Anderes, das kein Bischof schreiben durfte, sondern nur ein einfältiges Kind. Denn Ihr habt alle in den Bann getan, dass sie Macht haben sollten, Messen zu singen und die kirchlichen Handlungen vorzunehmen, falls wir einen anderen Bischof auf den Römischen Stuhl setzen. Denn so steht es geschrieben: ‚dass ihr nicht die Macht habt, keinen zu weihen’. Bisher haben wir geglaubt oder sind vielmehr überzeugt gewesen, dass zwei Verneinungen eine Bejahung ausmachen. Sollte es denn so sein, dass Eure ungeheure Machtfülle auch die Lehrsätze der Grammatik aufhebe?
Wir wollen aber auf das, was Ihr habt sagen wollen, und nicht auf Eure Worte antworten. Wenn Ihr denn nun zur Synode erscheint und Euch von allen Anwürfen reinigt, wollen wir Euch wohl den gebührenden Gehorsam erweisen.
Gegeben in den neunten Kalenden des Dezembers und überbracht durch den Kardinalpriester Adrianus und den Kardinaldiakon Benedictus.
Als die beiden Abgesandten der Synode den päpstlichen Palast erreichten, trafen sie den Hausherrn nicht mehr an. Niemand konnte ihnen sagen, wo er sei, und hinter vorgehaltener Hand meinte man, er sei auf die Felder gegangen mit Pfeil und Bogen, um zu jagen. Da sie ihn also nicht finden konnten, kehrten sie unverrichteter Dinge mit dem Schreiben zur Synode zurück, die sich alsbald ein drittes Mal in dieser Angelegenheit versammelte.
Der Kaiser nahm erneut das Wort und beklagte die Unvernunft und Würdelosigkeit des Johannes: „Nun, da wir Gewissheit haben, dass er nicht kommen wird“, sagte er, „bitte ich Euch edle und heilige Herren, mit sorgsamer Aufmerksamkeit anzuhören, welche Treulosigkeit und Falschheit derjenige zeigt, über den wir zu beratschlagen haben. Wir tun Euch also kund, dass dieser Papst Johannes, als er von unseren rebellischen Vasallen Berengar und Adalbert bedrängt wurde, an uns nach Sachsen Boten gesandt hat mit der Bitte, aus Liebe zu Gott ihn selbst und die Kirche des Heiligen Petrus aus ihrem Rachen zu erretten. Nachdem aber der Papst durch meine Bemühungen aus ihren Händen befreit und wiedereingesetzt worden war, hat er, entgegen des Eides und der Treue, die er mir auf den Leib des Heiligen Petrus geschworen hat, denselben Adalbert nach Rom berufen und gegen mich in Schutz genommen. Er hat überdies allerlei Unruhe und Empörung vor den Augen unserer Krieger angestiftet, indem er am anderen Ufer des Stromes mit voller Rüstung und nacktem Hinterteil aufgetreten ist.“
Hierauf antworteten die Bischöfe und die ganze übrige Geistlichkeit, dass ein noch nie dagewesenes Geschwür mit einem entsprechenden Brenneisen ausgebrannt werden müsse. Der Kardinaldiakon Benedictus fügte hinzu: „Wenn seine Verdorbenheit nur ihm allein und nicht der Gesamtheit schadete, so müsste man ihn, so gut es ginge, erdulden. Aber wie viele, die vorher keusch waren, sind durch sein Beispiel zur Unkeuschheit gekommen? Und wie viele würdige Männer sind durch das Vorbild seines Wandels zur Nichtswürdigkeit verleitet worden? Wir alle bitten den Erhabenen Kaiser, jenes Ungeheuer, dessen Laster durch keine Tugend aufgewogen wird, aus der Heiligen Römischen Kirche auszustoßen und an seine Stelle einen anderen zu setzen, der uns durch das Beispiel seines untadeligen Wesens zugleich zu leiten und zu fördern vermag.“
Der Kaiser sah zu mir herüber, und ich wusste, während ich noch mit der Übertragung ins Sächsische angestrengt war, dass er bereits gut verstanden hatte, was der ehrwürdige Benedictus im Auftrage seiner Brüder wünschte. Auf seinem Gesichte zeichnete sich ein stolzes und freundliches Lächeln ab, während er auf das Ende meiner Rede wartete.
„Es gefällt uns, was Ihr sagt“, antwortete er feierlich, „und ich sage Euch, dass uns nichts angenehmer erscheint, als einen Besseren zu finden, der auf den Heiligen Stuhl des Apostelfürsten gesetzt wird.“
Die Synode beriet sich daraufhin mit großer Zufriedenheit und legte eine Pause ein, in welcher spanischer Wein, Bier und bestes florentinisches Backwerk für alle gereicht wurden.
Die Miliz unter Petrus Imperiola verließ nach dem gemeinsamen Mahl die Petruskirche und stellte sich draußen vor dem großen Haupttor zu einer geschlossenen Abteilung auf, sodass nun die edlen und heiligen Männer ganz unter sich waren. Sodann konnte die von allen ersehnte Papstwahl abgehalten werden. Die Suche nach einem würdigen und untadeligen Nachfolger erwies sich als viel einfacher, als ich befürchtet hatte. Schon nach kurzer Zeit einigten sich die hohen und heiligen Herren darauf, den Leo, den ehrwürdigen Kanzler der Heiligen Römischen Kirche, den bewährten und der höchsten Stufe des priesterlichen Amtes würdigen Manne zum Obersten Bischof und Allgemeinen Papste zu wählen, nachdem sie den abtrünnigen Johannes wegen seines gottlosen Wandels abgesetzt hatten. Sie alle riefen mit einer Stimme nach ihm und wiederholten ihren Ruf an die drei Mal, was sich in meinen Ohren wie ein Festgesang anhörte.
Franco hatte nicht einen Moment dieser gesamten Prozeduren ohne Aufmerksamkeit verfolgt. Er war wie gebannt von der Schicksalhaftigkeit und Würde des Augenblicks und überschüttete mich, wenn ich gerade nicht in meine ehrenvollen Pflichten dem Kaiser gegenüber eingebunden war, mit Fragen zu diesem und jenem. Besonders interessierte ihn jedoch, wie der Herrgott selbst wohl über den Johannes denken und urteilen mochte, und er fragte mich, warum der Herr nicht einschreite, wenn ihm ein solches Übermaß an Gottlosigkeit und teuflischem Frevel bei seinem höchsten Knecht begegnete. Ich antwortete ihm, dass es nicht Gottes Aufgabe sei, zu verurteilen und zu strafen, da er ein Gott der Güte und des Friedens sei. Er verzeihe den reuigen Sündern, wenn sie sich ihm offenbarten, und nehme jegliches Schaf wieder in seine Herde auf, auch wenn es sich um ein schwarzes Schaf handele.
Im Stillen hoffte ich jedoch, dass ihn bei aller Anteilnahme an den wunderbaren Ereignissen dieser römischen Versammlung nicht das Bedürfnis überkommen möge, selbst das Wort zu ergreifen und vor der Heiligen Synode sein eigenes Erleben im Lateranensischen Palast zu schildern. Ich vermochte mir nicht vorzustellen, welchen Eklat dies unter den Anwesenden auszulösen imstande gewesen wäre, wenngleich ich eingestehen muss, dass mein lieber Franco doch alles Recht hatte, seiner geschundenen Seele Ausgleich zu verschaffen und seinen Teil zur besseren Beurteilung des teuflischen Unholds auf dem Apostolischen Stuhle beizutragen. Zum Glück kam ihm dieser Gedanke aber nicht, er schwieg voller Ergriffenheit und ich war’s zufrieden.
Leo selbst war zu diesem Tage, es war in den achten Nonen des Dezembers im Jahre 963 nach Christi Geburt, nicht in der Synode, da er als oberster Kanzler der Heiligen Römischen Kirche, wie es seine Aufgabe war, den Herrn Papst während seiner Abwesenheit oder Krankheit zu vertreten hatte. Mit der Zustimmung des Kaisers zogen die Bischöfe, die Priester, die Diakone und die übrige Geistlichkeit und das ganze römische Volk gemäß der Tradition unter dem Gesang des Laudes feierlich zum Lateranensischen Palast, um den eben genannten Leo zu holen. Zur festgelegten Zeit brachten sie ihn in die Kirche des Heiligen Petrus und erhoben ihn durch die heiligen Worte zur höchsten Priesterwürde und schworen ihm den Eid der Treue.
Als das dem sogenannten Papste Johannes bekannt wurde, schickte er Boten nach Rom, aber nicht zu den adligen Familien, sondern zum gemeinen Volke, welches sich auf den Straßen und Plätzen, in den Wirtsstuben und Badehäusern zusammenfand. Er wusste sehr wohl, wie leicht der Sinn der Römer durch Geld zu verführen war, hatte er dies doch schon allzu oft erlebt und zu seinem Gewinn genutzt. Er versprach ihnen reichen Lohn und den Schatz des Heiligen Petrus und sämtlicher anderer Kirchen, wenn sie über den gütigen Kaiser und den neuen Papst Leo herfallen und sie alsbald ums Leben bringen wollten.
Da das kaiserliche Heer nur noch in geringer Zahl die Stadt belagerte, fühlten sie sich durch dieses Ansinnen ermutigt und betört zugleich. Auf ein Signal hin sammelten sie sich mit ihren Wagen auf einer Brücke über den Fluss Tevere und griffen den Kaiser an. Dieser hatte jedoch keine Mühe, mit seinen kampferprobten und tapferen Soldaten dem Frevel ein Ende zu machen. Sie trieben die Aufständischen wie Hasen durch die Straßen und es hätten noch viele Römer weniger den ungleichen Kampf überlebt, wenn sich nicht der ehrwürdige Papst Leo selbst vor sie gestellt hätte und den frommen Kaiser auf den Knien um Gnade und Barmherzigkeit angefleht hätte. Der Heilige Kaiser berief seine blutdürstigen Krieger ab und gewährte den Römern gegen Stellung von Geiseln den Frieden. Als Leo ihn schließlich noch bat, auch die soeben erst gestellten römischen Geiseln zurückzugeben, war des hohen Kaisers Herz so weit und sein Verstand so mächtig, ihm auch dies zu gewähren, auf dass es seiner Wertschätzung und Auszeichnung bei den Römern zu Hilfe kommen möge.
Nun lag Rom dem neuen Papste dankbar und glücklich zu Füßen.
Franco und ich verließen die Synode in der sicheren Gewissheit, nunmehr den würdigsten und gerechtesten unter den heiligen Männern zum Höchsten und Allgemeinen Papste gewählt zu haben, und ich bin ebenso sicher, dass viele meiner Brüder gerade so wie ich dachten. Zufrieden kehrten wir zu unserer Herberge zurück und genossen im Hause der untadeligen Brüder Imiza einige der schönsten Abende bei edlem Wein und Speisen, bevor wir im Februar nach Cremona abreisten, wohin mich längst liegengebliebene Pflichten riefen und zudem die ehrenvollen Aufgaben eines Bischofs erwarteten.
Für meinen braven Schüler konnte ich einen guten Lehrer gewinnen, der ihn, so oft es ging, an meiner statt in der höheren Kunst der Arithmetik und auch der Geometrie unterrichtete, wo es über die einfachen und gewöhnlichen Dinge hinausging. Zugegeben, diese beiden Meisterschaften, die zusammen mit der Astronomie und der Musik das Quadrivium bildeten, und denen ich nicht in gleichem Maße stark und gewachsen war wie der Grammatik, der Rhetorik und der Dialektik, brachten mich immer öfter in Verlegenheiten. Letztere Künste, auch das Trivium10) genannt, waren mir weitaus besser bekannt, wie der geneigte Leser sich leicht vorzustellen vermag.
Franco, der ein sehr gelehrsamer und heller Schüler war, hatte es wohl verdient, von den besten Lehrmeistern seines Faches unterwiesen zu werden, und so ließ ich mir seine Ausbildung einiges an Silber kosten, was mich aber nicht reute.
Die Nachricht vom plötzlichen Tode des abgesetzten Papstes Johannes erreichte mich in der Vesperstunde mit einem berittenen Boten, der von Papst Leo zu mir nach Cremona ausgesandt worden war. Ich war gerade im Gebete vertieft, als einer meiner Diener den Besucher ankündigte, der mir eilig einen Brief aushändigte und dann ohne Verweil weiterritt. Ich hätte gern noch das eine oder andere Wort mit dem Boten gewechselt, weil an unbeschädigte Neuigkeiten aus Rom heranzukommen nicht eben immer leicht war. Seit unserer Abreise von dort waren zwei volle Monde vergangen und mich dürstete nach Informationen zum Stand der Dinge vor Ort. Ich sehnte das Ende des Krieges in Italien herbei und hatte allerlei Fragen zu dem unwürdigen Gerangel um den Stuhl des Apostelfürsten. Mir war durchaus bekannt, dass der abgesetzte Papst Johannes bis zu seinem Ende immer noch Ansprüche auf den Heiligen Stuhl geltend machen wollte und dass dieses Verlangen vom höchsten römischen Adel, dem er ja auch entstammte, gestützt wurde.
Im Februar hielt er sogar eine Synode ab, die die Beschlüsse der vorhergehenden Synode für ungültig erklärte. Ein gottloses und unwürdiges Spektakel reihte sich an das andere. Nur die gnadenvolle Anwesenheit des Kaisers vermochte den Johannes ein ums andere Mal in die Schranken zu verweisen und zeitweilig aus Rom zu vertreiben. Doch kaum hatte sich der Kaiser ein Stück weit entfernt, kam der Johannes wieder zum Vorschein, sammelte neue Truppen um sich und bedrängte den legitimen Papst Leo auf seinem Stuhle. Man stelle sich nur diese Hinterhältigkeit vor, den Verrat am frommen Kaiser Otto und seinem Sohne König Otto, den der Adel und große Teile des römischen Klerus auf ganz offene Weise begingen. Hatten sie nicht zuvor mit ihm gemeinsam und in größtem Einvernehmen den Leo auf den höchsten Bischofsstuhl gehoben?
Als der gütige Kaiser, dem Wunsche seiner ebenso klugen wie Erhabenen Gattin und Mitkaiserin Adelheid folgend und, um die Stadt und das Volk Roms vor zu großen Lasten zu beschützen, im Frühjahr einen weiteren Teil seines Heeres zur Heimkehr entsandte, kam es erneut zu einem offenen Aufstande der römischen Adligen und ihrer Milizen, welcher aber auch mit minderer Stärke leicht von Otto niedergeschlagen werden konnte. So war ich also sehr gespannt darauf, zu erfahren, was die letzten Tage und Wochen an Neuem gebracht hatten.
Der päpstliche Bote versprach, mich auf dem Rückweg, soweit er es einrichten konnte, noch einmal zu besuchen und Zeit für ein Gespräch mitzubringen. Der Todesfall des Johannes hatte sich schon in den zweiten Nonen des Mai ereignet, wie ich aus dem Brief erfuhr, und man redete insgeheim davon, dass er von einem gehörnten Ehemanne beim Verkehr überrascht und hernach erschlagen worden sei11). So endete dann also der Sohn des einst ruhmvollen römischen Princeps Alberich und Enkel der selbsternannten Senatrix Marozia als Opfer seiner eigenen Zügellosigkeit. Aber nicht nur das, er war wohl auch das Opfer des Widerspruchs, in welchem er sich als Erbfürst von Rom und gleichzeitig als Römischer Papst befand. Seine unreife Jugend, seine edle Abkunft von jenem großen Römergeschlecht und sein tragischer innerer Zwiespalt könnten ihm leisen Anspruch auf ein milderndes Urteil vor dem Allmächtigen Herrn gegeben haben.
Ich ließ die Nachricht vom Tode des Johannes von einem Diener sogleich an Franco überbringen, obwohl ich gern selbst gesehen hätte, wie er es aufnimmt. Diesen indirekten Weg wählte ich nur aus dem einen Grunde, um nicht alte Wunden in ihm wieder aufzureißen. Franco und ich hatten seit dem Ende unserer kurzen Kerkerhaft nicht mehr über die erschrecklichen Vorgänge im Lateranensischen Palast gesprochen. Auch war ich mir nicht sicher, welches Gefühl er dem Johannes gegenüber damals noch hegte.
Sei es, wie es sei, sagte ich mir und dankte dem Herrn im Gebet für seine unendliche Weisheit und Gnade und dafür, dass er dem unheiligen Treiben dieses Halunken ein so versöhnliches Ende gesetzt und ihn aus der Welt geschafft hatte.
Ich für meinen Teil hoffte, der Johannes möge in der Hölle schmoren.
Nun, da sich der Mai dem Ende zuneigte, setzte ich einen Brief an meinen Freund Leo auf, der nunmehr ganz unbestritten der Oberste Bischof Roms und Allgemeiner Papst war. Ich dankte ihm in herzlichen Worten für seine stets interessanten und höchst erfreulichen Neuigkeiten, auch um ihn anzuspornen, davon noch mehr zu tun. Mit diesem Briefe in der Hand wollte ich warten, bis der päpstliche Bote sein gegebenes Versprechen einlöste und auf dem Rückweg bei mir einkehrte.
Es ergab sich aber anders.
In den dritten Iden des Junis klopfte erneut ein päpstlicher Bote an meine Pforte. Er brachte neue Kunde aus Rom, diesmal nicht in einem Briefe, sondern als Botschaft, die er aus dem freien Gedächtnis heraus vortrug. Was ich nun hören musste, beunruhigte mich zutiefst: Die Römer hatten sich ein weiteres Mal gegen die kaiserliche Hoheit aufgelehnt und den rechtmäßigen und ehrwürdigen Papst Leo, den sie nun doch nicht mehr haben wollten, vertrieben. Dass sie ihn überhaupt am Leben ließen und mit einer Handvoll Gefolgsleute die Flucht zum Kaiser nach Pavia ermöglichten, verdankte er wohl nur seinem zuvor untadeligen und selbstlosen Auftreten, mit welchem er die römischen Geiseln aus der Hand des gerechten Kaisers, der sie ohne Not hergab, befreit hatte. Einige Römer erinnerten sich in ergebener Dankbarkeit daran und sprachen sich vor dem versammelten Volke für ihn aus.
Da nun der Apostolische Stuhl vakant war, hatten sie einen ihrer Getreuen auserwählt, um ihn zum Obersten Bischof und Allgemeinen Papste zu weihen. Der, den sie für würdig hielten, war noch wenige Monate zuvor ein treuer Diener und Gefolgsmann des Kaisers und des wahren Papstes Leo. Es war der Kardinaldiakon Benedictus, den sie zwar in Furcht vor der Ankunft des Kaisers, aber keineswegs eingedenk ihres geleisteten Eides ordinierten und auf den Stuhl des Apostelfürsten Petrus setzten. Es war der gleiche Benedictus, der inmitten der Heiligen Synode mit seinem klugen und gewissenhaften Benehmen für Bewunderung und Aufsehen gesorgt hatte und der sich in den barbarischen Wirren Roms den seltenen Titel eines Grammaticus erworben hatte.
Die in mehrere Fraktionen zerstrittenen Römer warteten damit nur ganze sieben Tage lang, kaum lang genug, um die vorgeschriebene Einwilligung einzuholen, was sie aber auch gar nicht vorhatten. Als aber der Kaiser davon hörte, rückte er, erbost von so viel ehrloser Tücke, mit seinem Heer nach Rom und sperrte es von allen Seiten ab, damit auch kein Ausweg offenbliebe. Der oben genannte Benedictus, zwar ehrenwert im Geiste, doch fälschlich Papst genannt, wandte sich nun ganz und gar vom Kaiser ab. Er ermunterte das Volk von Rom, noch lange durchzuhalten, er bedrohte den Kaiser und stellte sich gar selbst mit großem Hochmut auf die Mauer, wie es zuvor der Johannes getan hatte und wie es sich für einen heiligen Mann so hohen Ranges nicht geziemt.
Ich dankte dem Boten für seinen ausführlichen Bericht, wenngleich ich unschlüssig war, wie weit ich ihm Vertrauen und Glauben schenken konnte. War er nicht auch ein Mann des Benedictus, der sich vielleicht nur im gerechten Glauben ein eigenes Urteil gebildet hatte? War er nicht vom falschen Papste in die Reise geschickt worden, um die hohen und heiligen Männer des Reiches über den Machtwechsel in Rom zu unterrichten und von ihnen Wohlwollen und Vernunft zu erwerben oder gar einzufordern?
Nachdem er fortgeritten war, ging ich zu Franco, um ihm die Neuigkeiten mitzuteilen und ihn auf unsere bevorstehende Abreise nach Rom vorzubereiten.
Franco, der gerade in der schönen Kunst der Himmelsgeometrie unterwiesen wurde, nahm die Entwicklungen in Rom mit Gelassenheit und ohne jede äußere Rührung auf, viel weniger, als ich erwartet hatte. Er interessierte sich gar nicht für den ehrwürdigen Leo, sondern nur noch für den Benedictus, und wollte wissen, welcher Freunde und Unterstützer sich dieser bediente. Da mir nun auf diese Weise deutlich gemacht wurde, dass ich weder das eine noch das andere zu beantworten wusste, betrübte es mich umso mehr und ich hatte es eilig, ohne Verweil selbst nach Rom zu fahren, um mich mit den besten Auskünften und Berichten zu versorgen.
Jedoch brachte mich Franco auf einen Gedanken, der mir angesichts der schwierigen Lage in Rom nicht übel erschien. Warum, so fragte er mich, wollten wir uns selbst den nicht unerheblichen Gefahren einer Reise und einer ungewissen Aufnahme in Rom aussetzen, wo es doch so viel einfacher wäre, einen klugen und vorsichtigen Manne dorthin zu entsenden und ihn die fraglichen Nachforschungen in unserem Sinne anstellen zu lassen. In der Tat war es so, dass wir nicht wussten, was den Benedictus und den römischen Adel zu dieser Stunde umtrieb, warum sie sich nun schon wieder gegen den Kaiser auflehnten und ihn sogar mit der Absetzung des rechtmäßigen Papstes und der Wahl eines neuen auf die gröbste Art brüskierten.
„Kann sich der Benedictus denn einfach so zum Allgemeinen Papste machen lassen?“, fragte Franco, als wir gemeinsam bei Tische saßen.
„Nun“, sagte ich zögerlich, „das kann er wohl. Er wird gewählt von den Seinen, wenn er würdig ist und erhält hernach die Weihe.“
„Aber wenn er nun keiner ist, der würdig wäre?“
„Ach, mein lieber Franco, das ist wirklich eine gute Frage und ein Dilemma zugleich. Man nennt ihn den Grammaticus, ein Titel, dessen sich noch nicht viele Männer rühmen durften. Jener Benedictus ist in der Tat ein des hohen Amtes würdiger Mann. Denn Gott ließe nicht zu, dass jemand, der nicht würdig ist, auf den Stuhl Petri gelangte.“
„Aber habt Ihr denn nicht der Synode selbst gesagt, dass der Papst Johannes dieses hohen Amtes nicht würdig sei und abgesetzt gehöre?“
Ja, ich wusste, dass er seine Fragen mit einiger Berechtigung stellte. Dennoch, da Gott nicht irrte, musste es eine andere Erklärung geben, die, wie ich leider zugeben muss, ich meinem Schüler nicht geben konnte.
„Manchmal, mein lieber Franco“, erwiderte ich deshalb, „sind die Wege, die der Herr uns gehen lässt, im Nebel verborgen und voller Geheimnisse. Dies allerdings sollte uns jedoch kein noch so niederer Grund sein, an seiner Weisheit und an seinem großen Plane zu zweifeln.“
Eine Weile schwiegen wir. Ich wollte mich gerade erheben, als Franco sich räusperte.
„Meister Liuzo, gestattet Ihr mir noch eine Frage?“
Ich nickte ihm mit freundlicher Aufforderung zu, obwohl ich es vorgezogen hätte, das Gespräch an dieser Stelle zu beenden.
„Würdet Ihr mich für würdig halten, zum Obersten Bischof und Allgemeinen Papste gewählt zu werden, Meister Liuzo?“
Mir verschlug es für einen kurzen Augenblick die Sprache.
Dennoch war ich kaum noch überrascht, weil ich in meinem tiefsten Innern bereits auf eine solche Frage vorbereitet war. Nur der frühe Zeitpunkt verwunderte mich. Der Junge hatte seine geistliche Ausbildung doch gerade erst begonnen! Und von dem, was zu tun war, lag noch weit mehr vor ihm als hinter ihm.
„Verlangt es Dich denn danach?“
Franco nickte unsicher.
Ich hatte es mir schon gedacht.
„Dein Schicksal liegt nicht in Deinen Händen, mein lieber Franco“, sagte ich in väterlichem Ton und legte meine Hand behutsam auf seinen Arm. „Der Herr allein weist uns unseren Weg und Du tätest gut daran, im Gebete immer wieder zu erforschen, welches Schicksal der Herr Dir offenbart, und weniger Zeit und Muße darauf verschwenden, Deine eigenen Gedanken zu erforschen und zu verfolgen.“
Noch am gleichen Tage sandte ich einen Boten aus, unterwies ihn in vielerlei Dinge, die unterwegs und am Ziele zu beachten waren, hieß ihn, die schöne Herberge der Brüder Imiza aufzusuchen, und übergab ihm neben den herzlichen Grüßen, die ich in einen Brief diktierte, eine ansehnliche Anzahl schöner und wertvoller Dinge als Gastgeschenke, auf dass er mit einer ähnlich ansehnlichen Menge an Neuigkeiten zurückkommen möge, heil und unversehrt und binnen sieben Tagen.
Mir selbst war um diese Zeit nicht sehr wohl zumute. Eine lästige Entzündung der Gelenke plagte mich auf die schlimmste Art, sodass ich an manchen Tagen nur schwer aufkam. Ich dankte Gott und meinem braven Schüler Franco dafür, dass wir nicht selbst aufgebrochen waren. Auf diese Weise konnten mir meine Diener warme Wickel und heiße Kräuterbäder bereiten und damit meinen beträchtlichen Schmerzen doch etwas Linderung verschaffen. Noch während wir auf die Wiederkehr sowohl unseres als auch des päpstlichen Boten warteten, durchquerte eine große Abteilung des kaiserlichen Heeres die Stadt und mein Bistum. Wie es in schlechten Zeiten üblich war, benahmen sich die Soldaten ungehörig gegenüber jedermann und plünderten, vergewaltigten und nahmen sich, was ihnen vor die Hände fiel.
Franco, der nun bereits in sein vierzehntes Jahr hineinwuchs, war bei mir in sicherer Obhut, konnte ich mich doch bei Bedarf der freundschaftlichen Verbundenheit zu seiner kaiserlichen Majestät, die er mir in seiner unendlichen Gnade mit einem Schutzbrief auswies, rühmen. Ihm drohte keinerlei Gefahr, solange er sich meinen Anweisungen fügte. Es hielt den Jungen jedoch nicht lange hinter dem offenen Fenster meines Palastes, als er sah, wie die Soldaten breitbeinig und lauthals lachend durch die Straßen zogen und den Frauen und Mädchen, die es nicht geschafft hatten, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, an die Röcke gingen. Irgendetwas zog ihn hinaus auf die Straße und lange konnte ich ihn davon nicht abhalten. Vielleicht reizte ihn in seinem jugendlichen Übermut die Gefahr oder die Macht, die eine solch gewaltige Ansammlung starker und vor nichts zurückschreckender Männer und ihrer gefährlich aussehenden Waffen auslöste.
Es fiel mir schwer, ihm aus der Ferne zuzusehen, weil ich um sein Leben und seine Gesundheit fürchtete. Nun, heute weiß ich, dass meine Sorge schon damals völlig unbegründet gewesen war. Franco, mit viel schmaleren Schultern und eher wie ein frommes Mönchlein als wie ein Krieger aussehend, mischte sich unter die Raufbolde, als kämen sie aus demselben Hause. Er scherzte mit den wüsten Männern auf die gemeinste und lauteste Art und übte sich gar mit dem gröbsten und rissigsten unter ihnen im Schwerterkampf, wohl gemerkt nicht mit einem aus weichem Holze, sondern aus Metall. Ich konnte kaum glauben, was sich meinen Augen darbot. Durch ihn erfuhr ich, dass die Soldaten auf dem Weg nach Süden, also nach Rom, waren und dort die rechtmäßigen Belagerer verstärken und aufmuntern sollten. Sie hatten vom Kaiser den heiligen Auftrag angenommen, mit dem ungezogenen Benedictus und den anderen Aufrührern in den Händen zurückzukommen.
Unser Bote, den wir nach Ablauf von sieben Tagen sehnlichst erwarteten, blieb aus. Auch nach weiteren sieben Tagen war noch keine Spur von ihm zu sehen und wir befürchteten das Schlimmste. Bei allem Ungemach, welches wir ihm möglicherweise mit unserer Botschaft bereitet hatten, priesen wir uns andererseits glücklich und weise, nicht selbst nach Rom aufgebrochen zu sein. Nur Gott allein weiß, was aus uns geworden wäre. Auch der Bote des ehrwürdigen Leo ließ lange auf sich warten, bis wir letztlich auch sein Erwarten aufgaben und uns in meine kleine Hauskapelle zurückzogen, um für ihn zu beten. Erst viel später sollten wir herausfinden, dass er wohlauf war und nur durch unglückliche Umstände gezwungen war, einen anderen Rückweg zu wählen, als von mir erhofft. Der Herr in seiner unendlichen Gnade meinte es ganz offenbar gut mit ihm, als er ihn beschützte und auf den rechten Weg leitete, auch wenn dieser nicht durch meine schöne lombardische Heimat führte. Als wir ihn im Herbst am Königshofe in Pavia wiedertrafen, entschuldigte er sich mit größter Liebenswürdigkeit und Aufrichtigkeit und bot an, während wir zusammen speisten und guten spanischen Wein genossen, alles Ungesagte nachzuholen, dessen wir allerdings wegen vieler anderer freudvoller Ereignisse nicht mehr bedurften, wie ich nun zu erzählen habe.
Was wir bis dahin erfahren hatten, lautete wie folgt: Als die Römer nach vier Wochen durch den Hunger und die Belagerung immer weiter in die Enge getrieben wurden, ergaben sie sich dem frommen Kaiser in größter Demut am Abend vor dem Fest des Täufers12). Mit gebührender Ehrerbietung übergaben die Römer den Gotteslästerer und meineidigen Benedictus seiner kaiserlichen Hoheit. Alsdann wurde der rechtmäßige und Höchst ehrwürdige Papst Leo wieder in sein Amt gesetzt, dem Benedictus aber nahm man alle Insignien ab, Leo selbst schnitt das Pallium entzwei, sein Stab ward zerbrochen, seine übrigen Kleider zerrissen. Es hätte nicht viel gefehlt und Benedictus wäre sofort an Ort und Stelle zum Tode verurteilt oder einfach so dahingemeuchelt worden. Mein päpstlicher Freund, der altehrwürdige Leo, war so außer sich vor Zorn, dass er beinahe allem zugestimmt hätte, was die wankelmütigen Römer an Ideen zur Wiedergutmachung und Strafung forderten.
Nur dem persönlichen Einspruch des Kaisers ist es zu verdanken, dass ihm ein Rest Würde und sein ganzes Leben gelassen wurde. Otto verfügte, dass dem Benedictus alle kirchlichen Weihen abgenommen würden, bis auf die eines Diakons. Weiter verfügte er, dass Benedictus nunmehr auf ewig in die entlegenste Provinz des Reiches in die Verbannung gehen solle. Alsbald darauf erklärte sich der fromme Adaldag, Erzbischof von Hammaburg am nördlichen Meer, bereit, ihn mitzunehmen und bis an das Ende seiner Tage dort zu behalten. Dem Vorschlag Adaldags stimmte der Kaiser zu.
Nachdem nun die italischen Verhältnisse weitgehend geordnet waren und die Anzahl der Boten aus Franken und Sachsen sich mehrte, die anfragten, wann denn das Heilige Kaiserpaar beabsichtige, wieder in sein Reich nördlich der Alpen zurückzukehren, beschlossen die kaiserlichen Hoheiten, noch die Weihnachtstage am Hofe in Pavia zu verbringen und sodann mit ihrem gesamten weltlichen und geistlichen Gefolge und den Gefangenen die Rückreise anzutreten. So fügte es sich glücklich, dass des Kaisers Zug nach Norden auch durch Cremona führte, was mir Gelegenheit gab, ihn mit seiner Erhabenen Gattin Adelheid und seinen engsten Vertrauten in meinen bischöflichen Palast einzuladen, während sein Heer und der ganze übrige Hofstaat vor den Toren der Stadt ein gewaltiges Zeltlager aufschlugen.
Sofort ließ ich eintausend Scheffel gutes Korn zu Brot backen, zehn Ochsen, zwanzig Fässer Wein und ebenso viel Bier nach draußen bringen, um den braven Soldaten einen angenehmen Aufenthalt zu wünschen und auch, um sie von Plünderungen wie beim ersten Durchzuge nach Rom abzuhalten. Den hohen Herren, die nicht zum Kreise meiner Gäste zählten und draußen bleiben mussten, übergab ich selbst wertvolle Festkleider, die sie, da sie in der Fremde wohl nicht so oft beschenkt worden waren, mit größter Dankbarkeit und weinenden Augen annahmen. Auch entsandte ich einige Dirnen aus der Stadt hinaus, damit sie sich ein Geschäft machen konnten, was sie auch taten, aber dies sei von mir nur am Rande erwähnt, und ich tat es nur der frommen und lieblichen Kaiserin zuliebe, die mich gleich nach ihrer Ankunft mit einem entsprechenden Ansinnen ersuchte.
Wir speisten in gar festlicher Runde. Ich ließ auftafeln und herrichten, was der Keller und das Lager hergaben, hatte meine Wenigkeit, dies sei in aller Bescheidenheit gesagt, doch selten die Gelegenheit, so hochherrschaftliche, glorreiche und erhabene Besucher zu bewirten und zu unterhalten. Um den Geist und das Auge meiner Gäste zusätzlich zu erfreuen, ließ ich Spiele und vielerlei Vertreib vorführen. Eines derselben möchte ich kurz erwähnen, weil es der frommen Kaiserin anscheinend besonderes Vergnügen bereitete und mich auf wunderbare Weise ihrer und somit auch der Gunst ihres Gatten versicherte. Es trat ein Mann auf, der auf seiner Stirn ohne Beihilfe der Hände eine hölzerne Stange trug, die an die sechs oder sieben Ellen lang gewesen sein mochte und an welcher eine weitere Stange quer angebracht war. Es wurden danach zwei Knaben hereingeführt, die an der Stange hinaufkletterten und oben allerlei Kunststücke vollführten. Dann kamen sie, die Köpfe nach unten gekehrt, wieder hinab, wobei die Stange sich so wenig bewegte, als wäre sie in der Erde verwurzelt. Zuletzt war nur noch einer der Knaben allein auf der Stange, was mich doch sehr verwunderte. Denn solange beide an der Stange kletterten, schien es mir durchaus möglich, ihre Kunst durch ihr gleiches Gewicht auf jeder Seite vorzuführen. Dass aber ein Knabe allein sein Gleichgewicht derart zu beobachten wusste, dass er nicht herabstürzte, versetzte die Kaiserin und mich selbst so in Erstaunen, dass es auch dem Kaiser nicht entging. Er lachte herzlich darüber und wir sprachen bei Tische und zu anderer Gelegenheit noch lange über dieses wunderbare Spiel.
Nach dem überaus reichlichen Mahl zogen wir uns in den großen Gesellschaftsraum zurück, den ich eigens für das Kaiserpaar mit einigen seltenen afrikanischen Tieren, darunter bunt befiederte Papageien und ein junges Nashorn, allesamt gestopft mit feinem Stroh und gar wundervoll hergerichtet, hatte ausstatten lassen. Als der Kaiser zur Seite hin meinen Schüler Franco erblickte, schien er sich sogleich an ihn zu erinnern. Er sagte zu mir, während Franco zuhörte, dass er noch gut wisse, wie aufmerksam, verständig und scharfsichtig der Knabe die Heilige Synode zu Rom verfolgt hatte, und dass ihm auch nicht entgangen sei, welch festen und fortwährenden Blick der Junge auf ihn geheftet hatte. Er fühlte sich dadurch geehrt und gestärkt, sprach er weiter, während Franco an beiden Ohren heftig errötete.
Als es an die Entlohnung des Mannes und seiner beiden kunstfertigen Knaben ging, ließ ich meinen Beutel aus goldbesticktem Kalbsleder bringen und überreichte in Gegenwart des Kaiserpaares und unter vielen lobenden Worten, die ich getreu übersetzte, jedem seinen Anteil daraus. Durch mein eigenes Ungeschick fielen mir eine große Anzahl Silberdenares und ein goldener Solidus hinunter. Franco stürzte sofort hinzu, sammelte die Münzen für mich ein und war gerade im Begriff, sie mir zurückzugeben. Dabei stutzte er über das Porträt, welches den Solidus auf dem Avers zierte und in dem er unzweifelhaft, nicht nur wegen der Heiligen Insignien, den Kaiser Otto erkannte, denselben, der nun im gleichen Raume saß und uns, den Unwürdigen, die Gnade seiner glorreichen Anwesenheit erwies. Er drehte die goldene Münze aufmerksam zwischen seinen Fingern, seine Augen wanderten von dort direkt zum Kaiser, wo sich ihre Blicke unvermittelt trafen. Sofort senkte er seinen Blick auf den Boden, verneigte sich tief und verharrte, wie er war.
„Du hast mich erkannt, Knabe?“, fragte der Kaiser plötzlich, ohne den Jungen aus den Augen zu lassen.
Franco nickte gehorsam und verbeugte sich tiefer und demutsvoller vor dem hohen Kaiser und seiner Gemahlin.
„Es war nicht schwer, Eure Majestät“, sagte er leise und sah wieder zu ihm auf, was mir ungebührlich erschien. „Es ist Euch durchaus ähnlich, wenn auch die Jahre schon vergangen scheinen, in denen die Jugend Euer kaiserliches Antlitz zierte.“
Der Kaiser verstand die Worte auch ohne meine Übersetzung.
Einen Augenblick lang herrschte vollkommene Stille in dem Raume. Die drei Künstler wagten nicht, sich zu bewegen, obwohl sie ihren Rückweg zur Tür bereits angetreten hatten. Die göttliche Kaiserin, als Einzige, wandte ihren Blick abwechselnd mit leichtem Schmunzeln ihrem Gemahl und dann meiner Wenigkeit zu.
„Oh, mein Gott! Junge!“, entfuhr es mir in diesem unglaublichen Augenblick, als Panik und Ohnmacht mich befielen. „Was Du nur redest …!“
Die Gedanken wirbelten durch meinen Kopf. Ich rutschte von meinem plötzlich unbequemen Sessel und war bereits im Begriff, mich auf das Demütigste und Untertänigste auf den Boden zu werfen, mich für meinen ungehorsamen Schüler zu entschuldigen und das Erhabene Kaiserpaar für diese Ungebührlichkeit um die Güte ihrer Gnade und um Schonung zu bitten. Doch noch bevor ich dasselbe tun konnte, hob der barmherzige Kaiser seine Hand und gebot mir Einhalt.
Ich erstarrte in einer sehr unbequemen Position.
Er richtete seinen Blick auf mich und sagte: „Wie ich höre, verehrter Bischof Liutprand, verbirgt sich in dem Knaben neben einem wachen Auge auch ein scharfer Verstand. Recht ungewöhnlich in diesem Alter, findet Ihr nicht auch? Man darf Euch, Exzellenz, gratulieren, über eine so vortreffliche Hand bei der Auswahl Eurer Schüler zu verfügen.“
Mir verschlug es fast die Sprache, was, wie ich gern zugeben will, bisher gottlob recht selten vorgekommen ist. Zum Glück konnte ich trotz meiner nicht geringen Menschenkenntnis keine Spur von Gram oder Beleidigtsein in seinen Worten und in seinem Ausdrucke erkennen.
Dann, wieder zu Franco gewandt: „Sag, mein guter Junge, Du bist recht geübt im Worte und im Denken. Ich nehme an, Du bist ein gelehrsamer und braver Schüler unseres guten Bischofs und er lehrt Dich nicht nur die sieben freien Künste, sondern darüber hinaus vieles mehr, was Dir von Nutzen sein kann.“
Franco nickte ehrfürchtig, vielleicht auch in banger Erwartung irgendeiner Wendung. Aber der Kaiser meinte es mit seinem Lob ganz offensichtlich ernst.
„Was also hat Dich so verwundert“, fuhr er fort, „als Du den Solidus vom Boden nahmst?“
Franco sah dem Kaiser offen in die Augen, nun beinahe ohne Scheu. Ich war mir nicht sicher, wie dieses Verhalten zu bewerten war, betrachtete es aber in der gegebenen Lage als botmäßig.
„Gnädigste Kaiserin und gnädigster Kaiser“, sagte Franco und drehte die Münze erneut zwischen seinen dünnen und viel zu langen Fingern, „verzeiht mir meine Unwissenheit. Ich habe mich oft gefragt, welchem Vorzuge es dienlich sei, einem kleinen Goldklumpen ein Gesicht und einen Namen einzuprägen, wenn es doch keinen Unterschied macht, was ich auf dem Markte vorher wie nachher damit handeln kann.“
Der Kaiser drehte den Kopf ein wenig zur Seite, so dass er seine Gemahlin sehen konnte. Wieder wollte ich einschreiten, um meinen Schüler vor größerer Peinlichkeit und Bestrafung zu schützen, aber die Kaiserin hieß mich sitzen bleiben und lächelte voller Offenheit und Geduld. Scheinbar hatten die beiden Majestäten an diesem Spiel ihr Vergnügen.
Ich war zu nichts weiter verdammt als zum Zuschauen und Übersetzen, wo es nötig war.
Erstaunlicherweise hatte Franco mit der sächsischen Sprache weit weniger Schwierigkeiten, als ich erwartete. Schon nach kurzer Zeit brachte er einzelne Wörter in des Kaisers Sprache heraus, was in mir eine nicht geringe Menge Stolz und Würde wachsen ließ.
„Du meinst also, für einen Solidus bekämest Du genauso viele Eier oder Korn oder Tuche wie für einen Klumpen aus Gold, bei sonst gleichem Gewichte?“
Franco bestätigte, dass er die Frage genau so gemeint hätte.
„Nun, Du hast recht, mein guter Junge. Mir gefällt Deine Frage und ich will sie Dir gern beantworten“, sagte der Kaiser voller Milde und fuhr fort: „Sag mir Junge, Du hast bereits gelernt, was Regalien sind?“
„Nein, gnädigster Herr.“
„Auch gut, denn Dein Meister wird es Dich schon bald lehren. Zunächst ist zu sagen, dass wir das von Gott gegebene kaiserliche Recht innehaben, einen bestimmten Platz oder eine civitas zum Markte zu erheben und ebenso zu bestimmen, in welcher Münze auf ebendiesem Markte gehandelt werden solle. Den braven Kaufleuten aber ist ein getreues Geld von Nutzen, welches immer ein gleiches Gewicht, eine gleiche Größe und einen gleichen Wert besitzt. Dies alles aber hängt vom Metall ab. Ein solcher Solidus, wie Du ihn hältst, ist aus Gold und besitzt den gleichen Wert wie zwölf Denares aus Silber. Verstehst Du das?“
Franco nickte aufmerksam.
„Nun, in jedem dritten Jahre lassen wir die werten Kaufleute zu uns kommen und all ihre Denares aus Silber gegen neue eintauschen. Wir geben neun für zwölf und ebenso verfahren wir mit den Solidi.“
Franco senkte den Blick und dachte einen Moment lang nach. „Dann wäret Ihr mit jedem Tausch ein reicher Mann! Ihr bekämet ein Viertel von allem und ein weiteres Viertel von den Wohlhabenden“, antwortete er.
Der Kaiser und die Kaiserin lachten herzhaft und da konnte auch ich mir ein Schmunzeln nicht verwehren. „Du wärest mir ein gar trefflicher Berater, Junge! Die Kaufleute sind schon von ihrer Natur aus eine zänkische Fraktion, musst Du wissen. Sie würden uns Halunken und Betrüger schimpfen, wenn es so wäre“, entgegnete der Herrscher gutgelaunt.
„Sie tauschen immer nur Denares gegen Denares und Solidi gegen Solidi, ebenso nur Silber gegen Silber und Gold gegen Gold. Daher bekommen wir von allem immer nur ein Viertel, ganz gleich, wie viel von jedem ein jeder hat. Man nennt dies Tax oder Steuer. Und man mag es glauben oder nicht, bevor es bei Hofe ankommt, geht es durch so viele gierige Hände, dass uns kaum mehr bleibt, als uns der ganze Hofstaat und das Heer kostet. Aber“, der Kaiser machte eine kurze Pause, in der er den Blick prüfend über seine ebenfalls anwesenden engsten Berater und Vertrauten gleiten ließ, „wir werden über Deinen Vorschlag dennoch nachdenken. Er klingt uns gar nicht so übel. Denn bei wem mehr zu holen ist, da sollte man bei Gott auch mehr holen.“
Daraufhin reichte er dem Franco die Münze und sagte: „Nun nimm selbst diesen Solidus als Geschenk von uns, zum Zeichen unserer Gunst für Dich und Deinen lieben, hoch verehrten Meister Liuzo. Er möge Dir mit Gottes Hilfe Glück bringen und Dich beschützen, wenn es einmal arg um Dich steht.“
Franco verbeugte sich artig und betrachtete mit großer Freude das kaiserliche Geschenk, welches in seiner Hand mit dem goldenen Ring um die Wette glänzte. Als der Kaiser dies sah, beugte er sich leicht nach vorn und sprach mit gedämpfter Stimme zu Franco:
„Einen schönen Ring trägst Du da. Zeig ihn mir her!“
Franco stockte einen Moment und sah erwartungsvoll zu mir hinüber. Ich nickte ihm aufmunternd zu.
Mit sichtbarem Widerstreben schob Franco seine rechte Hand nach vorn, aber nicht weit genug, damit der Kaiser selbst sie erreichen konnte.
„Du musst den Ring abnehmen, um ihn dem hohen Kaiser zu zeigen“, raunte ich.
Franco schüttelte den Kopf.
„Das kann ich nicht“, antwortete er leise und zog die Hand zurück. Ich ahnte natürlich, welche Sorge ihn quälte und beeilte mich, ihm mit gutem Rat zur Seite zu stehen.
„Nimm etwas Seife dazu! Die wird den Ring lösen“, sagte ich mit gütigem Lächeln.
Aber Franco regte sich nicht. Fast schien es, als hätte er mich nicht verstanden.
„Was ist, mein Junge? Du musst tun, was der Kaiser von Dir wünscht!“
Wieder schüttelte er den Kopf, heftiger als zuvor.
„Ich kann den Ring nicht abnehmen. Er ist ein Geschenk meines Vaters.“
„Ja, und?“, erwiderte ich.
„Ich habe einen heiligen Eid an seinem Sterbebett geleistet, ihn niemals abzunehmen.“
Damit zog er seine Hand ganz zurück und wandte sich vom Kaiser ab.
Bumm! Ich war wie vor den Kopf geschlagen!
Hatte mein lieber Schüler Franco das wirklich gesagt oder träumte ich dies alles nur? Eine solche Beleidigung dem hohen Kaiserpaare gegenüber hatte ich zuvor noch nicht erlebt! Und ich hätte dies auch nie erwartet, nicht hier und nicht heute, es sei denn, von einem Feind, einem Todgeweihten oder in einem Irrenhaus.
„Franco!“, stöhnte ich in ohnmächtigem Entsetzen. „Bist Du nicht bei Verstand? Was tust Du nur? Du beleidigst …“
„Nein, nein, mein lieber Liuzo“, hob der Kaiser an, ohne auf meine Entschuldigung zu warten. „Müht Euch nicht, den Jungen zu erklären. Ich denke, ich habe schon verstanden, was er mir sagen will. Es scheint, sein Vater bedeutet ihm eine ganze Menge, so wie mir meiner und Euch Euer Vater sicher sehr viel bedeutet. Daran ist nichts Verwerfliches! Im Gegenteil! Eines jeden Mannes Vater sollte dies zu höchster Ehre gereichen. Und deshalb sage ich: Es ist schon in guter Ordnung so. Lasst es nur weiter so sein, lieber Bischof!“
Dennoch, nach dieser größten aller möglichen Beleidigungen meines geliebten Kaisers war ich lange Zeit nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Alles in mir schien durcheinander zu geraten. Mein Herz raste. Mein Magen krampfte zusammen, als hätte ich saures Obst gegessen. Und auch mein Zahnweh machte sich an einer Stelle bemerkbar, wo ich es doch schon längst vergessen glaubte.
Dann wandte sich der gütige Kaiser wieder an den Jungen und sagte:
„Du musst keine Angst haben, braver Junge. Ich weiß sehr gut, wie es um Dich bestellt ist.“
Und während er sich langsam aus seinem Stuhl erhob, deutete er auf die Hand mit dem Ring. „Pass’ nur gut auf, dass man ihn Dir nicht eines Tages stiehlt! Es wäre doch zu schade um ein Stück von solch hohem Wert. Und nun, meine lieben Leute, lasst uns aufbrechen!“
Die kaiserlichen Berater, es waren vier an der Zahl, allesamt sehr würdevoll und in kostbare, aufwändig bestickte purpurne Gewänder gekleidet, nickten ehrerbietig. Unter ihnen war übrigens, dies soll hier nicht unerwähnt bleiben, der preiswürdige und hochgelehrte Widukind von Corvey, der mir ein guter Freund war und mit dem ich viele wunderbare Stunden gemeinsamen Disputs über die sächsischen und fränkischen Häuser verbracht hatte, wenn wir uns auch über die universale Rolle des Römischen Papststuhles niemals einigen konnten. Er, ein Sachse von adeligem Stande, begleitete den Kaiser und seine Gemahlin während ihrer Italienreise und war, wie auch meine geringe Person in aller Bescheidenheit sagen darf, ein Meister der Autographie und Geschichtsschreiber.
Am Tage der Abreise des herrschaftlichen Zuges bekamen Franco und ich zum ersten Mal die drei Wagen mit den Gefangenen zu sehen, die bisher abseits und unter dem strengen Schutze eines Hauptmannes standen. Die beiden vorderen waren von drei Seiten mit weißem Linnen verhangen, der dritte Wagen hingegen ließ keine Seite offen. Der Kaiser selbst führte mich über den Hof, um mir ein Bild über das Ausmaß seines glorreichen Erfolgs und ebenso seiner Gnade und seines Großmuts zu geben.
Die Gefangenen waren nicht etwa gekettet an Händen und Füßen, bei Wasser und Hirsebrei darbend, und dem Tode näher als dem Leben. Nein, ganz das Gegenteil war der Fall. Ich sah den Berengar und seine unheimliche Gattin Willa, frei beweglich und in einem durchaus bequemen Wagen reisend, neben einer Schale mit frischen Trauben auf einem Stapel Tuche und Teppiche sitzend.
Der Unhold musterte mich mit gar bösem Blicke, kannten wir uns doch aus guten wie aus schlechten Tagen bei Hofe in Pavia. Bis heute kann ich ihm nicht gut verzeihen, was er meinen Nächsten und mir nach meiner glücklichen Rückkehr von einer gefährlichen Gesandtschaft nach Konstantinopel angetan hatte. Nur mit Gottes Hilfe und Eingebung hatte ich mein nacktes Leben auf ein griechisches Schiff retten können, welches dann als einziges im Sturme nicht versank, sondern mich am Ende wohlbehalten nach Ancona brachte, wo ich todkrank zusammenbrach und von wo mich gute Freunde nach Hause geleiteten.
Als ich von den erlittenen Strapazen einigermaßen genesen war, begab ich mich sogleich an den Hof nach Pavia. Dabei führte ich gegen meinen Herrn Berengar nichts weiter im Schilde, als die rechtmäßige Erstattung meiner nicht unbeträchtlichen Kosten, die ich ihm verauslagt hatte, einzufordern. Auch die während der Reise erlittenen Verluste an all meinen persönlichen Sachen durfte ich ihm gegenüber nicht unerwähnt lassen.
Der unheilige Bösewicht jedoch, getrieben von seinem geizigen und missgünstigen Eheweib, ließ mich an Händen und Füßen anbinden, hinauswerfen und demütigen. Im Hofe meines bescheidenen Hauses ließ er hundert Fuhren Esel- und Schweinemist abladen und dreizehn Tage lang das Tor so absperren, dass wir es nicht hinausschaffen konnten. Der üble Gestank begleitete uns so entsetzlich lange, dass wir uns eines Nachts aus unserem eigenen Hause wie Diebe davonstehlen mussten, um woanders ein besseres Quartier zu finden. Ich nehme ihm das bis zum heutigen Tage sehr übel.
Nun also sahen wir uns wieder und standen uns Auge in Auge gegenüber. Ich konnte meine Schadenfreude wohl nur schlecht verstecken und Frau Willa tat, was sie am besten konnte, nämlich mich keines einzigen Blickes zu würdigen. Im zweiten Wagen, nicht ganz so streng bewacht, aber ebenfalls mit einem Stapel kunstvoller Teppiche ausgelegt, reisten die beiden jungen Töchter des Berengar, mit Namen Oda und Rosvith. Gleichwohl sie dem Wuchse und ihrer Natur nach noch Kinder waren, sollten auch sie im Auftrage der kaiserlichen Versammlung zur Verbannung nach Babenberch geschickt werden. Kaiserin Adelheid selbst hatte sich in allerhöchster Gnade erboten, für die Mädchen zu sorgen und es ihnen auch nicht an der notwendigen Erziehung fehlen zu lassen, was der Kaiser wohlwollend, aber dennoch verwundert zur Kenntnis nahm und hernach bestätigte.
Während es mich weiter zum dritten und letzten Wagen mit dem reumütigen Sünder und falschen Papst Benedictus zog, verweilte mein junger Schüler auffallend lange vor dem zweiten Wagen. Aus der Entfernung konnte ich sehen, wie eines der Mädchen die Hand nach ihm ausstreckte, um etwas von ihm entgegenzunehmen. Der Hauptmann schickte sofort einen seiner bewaffneten Mannen, um dies zu unterbinden, aber es konnte nichts gefunden werden, was es hätte sein können, was das Mädchen wohl unter ihren Kleidern verbarg und nicht hergeben wollte.
Als ich den ehemaligen Bischof und jetzigen Diakon Benedictus sah, mit nichts weiter als etwas dünnem Stroh ausgestattet und gar betrübt an das eiserne Gitter seines Wagens gelehnt, konnte er mir fast leidtun. Er war müde, sah hungrig und geplagt aus. An ihm war keine Spur mehr von dem Manne, den ich während der Heiligen Römischen Synode in hellem Glanz und reicher Glorie erlebt hatte. Das gerechte Urteil, welches ihn für sein schändliches und gotteslästerliches Tun getroffen hatte, mochte ihm wohl sein Leben gerettet haben, sein Geist jedoch war gebrochen. Mir war nun nicht nach einer Unterhaltung zumute, aber ich sah dem Benedictus an, wie sehr er sich nach einem wohlgefälligen Gespräch bei einem Becher Wein und gutem Essen sehnte. Auch die Aussicht auf das, wie man hört, recht kalte Klima im Norden (er verließ das sonnige Italien und ging mit Erzbischof Adaldag nach Hammaburg) vermochte seiner armen Seele keinen Trost zu spenden.
Als der Zeitpunkt der Abreise nahte, war ich einerseits betrübt und andererseits froh. Die Gunst des Kaiserpaares stellte einen unschätzbaren Wert dar, dessen wahres Ausmaß ich zu jenem Tage noch gar nicht abzuschätzen gewusst habe. Auch war es mir mit Gottes Hilfe gelungen, die Soldaten des kaiserlichen Heeres drei Tage lang von Beutezügen und Plünderungen in der Stadt abzuhalten. Die Cremoneser Bürger, deren Häuser und Läden dem großen Heerlager am nächsten zugewandt waren, klagten nur gering oder priesen öffentlich sogar die Weisheit und Freigiebigkeit meiner bescheidenen Person, was ich mit nicht geringer Genugtuung und Freude aufnahm.
Franco stand wieder bei den Mädchen und tuschelte heimlich mit ihnen. Ich hatte wohl allen Grund, mir ernste Sorgen um den Jungen zu machen. Noch mehr Sorge allerdings bereitete mir, dass das italische Königreich mit jedem Tage und mit jeder Meile, die der Kaiser sich von Rom entfernte, unsicherer und anfälliger für neuen Zwist und Streit wurde. Der unselige aufrührerische Adalbert war noch nicht gefangen und der ehrwürdige Leo auf dem Stuhle Petri wohl nicht stark genug, um sich allein, ohne des Kaisers Schutzmacht, gegen die Römer und ihre Vasallen aus dem Norden wie aus dem Süden zu verteidigen.
Zum Abschiede lud mich der Heilige Kaiser ein, im nächsten Jahr sein willkommener Gast am sächsischen Hofe zu sein. Ich solle zu ihm reisen, wann immer es meine Gesundheit erlaube, und so lange bleiben, wie es mir Freude und meiner Seele Labsal war. Bei dieser Gelegenheit wolle er mir dann eine erneute Gesandtschaft übertragen, die, wie er es ausdrückte, in besonderem Maße Vertrauen, Erfahrenheit und diplomatisches Geschick erforderte. Ich verneigte mich so tief und so demütig, wie es meine angeschlagene Gesundheit damals zuließ, dankte ihm für die Gnade seiner Gunst und versprach, alles in meinen bescheidenen Kräften Stehende zu tun, um ihn, den allerhöchsten Heiligen Kaiser und seine höchst geliebte und Heilige Gemahlin Kaiserin Adelheid in jeglicher Hinsicht zufriedenzustellen.
Außerdem entbot er sich, mir ab sofort eine monatliche Apanage in nicht unbeträchtlicher Höhe zu gewähren, was ich mit höchster Freude annahm. Als einzige Gegenleistung sollte ich lediglich für ihn fortsetzen, was ich sowieso schon mit größtem Vergnügen und manchmal wohl auch zum Zeitvertreibe tat: Schreiben! Nichts war mir lieber als dies und dazu, wenn es auch noch aufs Beste bezahlt wurde.
Mein Herz jubelte!