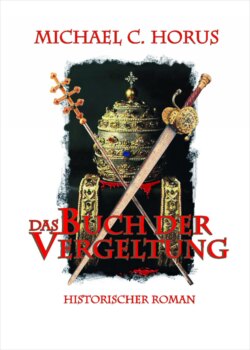Читать книгу Das Buch der Vergeltung - Michael C. Horus - Страница 9
5. Kapitel
ОглавлениеIch entnahm die Schriftrollen des Bruders Pilegrinus vorsichtig dem Kalbslederfutter, welches von der Feuchtigkeit hart und rissig geworden war, und gab es dem mittleren Grafensohn Howus mit der frommen Bitte, es in der hiesigen Kürschnerei wieder in Form bringen zu lassen. Unterdessen sah ich mir aus reiner Neugier und ohne ein bestimmtes Interesse die hervorragenden Arbeiten des Pilegrinus und seiner hochverehrten Brüder aus dem Kloster Altahens an. Unter den Urkunden fanden sich neuere Originale von Schenkungen und zweierlei Privilegien, die zu ihrer Beglaubigung an den Kaiserhof geführt werden sollten, aber auch wundervolle Abschriften älterer Urkunden und Schriften, die mit einiger Kunstfertigkeit und mit besonders schönem Striche hergestellt worden waren. Einige davon erregten mein besonderes Interesse, weil ich zu meiner größten Erbauung darin Ereignisse beschrieben fand, deren Zeuge meine geringe Person, Bischof Liutprand von Cremona, selbst gewesen war.
An einer Stelle jedoch geriet ich ins Staunen. Zu meinen Füßen lag die Abschrift einer vom großen Kaiser Karolus höchst selbst beglaubigten Urkunde, mit welcher er dem ehrwürdigen Bischof Liudger im Jahre 802 unseres Herrn einen großen Besitz am Ufer des Flusses Lippe schenkte und ihm erlaubte, daselbst ein Kloster zu gründen. Das Pergament, auf dem sie geschrieben war, war im Magathaburger Schnitt gehalten, was bedeutete, dass die Ecken, die den vier Gliedmaßen des ursprünglichen Tieres entsprachen, dreieckig geschnitten waren. Dies tat man vor allem im Norden des Reiches, um die harten Hornreste der Klauen zu entfernen, die die darunter und darüber liegenden Pergamentbögen zu beschädigen drohten.
Aber in der Urkunde schien das eine nicht zum anderen passen zu wollen.
So bemerkte ich, wie inmitten des wohlgeformten Textes die Schrift wechselte, aber nicht in der Art, wie wenn man den Schreiber austauschte, sondern eher so, wie es passierte, wenn man mit Mühe seine Schrift verstellte und die Last der alten Gewohnheit wieder durchkäme. Anfangs gleiche Buchstaben bekamen nun auffällige Ober- und Unterlängen, die Schrift wurde gerader und weniger schön gestochen. Der Schreiber schien es am Schlusse sehr eilig gehabt zu haben und ließ jegliche Mühe, seine falsche und gottlose Absicht zu vertuschen, immer mehr fallen.
Das Wachssiegel indes, welches dem Pergament zugegeben war, zeigte statt der Insignien des großen Kaisers Karolus diejenigen seines Enkelsohnes, ebenfalls mit Namen Karolus, aber weit geringer von Rang und Ruhm, was dem Siegelschneider in der Vielzahl der zu beachtenden Umstände offenbar entgangen war. Was aber am schwersten wog und mich in meiner Anmutung bestätigte, dass es sich bei dieser Urkunde nur um ein Falsifikat handeln könne, war ein besonderer Umstand, den der anonyme Schreiber aus eigenem Erleben nicht hatte wissen können. Ich hingegen, der einen großen und wichtigen Teil meines Lebens, aus vielerlei wertvollen Quellen gespeist, mit der Geschichte großer Herren und dem Bericht über die Ereignisse der letzten zweihundert Jahre verbracht hatte, wusste nur gut Bescheid um den ehrwürdigen Abt Liudger von Werden und dass er in dem besagten Jahre noch kein Bischof in Monasterium gewesen sein konnte, sondern erst drei Jahre später, wie es bezeugt ist.
Ich fand ein weiteres Pergament im Magathaburger Schnitt mit einigen Beschädigungen am Rande, die wohl durch das Liegen im Wasser entstanden sein mochten. Nachdem ich einige Mühe darauf verwendet hatte, die schadhaften Stellen auszubessern, entdeckte ich, dass bereits vor mir jemand an einigen wichtigen Passagen gekratzt hatte, um sie daraufhin mit eigener, noch geradezu andersfarbiger Tinte zu überschreiben. Leider gelang es mir nicht mehr, festzustellen, was genau an den betreffenden Stellen entfernt worden war, jedoch bin ich mir sicher, dass es mehr gewesen sein musste, als die allfällige Anrufung Christi oder die Lobpreisung des Herrn. Die in jenem Pergament benannten adligen Herren, es waren vier an der Zahl, waren vom Großen und Frommen Kaiser höchst selbst mit hohen Steuerprivilegien ausgestattet worden.
Die Frage, die ich mir nun stellen musste, war, ob der ehrwürdige Bruder Pilegrinus von Batavis das Opfer von Verschwörungen geworden war oder ob er selbst ein Interesse am Zustandekommen ebendieser falschen Beurkundungen oder Privilegien hatte.
Mein Schüler Franco, der auf dem Wege der Genesung war, klopfte an die Tür meiner Kammer und ich forderte ihn auf, eilends hereinzukommen. Nach einer für ihn sehr anstrengenden Woche war er sichtlich abgemagert und sah matt und schläfrig aus. Er hielt eine Decke über seinen Schultern mit beiden Händen zusammen, als fröstele ihn, obwohl es drinnen wie draußen angenehm warm war. Ich hieß ihn, sich zu mir zu setzen, rückte einige Kerzen in seine Nähe, um ihn weiter zu wärmen, und breitete meine Entdeckung zu seinen Füßen aus.
„Sieh nur, mein lieber Franco, was ich gefunden habe“, sagte ich mit einiger Euphorie und lenkte seinen Blick auf das verschobene Zeichen am linken unteren Rand des kaiserlichen Privilegiums, welches einen Blick auf das darunterliegende und mit einer harten Nadel weggekratzte Zeichen erlaubte.
Seine Abgeschlagenheit war mit einem Male wie fortgeblasen und von wachem Interesse ersetzt. Er kniete neben mir nieder und untersuchte die besagten Stellen mit größter Gründlichkeit. Daraufhin zeigte ich dem Jungen auch die falsche Urkunde des Abtes Liudger und erläuterte ihm in allen Einzelheiten, woran ich die Fälschung ausmachen konnte. Franco schien auch daran sehr interessiert und erkundigte sich sehr gut im Detail nach der Art und Weise, wie die Siegel geschnitten werden, und ebenso nach den Veränderungen in der Färbung der Tinte, wenn man ihr bestimmte Beimengungen zumischte.
Ich war sehr froh, einen so aufmerksamen und wissbegierigen Schüler an meiner Seite zu haben, und beantwortete ihm jede seiner Fragen so gut und so ausführlich, wie ich es nur vermochte.
Aber neben all den geheimnisvollen und verschwörerischen Dingen, die die Pergamentrollen zu unseren Füßen noch vor uns verbergen mochten, interessierte mich brennend auch eine andere Frage. Ich war voller Ungeduld, sie endlich stellen zu können, da seine Genesung so gut vorangeschritten war.
„Warum hast Du das getan?“, fragte ich geradeheraus, während ich die Urkunden scheinbar nach weiteren Wasserspuren untersuchte.
„Meister?“
Ich deutete auf den seidenen Mantel, der zwischen zwei eisernen Haken an der Wand gespannt war. Franco stockte unsicher.
„Wolltet Ihr ihn denn nicht haben?“
„Habe ich das gesagt?“
„Ja, Ihr sagtet, dass Ihr ihn schon in Konstantinopel begehrtet und nicht bekommen konntet. Ihr habt ihn gewollt – ich habe ihn Euch geholt. Was ist daran schlecht, Meister Liuzo?“
Ich schluckte. Eine solche Antwort hatte ich nicht erwartet. Offenbar kam meine Frage für ihn wenig überraschend.
„Du hättest bei dem Versuch sterben können, Franco!“
„Aber habt Ihr nicht auch gesagt, dass wirkliches Begehren jede nur erdenkliche Mühe wert ist?“, erwiderte er.
Ich überlegte einen Moment und wandte mich ihm dann mit ernster und zugleich besorgter Stimme zu.
„Begehren sagst Du, mein lieber Junge? Aber meinst Du es auch so?“
„Natürlich!“, antwortete er ohne Zögern.
Ich wog den Kopf, um ihm Zeit zu geben, seine Antwort noch einmal zu überdenken. Doch war er scheinbar in einer engen Gasse festgefahren.
„Hmm. Was begehren wir denn?", wandte ich ein und erhob meine Stimme ein wenig. "Wir Männer des Glaubens begehren keine weltlichen Dinge, Franco. Unser Begehren richtet sich auf die geistigen Werte, wir begehren nach Erlösung oder nach dem Himmelreich. Darauf richtet sich unser Begehr und dieses Begehren ist tatsächlich, wie Du schon richtig gesagt hast, jede nur erdenkliche Mühe wert.“
Franco schwieg eine Weile und ging dann langsam hinüber zum Mantel.
„Ich begehre vielerlei Dinge, verehrter Meister, sowohl geistige als auch weltliche. Aber für den Moment genügte mir eine Antwort von Euch", sagte er unbeirrt und in einem etwas zu forschen Tonfalle, während er den feinen Stoff zwischen den Fingern rieb.
"Welche?"
"Werdet Ihr den Mantel nun tragen oder nicht?“
Der Mantel hatte die lange Wässerung nicht gut überstanden. Er war schrumpelig geworden und hatte weiße Ränder bekommen, wo das Wasser getrocknet war. Unmöglich hätte ich ihn in diesem Zustande tragen können.
Ich hatte die Antwort für Franco schon auf der Zunge – und ich wusste, dass sie ihm nicht gefallen würde. Aber ich brachte es nicht fertig, ihm diese Enttäuschung zuzufügen.
„Ja, so der Herr will, werde ich …“, log ich deshalb.
Der Herr möge mir meine Lüge dereinst verzeihen.
Unten im Burghof war plötzlich das Klappern von beschlagenen Pferdehufen zu hören und kürzte meine Qual ein wenig ab. Ein Reiter in rotem Mantel, es mochte der gleiche Mann gewesen sein, den ich drei Tage zuvor als Boten gesehen hatte, kam zum Tore hinein und verlangte, dass alle verfügbaren Männer der Wache und alle Handwerksgesellen sich mit ihm zusammen am Fuße des Berges einfinden sollen. Dann ritt er wieder zum Tore hinaus. Nun, da wir interessiert waren zu erfahren, was die Männer am Fuße des Berges erwartete, suchten wir für uns einen besseren Platz im Turme, von wo aus wir den Anfang des steilen Weges gut überblicken konnten. Unten stand eine Reihe Wagen und Kutschen, allesamt mit zwei Pferden bespannt. Ich zählte wohl ein Dutzend von ihnen ab, die darauf warteten, den eng geschwungenen Pfad mit Pferdekraft gezogen und zugleich mit vielfacher Manneskraft hinaufgeschoben zu werden.
Schon begannen die Männer des ersten Wagens damit, die Tiere mit ihren langen Peitschen und mit derben Worten kräftig anzutreiben. Die Pferde wussten wohl, welche Anstrengung ihnen auf dem letzten Wegstück bevorstand, und scheuten vor der Aufgabe zurück, sodass die Männer sie mit noch größerer Wut peitschten und anschrien. Langsam setzte sich das erste Gefährt in Bewegung und rappelte hinauf, gefolgt von dem zweiten und dritten und so weiter bis zum letzten Wagen. Sie alle versammelten sich im Burghofe, wurden miteinander verkeilt und hernach ausgeladen. Was ich hier an Vorräten, Wein, Bier, teuren Gewändern und sonstigen Dingen sah, ließ mein Herz sogleich in schönster Vorfreude schneller schlagen.
Alsbald erfuhr ich auch, welch hohen Gast das göttliche Schicksal in diesen Tagen auf die Feste Vossberg geführt hatte. Es war der junge König Otto, der in Begleitung seines Onkels Brun, dem hocheiligen und ehrwürdigsten Erzbischof von Colonia, und Wilhelm, dem ältesten Sohne des Kaisers und als Erzbischof von Mogontia ein nicht minder ehrwürdiger und heiliger Mann, reiste. Die hohen Herren, vor denen ich den allergrößten Respekt bekundete, wurden von einer Reihe weiterer Würdenträger begleitet, die ihren Beraterstab bildeten; außerdem reisten zwei von der edlen Kaiserin Adelheid höchst selbst erwählte Kindermädchen und ein ganzer Tross Königlicher Bediensteter und Soldaten mit, zusammen wohl an die drei Dutzend Personen.
Der junge König, er mochte wohl elf oder zwölf Jahre gewesen sein, stieg aus seinem hochherrschaftlichen Wagen, gefolgt von zwei dunkelhaarigen Mädchen, die wir vor gar nicht langer Zeit schon einmal gesehen hatten. Francos Züge erhellten sich augenblicklich, als er sie erblickte, aber schon der Umstand, dass ich dieses an ihm bemerkte, schien ihm aus einem geheimen Grunde Unbehagen zu bereiten.
Die Mädchen, sie mochten etwas älter als Otto, aber jünger als Franco gewesen sein, waren die Töchter des Berengar und der Willa, ebenjene, die Kaiser Otto bei seiner Abreise aus Pavia im Gefolge geführt hatte. Nun waren sie auf freiem Fuße und offensichtlich guter Dinge. Noch bemerkten sie den auf sie hinabstarrenden Jungen im Turmfenster nicht, indes sie neugierig und mit unverhohlener Freude ihre vorübergehende Wohnstatt in Besitz nahmen. Franco drängte es ganz plötzlich fort von mir, und obwohl ich ihn, seiner noch immer nicht guten Gesundheit wegen, davon abzuhalten versuchte, warf er die Decke von seinen Schultern und stürmte die gewundene Treppe hinunter in den Burghof.
Es dauerte nicht allzu lange, dann hatte er sich mit dem jungen König Otto, dem jüngsten Grafensohn Danilus, ebenso wie mit den beiden Mädchen (sie hießen Oda und Rosvith) befreundet und tollte mit ihnen herum, dass es mir und den anderen eine Freude war.
Die ersten Tage nach der Ankunft der Königlichen Abordnung waren die schönsten, die ich seit dem kaiserlichen Besuch in meinem Hause in Cremona erlebte, und die erfreulichsten in der Fremde überhaupt. Gar trefflich und mit viel Verstand disputierte ich mit Brun, dem Bruder des Kaisers, der ein sehr gebildeter Mann war und der, wäre nicht Otto der Kaiser, allein genug Würde und Charakter offenbarte, um ein so hohes und heiliges Amt in bestem Sinne auszukleiden. Mit großer Beglückung und außerordentlichem Behagen erinnere ich mich zurück an Tage und Abende in hervorragender, erlauchter Gesellschaft bei Wein und Gesang, bei Tanz und Gesprächen und allerlei Kurzweil, die Graf Meik und seine liebe Gemahlin für uns arrangierten. Alle waren einander wohl gesonnen, es gab weder Streitereien noch Intrigen, die uns die Stimmung hätten verderben können. Alles war so, wie ich es mir immer erträumt hatte: eine festliche Gesellschaft von freundlichen, klugen, erhabenen und gut gekleideten Menschen, ein Symposium der schönen Gedanken, der Kunst und der vollendeten Harmonie.
Franco, der schon durch sein Alter und seine Größe hervorstach, hatte alsbald die Führung in der Gruppe übernommen und bestimmte die anderen vier ohne viel Mühe. Der junge Otto und Danilus, Meiks Sohn, waren einen halben Kopf kleiner als er und zeigten gebührlichen Respekt vor seiner körperlichen Kraft. Oda und Rosvith wichen nicht von seiner Seite, wohl, weil sie sich bei ihm gut und beschützt fühlten. Immer öfter entzogen sie sich, natürlich auf Francos Vorschlag hin, den aufmerksamen und mahnenden Blicken der Kindermädchen, wobei sie nicht wenig Einfallsreichtum zeigten und immer neue Fluchtwege und Verstecke fanden.
Nach einiger Zeit bemerkten die Kinderfrauen, zu denen sich inzwischen noch zwei Kammerdienerinnen der Frau Gräfin gesellt hatten, dass sich die Mädchen immer öfter fernhielten von den Jungen und ihre Gesellschaft mieden, wenn es ihnen möglich war. Auch dem übrigen Personal und meiner geringen Person war dieses nicht verborgen geblieben, wobei ich mir jedoch einbildete, erkannt zu haben, dass sich deren scheinbare Abneigung nicht in gleichem Maße auf alle drei Jungen bezog, sondern sich vielmehr gegen meinen Schüler Franco allein richtete.
Ich teilte meine Vermutung mit den Kinderfrauen und fand sie derart bestätigt, dass mir zwei von ihnen und einige der Diener zustimmten. Oda und Rosvith wurden hierzu befragt, aber sie mochten nicht sagen, welches Verhalten sie verstimmt hatte, und auch nicht, ob es wegen Franco oder wegen König Otto oder wegen Danilus war.
Hildegard, die Älteste unter den Kinderfrauen, schien dennoch zu wissen, was die Mädchen bedrückte. Sie nahm mich im Geheimen beiseite und sagte mir, dass einer der Wachleute ihr erzählt habe, wie er den Franco und die Oda beim Spielen am Flusse beobachtet habe und wie er gesehen habe, dass der Franco erst der Oda und dann der Rosvith in unzüchtiger Weise an die Röcke gegangen sei. Der junge König Otto habe dabei nur zugesehen, aber nichts Eigenes unternommen, woraufhin der gleiche Wachmann die Kinderfrauen gerufen und hinunter an den Fluss geschickt habe, um die Oda und die Rosvith zu beschützen. Da aber der Franco schon längst von ihnen abgelassen hatte und sich mit dem Otto auf der Burg versteckte, konnte man ihm hier nichts nachweisen.
Nachdem Erzbischof Brun, der gute Meik und ich selbst den Franco in einer ernsten Disputation zur Ordnung gerufen hatten, beruhigten sich die Dinge wieder.
Unterdessen bereiteten mir die Urkunden des Pilegrinus, die er mir hinterlassen hatte und auf die ich ein eidliches Versprechen gegeben hatte, größere Sorge. Meine Seele war gespalten zwischen dem gegebenen Eid und meinem eigenen Gewissen. Konnte ich diese Urkunden, nachdem ich nun erkannt hatte, dass es sich bei zweien um plumpe Fälschungen handelte, dem Heiligen Kaiser noch mit guter Miene zur Bestätigung vorlegen oder wenigstens so tun, als dass ich nicht wüsste, dass sie nicht echt seien, auch wenn sie sodann nur ein kleiner, aber falscher Teil des kaiserlichen Archivars würden? War ich nicht geradeheraus verpflichtet, mich diesem Unrecht, so klein und unbedeutend es letztendlich auch sein mochte, in den Weg zu stellen und den Heiligen Kaiser vor einer schmutzigen Verschwörung zu beschützen?
Im Burghof bellte ein Hund, jedoch klang sein Bellen unnatürlich und seltsam vergrämt, so dass ich mich genötigt fühlte, von meinen Überlegungen abzugehen, um am Fenster nachzusehen. Nur ein undeutlich grummelndes Gefühl im Bauch sagte mir, dass etwas nicht stimmte. Was ich jedoch dort unten erblickte, war peinlicher als alle falschen Urkunden zusammen, törichter als Francos jugendliche Neckereien und weitaus verhängnisvoller, als ich mir zu diesem Zeitpunkt auszumalen vermochte. Es ist nicht übertrieben zu sagen (und der geschätzte Leser weiß, dass ich nicht eben zur Übertreibung neige), dass dieses Ereignis mein eigenes und meines Schülers geringes Leben fortan auf das Nachhaltigste beeinflusste und gröbste Folgen an uns bewirkte.
Ein böser Dämon mag den Franco damals geritten haben und es erscheint mir bis heute nicht einleuchtend, wie jener Teufel sich seiner reinen und tugendhaften Seele trotz meiner Fürsorge und andauernden Obhut bemächtigen konnte.
Nun, was nutzt es, drum herumzureden – es geschah, wie es geschah: Der Franco zog an einer kurzen Leine hinter sich her nicht etwa einen Hund, sondern den jungen König Otto, der wie einer bellte und dazu noch heulte, während er den Kopf einem Wolfe gleich in die Luft warf. Danilus tanzte wie ein Irrwisch um das Paar herum und feuerte den jungen Otto zu noch lauterem Gebell und Geheul an. Franco indes trug eine Haube auf dem Kopfe, die einer päpstlichen Tiara nicht unähnlich war, und stolzierte vornehmen Schrittes vorweg, immer dann an dem Strick reißend, wenn der junge König in seiner Lautstärke nachzulassen drohte. So zogen sie eine ganze Runde über den Burghof, vorbei an den feixenden Wachen, vorbei an den Bauern, die bis eben noch schweigend ihren Zehnten ablieferten, sich nun aber die Bäuche hielten vor Lachen, vorbei an den schamlos grinsenden Waschweibern und vor den Augen all der hohen und würdigen Herren, die in diesem Moment wie ich fassungslos hinter den Fenstern standen, vor dem Grafen Meik und seiner Gemahlin, seinen Kindern und vor den ebenso neugierigen wie ungläubigen Augen seiner Bediensteten. Wohl gab es in diesem Augenblick niemanden auf der ganzen Feste und drum herum, der es nicht mit eigenen Augen gesehen haben wollte.
Als die Kindermädchen empört hinzustürzten und den jungen König hießen aufzustehen, waren seine Knie längst blutig gescheuert, seine Hände voller Pferdemist und sein Hals von dem engen Stricke fast zugeschnürt.
Franco, der sich die helle Aufregung, die um ihn herum plötzlich entstand, zunächst nicht zu erklären vermochte, foppte die Kindermädchen mit weiteren Ungezogenheiten, während sie versuchten, ihm den Strick und damit die Kontrolle über den jungen König Otto zu entreißen. Danilus indes bemerkte, dass es sich längst um kein Spiel mehr handelte, und lief in die Arme seiner Mutter, die ihn zu sich gerufen hatte.
Das Spiel, welches sie gemeinsam im Hof der Feste gespielt hatten, hieß „Papst und König“, und es entstammte – wie hätte es anders sein sollen – einer Idee Francos. Ich musste nicht viel über das neue Spiel wissen, es war auch so genug zu erkennen, wem welche Rolle zugedacht war und in welcher Beziehung sie zueinander standen. Ich sah Erzbischof Brun in den Hof stürmen und den jungen König schützend in die Arme schließen, als hätte er ihn vor großem Unheil bewahrt. Um Franco herum zogen sich alle, selbst die Armen und die Tiere, voller Angst zurück, so dass ein leerer Ring entstand. Ohne Zweifel verstand der Junge, dass sich die allgemeine Angst, auch der Argwohn und der Hass in den Augen des Erzbischofs in diesem Moment nur gegen ihn richteten.
Plötzlich war er allein, inmitten von Menschen, die eben noch seine Freunde waren! Er brauchte meine Hilfe, doch ich wusste in diesem Augenblick nicht, auf welche Weise ich sie ihm geben konnte.
Ich lief, so schnell es meine Beine zuließen, hinab in den Hof und schloss, ohne weiter zu überlegen, meinen getreuen Schüler wie meinen eigenen Sohn in die Arme. Sein Herz schlug wie wild gegen das meine, seine Muskeln waren gespannt wie die Seile eines Katapultes und in seinen Augen funkelten Wildheit und Angst zugleich. Dennoch spürte ich, wie gut ihm meine Umarmung tat und wie er langsam nachließ in seinem Krampfe und sich willig in meinen tröstenden Zuspruch ergab.
Hildegard, die Oberste der Kinderfrauen, eilte hinzu und sprach meinem Schüler mit freundlicher Miene zu. Aber noch bevor sie ihm die Hand auf die Schulter legen konnte, durchschnitt die scharfe Stimme des Erzbischofs den Hof.
„Halt“, rief er, „geht nicht weiter, Frau Hildegard!“
Erschreckt und verunsichert sah sie sich zu ihm um.
„Er ist ein Dämon! Er ist auf der Stelle festzusetzen!“, befahl Brun weiter.
„Aber, gütiger Herr, bei Gott, er ist noch ein Kind!“, erwiderte Hildegard so laut, dass es alle im Hofe hören konnten.
„Habt Ihr etwa nicht gesehen, was er angerichtet hat?“, schnarrte er vorwurfsvoll.
„Und es gibt keine Rechtfertigung für dieses schändliche Tun!“, rief der älteste Sohn des Kaisers und Halbbruder König Ottos, Erzbischof Wilhelm, um sodann hinzuzufügen: „Und keinerlei Ausflüchte sollen gehört werden, bis der Höchste und Heilige Kaiser selbst sein Urteil darüber gefällt hat. Was dieses gemeine und gottlose Scheusal meinem geliebten Bruder Otto angetan hat, verdient strengste Bestrafung von dieser Stunde an und zu keiner späteren!“
Auch Graf Meik meldete sich zu Wort und ebenso seine wundervolle Gemahlin, die ein wenig Fürsprache übte, allerdings niemals genug, um das schon gesprochene Urteil des Königlichen Vormunds überstimmen zu können. Es entbrannte ein kurzer, aber an Heftigkeit kaum zu übertreffender Disput auf dem Hofe, in dessen Verlauf ich mich, einer inneren Furcht folgend, immer fester an Franco klammerte, was ihm nur noch mehr sichtbares Unbehagen bereitete. Er verstand nicht, warum all die wichtigen und großen Männer, denen er kurz zuvor noch ein gern gesehener Gesprächspartner gewesen war, sich nun plötzlich gegen ihn wandten und ihn einzusperren suchten. Wahrscheinlich übermannte ihn die Wucht der damaligen Ereignisse um ein Vielfaches mehr, als ich es empfand. Und ich will es ihm nicht verdenken, denn nur Gott allein weiß, wie ihm sonst geschehen wäre.
Je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich mir, dass trotz allen Strebens nach Gerechtigkeit, Strafe und Ausgleich vom Grafen Meik in dieser ersten Stunde viel Sachverstand und Augenmaß vorgebracht wurde, wofür ich ihm heute noch außerordentlich dankbar bin.
Zwei Wachleute mit dem Henk an der Spitze kamen auf mich zu und der Hauptmann forderte mit ernster Miene, ihm den Jungen zu übergeben. Mühevoll richtete ich mich auf, während Franco, der ja die ganze Zeit aufrecht gestanden hatte, dem Henk direkt ins Gesicht sah und ihm lächelnd die Hände zum Binden entgegenstreckte.
Am Ende dieses unglückseligen Tages fand sich Franco im Kerker der Feste wieder, der, wie ich allerdings zugeben muss, auf mich weit weniger bedrohlich und finster wirkte als jener in der päpstlichen Burg zu Rom. Ja, es ist nicht einmal übertrieben zu sagen, dass dieser Kerker, wenn es denn überhaupt ein solcher war, andernorts und zu anderen Zeiten durchaus auch einem anderen, wohnlicheren Zwecke oder gar als Vorratslager dienen konnte. Er war vollgestellt mit allerlei altem Krame und es roch nach Schimmel und morschem Holz. Die Türe zum Gang hin war nur ein hölzernes Gitter, welches ganz sicher nicht nur den Mäusen und Ratten ohne Hindernis Einlass gewährte. Auf ein Schloss von außen konnte man getrost verzichten. Der alte Eichenriegel, der hier seinen Dienst tat und quer über die Mitte gelegt wurde, war nicht nur der einzige Verschluss, sondern vor allem wohl dazu gedacht, die Türe zu stützen, auf dass sie nicht herausfalle.
Dennoch, bei aller Nachsicht, die man meinem Schüler gegenüber bei der Kerkerhaft walten ließ, war für alle unübersehbar, dass dies nur seiner Jugend und meiner Fürsprache für ihn, vor allem aber des energischen Einspruches der Hildegard und der Frau Gräfin, die sich sogar gemeinsam vor den hochheiligen Herren Erzbischöfen und dem Grafen Meik auf den Boden geworfen hatten, um sie zu erweichen, geschuldet war.
Ich wusste, dass die Zeit kommen würde, in der Franco und ich nicht mehr auf die beschützende Hand dieser klugen und nachsichtigen Frauen vertrauen konnten, mochte den Gedanken aber nicht bis in seine letzten Folgen bedenken. Schon in naher Zukunft würde der Heilige und Gerechte Kaiser ein eigenes Urteil fällen und sich darin von niemandem abbringen lassen. Sicherlich würde er darauf bestehen, dass jemand, der seinem geliebten Sohne und geweihten Nachfolger auf dem Königsthron eine solch ehrlose Erniedrigung vor aller Augen angetan hatte, der beschlossenen Strafe auch tatsächlich ansichtig werden würde, ganz gleich, wer oder was er war.
Franco drohte eine lange Haft, endlose Qual in dunklen Kerkern oder gar der Tod! Auf diesen Zeitpunkt im Angesicht des kaiserlichen Gerichts bereitete ich mich nun vor, denn hier waren meine Dienste als kluger Advokat gefragt. Wenn meine reichen Erfahrungen in diplomatischen Dingen und als Vermittler und Botschafter seiner Majestät des Kaisers nicht in der Lage wären, Franco aus seiner misslichen Lage zu retten, wer sollte es dann schaffen? Nun, selbst wenn es mir nicht gelingen sollte, ihm die Haftstrafe gänzlich zu ersparen, so wollte ich doch wenigstens sein Leben und seine Gesundheit schützen und auf eine baldige Verbannung hinwirken. Viele Stunden, weit mehr als gewöhnlich, verbrachte ich im Gebete für meinen Schüler und für seine arme geschundene Seele.
Die ganze Fröhlichkeit und Ausgelassenheit der letzten Tage und Wochen war plötzlich verschwunden. Die Feste Vossberg versank in einen grauen alltäglichen Taumel, in dem niemandem mehr nach Feiern und Gelage zumute war. Natürlich wurde weiter gespeist und getrunken. Bei Tische versuchten alle, besonders die beiden Erzbischöfe und der ebenfalls wieder anwesende Bischof Simon von Berenthal, so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung, aber die schlechte Farbe übertünchte das morsche Holz nur bis zum nächsten Regen, um dann verdünnt und einer Träne gleich im ausgetrockneten Boden zu versickern. Gespräche flackerten nur kurz auf und erloschen sofort wieder, das Essen schmeckte fad, obwohl der Barbara daran kein Vorwurf zu machen war. Eine unausgesprochene Peinlichkeit lag über allem im Saale und niemand wusste, wie dem zu begegnen sei, wünschte man sich doch gemeinsam wieder die schönen Stunden herbei, in denen recht ausgelassen und guten Mutes getafelt und gefeiert wurde.
Der junge König Otto hingegen, der am meisten Betroffene von allen, schien das alles im besten Sinne überstanden zu haben. Er verstand die Aufregung um das schöne neue Spiel nicht und erst recht nicht, dass man ihm ausdrücklich verbot, es jemals wieder zu spielen. Ihm waren zu seinem Glücke noch drei Spielgefährten verblieben und wenn er fragte, wo denn der Franco sei und warum er nicht mehr mit ihm spielen und herumtollen dürfe, antwortete man ihm unehrenhaft, dass Franco sehr krank sei und viele Tage Ruhe bräuchte. Die immer noch verängstigten Mädchen Oda und Rosvith wandten sich dem Otto und dem Danilus nun wieder in größerem Vertrauen als zuvor zu. Nun, da sie außerhalb von Francos Reichweite waren, gefährdete nichts den guten Sitz ihrer Röcke, sie entzogen sich kaum noch, und wenn, dann nur sehr kurz, ihrer Beaufsichtigung und die Sorgenfalten in den Gesichtern der Kinderfrauen glätteten sich weiter von Tag zu Tag und in dem gleichen Maße, wie die kleinen Dellen in ihren noch jungfräulichen Seelen.
Franco de Ferrucius hatte sich in den Augen der Erzbischöfe und der anderen hohen Herren schwerer Vergehen gegen Gott, die heilige Institution der Kirche und gegen die kaiserliche Familie schuldig gemacht.
Die Anmaßung des höchsten bischöflichen Amtes durch das Tragen der päpstlichen Tiara (es war natürlich nur eine schlechte Imitation aus drei übereinander getragenen Hauben aus Leinenstoff, einem Kissen ähnlicher als einer Mütze) mochte dabei nur der augenfälligste Teil gewesen sein. Viel schwerer als das wog die Erniedrigung, die er dem geweihten König Otto, dem Sohne des heiligsten Kaiserpaares, angetan hatte. Der junge König war hinter ihm, einem Hund gleich an einer Leine geführt, über den Hof geschleift worden – zudem vor den Augen aller Herrschaften, Bediensteten und Gäste.
Es war eine durch nichts wiedergutzumachende Schande, eine offene Demonstration der Machtlosigkeit, der Schwäche, der Hilflosigkeit und der Ohnmacht des Geheiligten Königs, die so von niemandem hingenommen werden konnte. Unter allen anderen Umständen hätte jemand, der es wagte, ein Mitglied der kaiserlichen Familie derart durch den Dreck zu ziehen, auf der Stelle seinen Kopf verloren. Nur der Herrgott allein in seiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit hatte es vermocht, meinen jungen Schüler in dieser ausweglosen Situation zu beschützen und ihm vorerst sein Leben zu retten.
Noch am selben Tage wurde ein Bote ausgesandt, der den Kaiser und seine Gemahlin über die neuesten Ereignisse auf dem Vossberg in Kenntnis setzen sollte. Allgemein wurde erwartet, dass der Bote in wenigen Tagen, längstens in zwei Wochen, mit einem kaiserlichen Urteilsspruch zurückkehren würde. Franco, so schien es, sollte bis zum Eintreffen des Urteils hier in Gefangenschaft verbleiben. Alsbald darauf wurde mir durch den Herrn Lucius in einem geeigneten Moment zu verstehen gegeben, dass die Grafschaft, ebenso wie die hohen Mitglieder der kaiserlichen Familie, meine baldige Abreise wünschten und er mich ermutigen wolle, die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen.
Ich wusste in dem Lucius einen edlen Herrn und guten Freund, dessen Herz vollkommen frei von Intrige und Missgunst war, deshalb nahm ich seinen Hinweis als guten Ratschlag an und begann sofort damit, die wenigen mir verbliebenen Sachen zusammenzupacken. Doch was würde mit Franco geschehen? Konnte ich ihn hier wirklich allein zurücklassen? Er war mein Schüler, er war noch zu jung, zu unbedarft und zu unerfahren, sein Glaube noch zu schwach, um seine Sache mit genügend Hoffnung und Gottvertrauen vertreten zu können. Und ward er von seinem Vater nicht meiner Obhut anvertraut? Hatte ich nicht einen Schwur geleistet, ihn zu lehren und zu beschützen? Und musste ich mich nicht allein aus diesem Grunde schon an seiner Seite halten, bis klar würde, was mit ihm geschehen soll? Ich hielt inne, setzte mich auf mein Ruhelager und dachte angestrengt nach.
Wie viel Zeit zum Verweilen hatte ich noch, ohne die Gastfreundschaft der Burgherren über Gebühr in Anspruch zu nehmen? In gesandtschaftlichen Kreisen bedeutete die offizielle Aufforderung zur Abreise im Allgemeinen, dass dies innerhalb von drei Tagen zu verrichten war, sodass noch genügend Zeit blieb, die Dinge zu ordnen, Rechnungen zu begleichen und bei Bedarf eine Reisegesellschaft zusammenzustellen. Unter besonders günstigen Umständen konnte man sich aber auch mit einer fremden Gesellschaft beschließen, was die Kosten für die Lastentiere und für den eigenen Schutz senkte, um im Gegenzug den Komfort meist beträchtlich anzuheben.
Dass es sich um eine offizielle Aufforderung handelte und nicht etwa um einen persönlichen Wunsch des Lucius, wagte ich nicht ernsthaft in Zweifel zu ziehen, auch wenn die Art der Überbringung etwas seltsam erscheinen mochte. Natürlich verlangten sein Vater und die beiden Erzbischöfe, von ihm zu wissen, wann und in genau welchem Wortlaut er mir die Botschaft überbracht hatte und wohl auch was ich darauf erwidert hatte.
Als der dritte Tag anbrach und von dem Boten weit und breit noch nichts zu hören war, beschloss ich, beim Grafen und den beiden Erzbischöfen mit meinem Anliegen vorzusprechen. Damit noch länger zu warten, wäre mir als Unhöflichkeit oder gar Schlimmeres ausgelegt worden. Um mich der Gunst und Unterstützung der hohen Frau Gräfin zu versichern, war ich bereits am Tage zuvor in aller Heimlichkeit und unter Zuhilfenahme der braven Hildegard zu ihr durchgedrungen und hatte sie überzeugen können, dass meine Abreise unmöglich ohne meinen lieben Schüler erfolgen könne, worauf ich nicht nur durch einen heiligen Eid verpflichtet war, sondern mich auch durch ein enges Vertrauen und Liebe gebunden fühlte.
Nun traf ich die drei hohen Herren am Vormittag im Hofe, während sie sich offenbar für einen Ausritt vorbereiteten. Ihnen anbei stand außerdem Bischof Simon, ebenfalls zum Ausritte bereit, so dass ich nunmehr alle vier Herren zusammen ansprechen musste, ein nicht unwichtiger Umstand, der die Lage, in der ich mich befand, zusätzlich zu meinen Ungunsten beeinflusste.
„Ihr könnt ihn mitnehmen, Liutprand!“, rief Erzbischof Brun schon von weitem, noch bevor ich das Wort an ihn richten konnte.
Ich trat näher heran, verneigte mich in der tiefsten und vornehmsten Art, zu welcher ich in der Lage war, und sagte demutsvoll:
„Ich wünsche den hochverehrten Herren einen Guten Tag!“
Keiner der vier ging auf meine freundliche Begrüßung ein.
„Wir wollen ihn hier nicht haben“, sagte Meik, während er sein Pferd tätschelte.
„Ich verstehe nicht“, antwortete ich mit einiger Verlegenheit. „Woher wisst Ihr …?“
Brun kam einen Schritt auf mich zu und legte mit väterlicher Geste seine Hand auf meine Schulter. „Nun, mein lieber Bruder Liutprand, dass es mit Eurem Glauben nicht so weit her ist, wie es vielleicht sein sollte, ist die eine Sache. Aber Ihr solltet nicht auch noch Euren Verstand, von dem wir bisher nur Gutes gehört haben, in den Orkus werfen. Denkt immer daran, dass nicht nur der Herr Augen und Ohren hat.“
„Oh, verzeiht meine naive Art, verehrter Brun“, erwiderte ich entschuldigend. „Ich hätte wissen müssen, dass …“
„Ach Unsinn!“, unterbrach er mich. „Benutzt Euren Verstand! Und zu Eurem Schüler möchte ich Euch ein warnendes Wort mit auf den Weg geben. Habt mehr als ein Auge auf ihn! So er dies hier überstanden hat, und ich hoffe und wünsche für Euch, dass der Kaiser sich von seiner gnädigen Seite zeigen wird, bedarf es einer noch weit größeren Anstrengung von Euch, um ihn zu erretten. Dieser Junge wird Euch ebenso große Freude wie unendlichen Kummer bereiten. Er ist ein Teufel, ein Dämon! Vergesst das nie! Niemals!“
Brun hatte eine große Eindringlichkeit in seiner Stimme und es schien, als wolle er mich aufrichtig vor einem bevorstehenden Unheil bewahren. Nun war aber hier nicht die Zeit, zu widersprechen und sich auf einen Disput einzulassen. Also schluckte ich meine Worte hinunter und versuchte, mich auf die Dinge zu besinnen, die unmittelbar bevorstanden.
„Wie ich weiß, habt Ihr einen kaiserlichen Boten entsandt, dessen Rückkehr bald ansteht, verehrter Brun“, sagte ich. „Wäre es nicht angebracht, hier auf seine Ankunft mit dem Urteil des Kaisers zu warten?“
„Nein, das wird nicht nötig sein. Zieht nur los, Liutprand“, antwortete Graf Meik an seiner Stelle. „Wie ich erfahren habe, führt Euch Euer Weg in die Pfalz nach Mimileibo, wo sich der Kaiser und seine Gemahlin aufhalten. Welch glückliche Fügung, will ich meinen.“
Er lächelte milde in die Runde der edlen Herren und bekam als Antwort ein beinahe höhnisches Grinsen von allen Seiten.
Natürlich wusste ich, in welch hinterhältigem Spotte er sich erging, wenn er den uns bevorstehenden Weg in dieser Art lobte. Und damit auch der letzte Pferdeknecht begriff, wie dies gemeint war, fügte er hinzu: „Denn welches Urteil unser Gerechter Kaiser auch immer fällen wird, wir werden Euch und Euren Schüler auffinden und es vollstrecken, das ist allerorten und zu jeder Zeit gewiss. Doch macht Euch darum noch keine Sorgen, wir selbst sind zuversichtlich genug.“