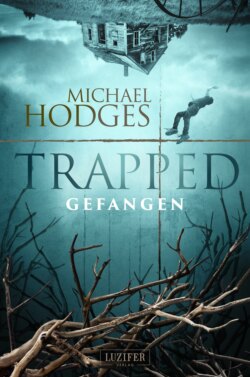Читать книгу TRAPPED - GEFANGEN - Michael Hodges - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Reisende
ОглавлениеDer Kojote, ein Weibchen, ließ den schmalen Streifen Laubwald in der Vorstadt hinter sich. Das Tier überquerte geruhsam die Hemson Road, wobei es einen rostenden Ford Taurus umgehen musste, und schlug sich dann durchs Dickicht am schlammigen Worthington River entlang. So folgte es dem Flusslauf mehrere Meilen, während es darauf achtete, sich im Schutz der Dunkelheit fortzubewegen. Menschen hätten das Tier nicht ohne Weiteres im Unterholz erkannt, und das wusste es.
Als der Kojote über ein Maisfeld zuckelte, lag der strenge Geruch von Nagern in der Luft. Er hielt inne, woraufhin seine Ohren zuckten, als der Wind an einer Stelle durch die Kolben fuhr. Dann neigte er den Kopf zur Seite, denn er hörte eine Maus, wo der feuchte Erdboden ins baumreiche Einzugsgebiet des Flusses überging. Die Ohren richteten sich auf, und er stürzte los. In einer fließenden Bewegung knickte er den Kopf nach hinten ab, um eine Feldmaus hinunterzuwürgen. Danach kehrte er seine Lefzen leckend ins Unterholz zurück.
Als die Sonne unterging, schlug das Tier einen schnelleren Schritt an, rannte an gefällten Schwarzbirken und taunassen Spinnweben vorbei. Es mochte Spinnen nicht sonderlich und kläffte, wenn es spürte, dass sie über ihr Fell krabbelten.
Irgendetwas trieb sie nach Norden. Es war weder die Aussicht auf einen Partner – sie hatte schon einen, besten Dank auch – noch der Drang, ihr Revier auszuweiten. Ein starkes Verlangen scheuchte sie, obwohl sie wusste, dass die Menschen das nicht unbedingt guthießen. Sie stellten ihr nach – Männer mit Feldstechern und Gewehren. Viele davon wollten sie erschießen; warum, das konnte sie nicht nachvollziehen. Sie hatte Geschwister an die Metallwespen und Fallen verloren, ihnen zu helfen versucht, als sie darauf verfallen waren, ihre eigenen Pfoten durchzubeißen oder sich mit zertrümmerten Hüftgelenken in den Wald geschleppt hatten. Einmal hatte sie einen dieser Verletzten zum Fluss geschleift und ertränkt. Zwei Monde lang war sie am Heulen gewesen; sie hatte nicht gewusst, was sie sonst tun sollte.
Hechelnd rollte sie sich unter einer umgestürzten Gelbbirke zusammen und kratzte sich mit einer Hinterpfote an den Ohren. Dann trippelte sie zum Ufer hinunter und streckte ihren bauschigen Schwanz in die Luft, als sie sich nach vorn beugte, um Wasser zu schlecken. Sie dachte nicht daran, dass es verseucht sein könnte.
***
Die Sonne ging über Baraboo in Wisconsin auf und ließ den Hof in einem Licht erstrahlen, um das sich jeder Fotograf gerissen hätte. Reif – und Pflanzenschutzmittel – glitzerten auf den ebenmäßigen Feldern wie eine dünne Eisschicht.
Eric Gnomes wachte vom Gegacker seiner Hühner auf. Er zog seinen Overall über und das .22er-Gewehr aus dem Schrank.
Gottverdammte Kojoten schon wieder, dachte er, während er das Magazin in die Halterung rammte. Er mochte es, wie die Waffe in seinen Händen lag; sie vermittelte ihm ein Gefühl von Macht in einer Welt, in der er sich häufig ohnmächtig fühlte.
Die Hühner gackerten wieder aufgeregt, woraufhin er durch die Hintertür nach draußen eilte und sie zuknallen ließ, dass weiße Farbe auf die Veranda abblätterte. Während er schnaufend zum Hühnerpferch lief, flatterten die wenigen Haarsträhnen, die noch auf seinem Scheitel verblieben waren, im Wind. Unterwegs suchte er den Zaun nach Schäden ab. Er sah die Hühner zwar nicht, wusste aber, dass sie im Stall hockten und panisch flatterten. Nachdem er das Eingangsgatter aus Draht entriegelt hatte, schwang er es auf. Die Jagd konnte beginnen. Gnomes rannte zum Stall hinüber, legte auf die dunkle Türöffnung an und spähte hinein. Langsam gewöhnten sich seine Augen an den düsteren Bereich vor der hinteren Wand. Zwischen seinem edlen Geflügel saß ein Kojotenweibchen, als wolle es nichts Böses, als sei alles ganz normal. Für Gnome war dieses Tier ein Narrenbote der Natur, geschickt, um ihn zu verspotten, zu verärgern.
»Hey, Rattengesicht!«, rief er.
Als die Kojotin ihren Kopf drehte, sah er ein totes Huhn, das an seinem gebrochenen Hals zwischen ihren Kiefern klemmte. Sie huschte an einer Hühnerstange nach oben auf die Käfige zur Eiablage, während das tote Huhn in ihrem Maul schlackerte. Gnomes eröffnete das Feuer, streute Schüsse in den Stall, ein jeder wie ein knallender Peitschenhieb. Weiße Federn stoben in die Luft, während sich die Hühner aufplusterten und gegeneinanderstießen, als sei eine Kissenschlacht zugange. Einige seiner geschätzten Tiere zockelten an ihm vorbei, während er mit dem Schießen fortfuhr. Kugeln zerfetzen Fleisch, Knochen brachen. Gnomes biss bei Mündungsblitz und Rückstoß auf die Zähne, unerschrocken, trotz des Chaos. Sein Gewehr war kein gewöhnliches vom Kaliber .22, weiß Gott, nein; er hatte es von Terry Garr, einem Mitglied der örtlichen Bürgerwehr, modifizieren lassen. »Jetzt haste kein .22er-Standardpusterohr mehr«, so die Worte des Mannes.
Als er genug hatte vom Sperrfeuer und streng riechenden Pulverqualm, ließ Gnomes den Abzug los; zwei Patronen steckten noch im Magazin. Nachdem die Federn zu Boden gesunken waren, zählte er vier tote Hühner und eine Menge Blut, das an die hintere Wand gespritzt war.
Von dem Kojoten sah er nichts.
Er duckte sich, um einen besseren Blick zu den oberen Nistplattformen zu erhalten, streckte seinen Kopf in den Stall und schaute in die dunklen Ecken. Eine einzelne weiße Feder driftete herab. Sie zitterte, während sie zu Boden sank, beruhigte Gnomes wie eine Mutter, die ihrem weinenden Säugling ein Lied singt. Während er ihrer einlullenden Abwärtsbewegung folgte, blitzten zwei Lichter wie Goldmünzen in einem finsteren Winkel auf; eine Sekunde später verengten sie sich zu bernsteinfarbenen Schlitzen. Er bekam einen Adrenalinschub und stieß sich den Kopf am Überbau, weil er zurückschreckte, sodass ihm schwarz vor Augen wurde. Die Kojotin knurrte und sprang aus der dunklen Ecke auf den mit Kot bedeckten Boden. Gnomes hob seine Waffe, versuchte den stechenden Schmerz an seinem Hinterkopf zu verdrängen, und machte sich bereit zum Schuss. Der Gewehrlauf schwankte. Beim ersten Mal zielte er zu hoch, und die Kugel schlug in die Wand; als er wieder abdrückte, hatte er zu niedrig gezielt, weshalb er nur den verdreckten Boden traf. Die Kojotin stürzte auf die Stalltür zu. Gnomes holte mit der Waffe nach der Kojotin aus und schlug den Lauf genau gegen ihren Beckenknochen. Sie kläffte auf und lief vorbei. Er fuhr herum – wohl wissend, dass das Tier nicht klug genug war, um das offene Gatter zu finden. Mit diesem Hintergedanken packte er das Gewehr am Kolben, damit er ihm den Griff wie einen Hammer überbraten konnte. Der alte Narrenbote sollte lernen, was es bedeutete, sich mit Eric Gnomes anzulegen.
Die Kojotin streifte am Zaun hin und her, um einen Ausweg zu finden.
»Dumme Ratte«, schimpfte er, während er schweren Schrittes auf sie zuging und ein Rinnsal Blut in sein Genick tropfte. »Findest nicht raus, was?«
Die Kojotin streckte sich mit ihren Vorderläufen bis auf halbe Höhe des Zauns auf und ließ sich dann wieder auf alle viere nieder. Sie bewegte sich gezielt, allerdings auch verzweifelt. Mehrere aufgescheuchte Hühner zappelten und gackerten am Rand des Pferches.
***
Sie hatte dem Mann zwar den Rücken zugekehrt, hörte ihn aber näherkommen; auf ihr Gehör war Verlass. Einen Augenblick später ragte er mit dem Gewehr hinter ihr auf. Sie gab vor, ihn nicht zu bemerken, was sie aber sehr wohl tat. Als sie erkannte, dass er schneller ging, und seine Schritte am Boden wahrnahm, wirbelte sie zu seinen Füßen herum und biss in einen Knöchel, so fest sie konnte. Als er sich danach bückte, trieb sie ihre Zähne in seinen nackten Unterarm, sodass Blut auf ihr glänzendes Fell spritzte. Gnomes brüllte und brach zusammen, das Gewehr fiel in den Sand.
Nachdem sie weiter am Zaun herumgelaufen war, fand sie endlich die Öffnung, die sie zuvor gebuddelt hatte. Sie zwängte sich hinein, schob sich grunzend durch das Loch. Dann wetzte sie in den Uferwald zwischen Birken und Erlen, wo sie vor den neugierigen Augen der Menschen sicher war. Anscheinend wurde man sie nie los; sie waren überall, ständig. Sie wollte nur bei ihresgleichen sein. Der Mann hinter ihr schrie, war wütend, das waren die Menschen immer.
Die Sterne geleiteten sie am Fluss entlang, während sie dem Instinkt folgte, der sie nach Norden trieb.
Bald nahm die Zahl der Menschen in der Umgebung ab, obwohl das Land noch immer vor ihnen wimmelte. Die Nächte kühlten ab, weshalb sie nicht mehr so viel hecheln musste. Der Fluss wurde breiter, der Wald dichter. Die Tage verschwammen ineinander, ein Einerlei aus Nagern, Krebsen und rauschender Strömung. Zudem schmeckte das Wasser besser. Sie begegnete Tieren, die sie nie zuvor gesehen hatte – etwa einer langsamen, gewaltigen Ratte, aus der Dornen wuchsen. Sie wollte sie fressen, doch die Dinger stachen ihr in die Nase; darum musste sie ihren Kopf einziehen und ihre Pfoten auf die Dornen stellen, um sie herauszuziehen. Ihre Nase tat immer noch weh.
Die Bäume am Ufer veränderten sich. Viele sah sie zum ersten Mal, solche mit spitzen Blättern und strengen Düften. Wie sie rochen, gefiel ihr. Außerdem mochte sie die besonders dicken Hasen mit den großen Füßen; auf die war sie auch noch nie gestoßen.
Die Nächte wurden kälter, Begegnungen mit Menschen seltener. Sie wagte sich weiter vom Fluss fort, blieb aber trotzdem immer vor den Zweibeinern verborgen. Eines Nachts schlief sie sogar fernab des Wassers.
Sie kringelte sich an einem verharzten Baumstumpf ein und schob die Schnauze unter ihren Schwanz. Als sie aufwachte, war ihr Fell mit Reif überzogen. Sie schüttelte sich. Auf dem Rückweg zum Fluss erblickte sie etwas, das sie auch noch nie gesehen hatte. Es war schwarz, besaß breite Schultern und ein noch dickeres Hinterteil. Dieses Tier jagte ihr Angst ein. Seine Krallen waren sehr lang. Sie sträubte sich, ging nervös herum und lief schließlich weiter. Als sie kurz darauf wieder stehen blieb und sich umdrehte, schien das Riesengeschöpf sie aber gar nicht bemerkt zu haben. Sicherheitshalber hielt sie sich davon fern. Sie konnte es riechen; es verpestete den ganzen Wald.
Im Laufe der Tage sichtete sie mehrere dieser Tiere, kleine wie große. Sie fand heraus, dass sie nicht besonders klug waren, musste aber Abstand zu ihnen wahren; sie mochten sie nämlich überhaupt nicht. Das sollte ihr recht sein; solange sie fernblieben, war es in Ordnung.
Was das Fressen anging, so konnte sie sich nicht beklagen; Nahrung war in Hülle und Fülle vorhanden. Sie wollte ihren Partner herbringen, ihm die Freiheit zeigen. Sie hatten einen Bund fürs Leben geschlossen, wie es alle anständigen Kojoten taten.
In dieser Gegend lebten kaum Menschen, weshalb es auch nur wenige Pfade mit hartem Boden oder Metallroller gab. Dies war ein gutes Land für Kojoten.
Heute wachte sie unter einer Tanne auf, deren Äste verhinderten, dass Regen auf sie tropfte. Als sie etwas im Wind witterte, stand sie auf und wartete darauf, dass sich das andere Tier zeigte. Sie richtete die Ohren geradeaus nach vorn, wobei sich ihre Pupillen weiteten. Dann rauschte es leise – Zweige, die über Fell strichen und dann wieder zurückschnellten.
Von Süden her hörte sie Schnaufen, Zähne blinkten zwischen raschelndem Laub auf.
Sie knurrte und ging rückwärts, bereitete sich auf einen Kampf vor.
Als der Fremde zwischen Blaubeersträuchern hervortrat, bellte sie schrill und zog Kreise; der andere Kojote tat das Gleiche. Sie rieben ihre Nasen aneinander und leckten sich gegenseitig die Schnauzen.
Es war ihr Partner.
Sie liefen gemeinsam los, kläfften und leckten weiter, um einander die Felle zu säubern, tollten herum. Schließlich preschten sie hinaus auf ein Feld und sprangen hintereinander her – die Schwänze hochgestellt, Pfoten und Beine gespreizt.
Sie jagten Wühlmäuse, rissen sie und schlangen sie hinunter. Das Weibchen hielt inne, streckte seine Schnauze in die Luft und schnupperte. Von Norden her wehte ein Geruch heran, dem zu folgen, sie gezwungen war. Das wusste sie. Ihr Partner stierte sie an; der Wind fuhr durch sein Fell.
Dann lief sie voraus, und er folgte ihr.