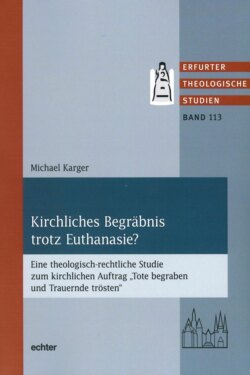Читать книгу Kirchliches Begräbnis trotz Euthanasie? - Michael Karger - Страница 10
Оглавление1. Einleitung
„Wer mit ganzem Herzen Seelsorger ist, wird immer wieder an diese schmerzliche Grenze stoßen: ist die Barmherzigkeit Gottes, ist Jesu Liebe zu den Sündern, für die er gekommen ist, ‚blockiert‘ durch allerlei Bestimmungen des ‚Kirchenrechts‘, der Kirchensatzung? Ist die Alternative in der Seelsorge Rigorismus oder Laxismus? Everything goes – oder nothing goes?
Ich spüre manche Verunsicherung. Die Unklarheit macht mutlos, resigniert. Wohin geht die Fahrt? Alles den Bach hinunter in Beliebigkeit – oder doch irgendwo ein fester klarer Halt? Manche fühlen sich vom Bischof alleingelassen, sich selber überlassen, verwirrt, irritiert, traurig.“1
Mit diesen Worten wandte sich der Erzbischof von Wien Kardinal Christoph Schönborn am 2. April 2012 an die Seelsorger2 seiner Diözese und verdeutlichte die besonderen Herausforderungen, mit denen Seelsorger heutzutage in der Ausübung von pastoraler Sorge konfrontiert werden. Die direkte Umsetzung des Sendungsauftrages der katholischen Kirche, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden und durch die Feier der Heilsmittel immer wieder aufs Neue ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen (Lk 4,18f), werde dadurch erschwert, dass Menschen in Lebenskonstellationen bzw. -situationen leben, die der kirchlichen Lehre offenkundig widersprechen – ohne dass sie selbst diese Empfindung teilen würden. Diese Diskrepanz zwischen kirchlicher Lehre einerseits und gelebter Wirklichkeit andererseits führe auf Seiten der Seelsorger zu einer großen Verunsicherung und Unklarheit über das pastoral richtige Handeln und die rechtmäßigen Möglichkeiten seelsorglicher Begleitung.3 Die Seelsorger nämlich wüssten sich aufgrund ihres Kirchenamtes oder ihrer Beauftragung durch den Bischof und dem damit einhergehenden Sprechen im Namen der Kirche grundsätzlich der kirchlichen Lehre verpflichtet, empfänden aber gleichzeitig ein konkretes Sendungsbewusstsein zu den Menschen und wollten dieses auch in schweren Momenten in seelsorgliches Handeln umsetzen. Ein solches emotionales Hin- und Hergeworfen-Sein im Sinne eines einerseits …, andererseits … berge die Gefahr in sich, dass die Seelsorger in zweifelhaften und spannungsgeladenen Situationen auf der Suche nach Orientierung die geltenden kirchenrechtlichen Normen vor allem zur Sakramenten- und Sakramentalienspendung entweder absolut rigoristisch interpretieren, was zu Restriktion und Verweigerung führe, oder aber ein laxes Rechtsverständnis im Sinne eines Alles ist irgendwie möglich bzw. einer falschen Barmherzigkeit zugrunde legen. Beide Extreme scheinen nach Schönborns Ansicht ungeeignet, sich den konkreten Lebenssituationen der Menschen in angemessener Weise zu nähern, deren theologische und rechtliche Implikationen zu reflektieren und schließlich vor dem Hintergrund der kirchlichen Rechtsnormen eine Entscheidung zu treffen, in der der konkrete Sachverhalt mit seinen ganz eigenen Umständen und in seiner Komplexität zum Tragen kommt.
Sowohl das von Kardinal Schönborn angesprochene Spannungsverhältnis zwischen kirchlicher Lehre und deren Verkündigung sowie der gelebten Wirklichkeit als auch die daraus resultierenden Unsicherheiten auf Seiten der Seelsorger über die Frage, was getan werden könne und dürfe, lassen sich vor allem dort beobachten, wo die katholische Kirche als Institution und in ihrer Vertretung ihre Seelsorger vor Ort mit Fragen konfrontiert werden, die das pastorale Handeln und somit die Ausübung der Seelsorge betreffen. Nicht selten erwachsen solche Suchbewegungen aus der Diskrepanz einer staatlich legitimierten Handlung bei gleichzeitig existierender kirchlicher Verurteilung derselben. Überdies treten solch empfundenen Spannungen und Unsicherheiten immer dann auf, wenn Menschen ihr Leben nicht an der kirchlichen Lehre orientieren, aber dennoch ihren Glauben leben und die kirchlichen Heilsgüter empfangen wollen.
Einem solchen Seelsorgebereich mit seinen eigenen komplexen Fragestellungen, Spannungen und Unsicherheiten seitens der kirchlichen Seelsorger widmet sich die vorliegende Studie. Die Rede ist von der möglichen Gestaltung von Seelsorge im Kontext von Euthanasie und Behandlungsabbruch bzw. -verzicht. Da es der kirchlichen Lehre widerspricht, selbst bei schwerstem Leiden den eigenen Tod bewusst herbeizuführen oder in dessen Herbeiführung einzuwilligen oder aber eine medizinische Handlung abzubrechen bzw. zu unterlassen, um den Tod herbeizuführen, stellt sich für die katholische Kirche und ihre Seelsorger bei derart geäußertem Wunsch oder Vollzug die Frage, ob und wie Seelsorge für diese Menschen vor dem Hintergrund des kirchlichen Sendungsauftrages gestaltet werden kann, darf oder muss. Theologische wie rechtliche Anfragen beziehen sich in diesem Kontext einerseits auf die Wirkungskraft und die rechtmäßige Spendung der Krankensalbung, des Viatikums und des Bußsakraments sowie andererseits nach dem Eintritt des Todes durch Euthanasie oder Behandlungsabbruch bzw. -verzicht auf die Feier des kirchlichen Begräbnisses für den Verstorbenen.4
Die vorliegende Studie beschränkt ihren Fokus auf das mögliche oder sogar geforderte pastorale Handeln nach der bewussten Herbeiführung des Todes. Es wird unter Berücksichtigung der theologischen, liturgischen und moraltheologischen Aspekte aus kirchenrechtlicher Perspektive gefragt, ob das kirchliche Begräbnis gespendet werden darf, kann oder sogar muss, wenn der verstorbene Gläubige vor seinem Lebensende die Herbeiführung des Todes gewünscht und in entsprechende Handlungen eingewilligt hat. Konkret wird der Seelsorger vor Ort mit der Frage konfrontiert, ob er katholischen Gläubigen, die aufgrund einer bewussten Herbeiführung des Todes, durch Behandlungsabbruch oder -verzicht im Sinne eines Zulassens des Sterbens oder aufgrund eines in Kauf genommenen Todes durch Schmerzmittelgabe aus dem Leben geschieden sind, vor dem Hintergrund ihres fundamentalen Rechts auf ein kirchliches Begräbnis und der Pflicht der Kirche, ein solches zu feiern, die Feier eines solchen gewähren oder verweigern kann, darf oder muss.
1.1. Forschungsfrage und Problemskizze
Die politischen, gesellschaftlichen und medizinischen Debatten über die staatliche Legitimierung von medizinischen Handlungen am Lebensende wie bewusste Lebensbeendigung, Behandlungsabbruch und -verzicht sowie (ärztlich) assistierter Suizid besitzen zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor allem in den westlich geprägten Teilen der Welt eine kaum zu übertreffende Aktualität und Brisanz.5 Durch den kontinuierlichen medizinischen Fortschritt, der es Ärzten ermöglicht, auf nahezu jede Krankheit mit einer Vielzahl von Therapien zu reagieren und das Leben ausweglos Erkrankter über Jahre zu verlängern, ist die Lebenserwartung signifikant gestiegen.6 Menschen werden häufiger und intensiver mit dem eigenen physischen Abbau, mit psychischen Einschränkungen wie Altersdemenz oder auch anderen chronischdegenerativen Krankheiten konfrontiert. Im Gegensatz zur praeintensivmedizinischen Epoche, fordert die heutige Zeit im Übergang vom Leben zum Tod von jedem Einzelnen eine Positionierung über die eigenen Wünsche. Von der Gesellschaft wird eine Reflexion über eine menschenwürdige „Kultur des Sterbens“ erwartet, die thematisch nicht an den gesellschaftlichen Rand gedrängt werden darf, sondern als Teil des Lebens wahrgenommen werden muss.7
Dass es zumindest im öffentlichen Diskurs einen breiten Konsens darüber gibt, was gutes Sterben zu sein scheint, belegt die immer wieder aufkommende Forderung nach einer gesetzlichen Regelung der Mitsprache des Patienten über Behandlungsansätze und Therapien, ihre Dauer und Intensität. Hinter dieser optionalen Flucht vor den Belastungen einer durchtechnisierten Medizin mit ihrem Dogma des medizinisch Machbaren8 verbirgt sich oftmals der Wunsch nach eigenberechtigter Mitgestaltung des eigenen Lebens und Sterbens. Im Sinn eines menschenwürdigen Sterbens wird das Ziel verfolgt, am „Ende des Lebens einem schmerzvollen Leiden entgehen zu können und nicht bis zuletzt im Räderwerk einer als fremdbestimmend empfundenen Geräte- und Arzneimittelmedizin gefangen zu bleiben, die nicht nur das Leben, sondern auch das Leiden verlängern kann.“9 Immer weniger Menschen sind heutzutage bereit, ein Leben mit starken Schmerzen und hohen Belastungen, gezeichnet von Krankheit und therapeutischen Maßnahmen „schicksalsergeben hinzunehmen, wenn es […] durch ungünstige, unverschuldete innere oder äußere Entwicklungen zur Last und Qual geworden ist.“10 Seitens der Ärzteschaft werden ungeachtet der inhaltlichen Präferenz ebenso Forderungen nach einer gesetzlichen Regelung an die Gesetzgeber gestellt. Hinter diesen Bestrebungen, deren inhaltliche Bandbreite sich von der Forderung nach Legalisierung bis hin zum Verbot jeglicher den Sterbeprozess fördernder medizinischen Maßnahmen erstreckt, liegt der Wunsch nach Rechtssicherheit und Klarheit über das rechtlich Erlaubte begründet.11
Aus diesen medizinischen und politischen Diskussionen gingen in den verschiedenen Rechtsstaaten unterschiedliche, rechtlich legitimierte Gestaltungs- und Verfügbarkeitsoptionen über die letzte Phase des menschlichen Lebens hervor, wodurch sich die Bedeutung des subjektiven Faktors in Krankheit und Therapie exponentiell erhöhte. Diese weltweite Entwicklung erfordert von der katholischen Kirche, die seit Jahren als gefragter Gesprächspartner an entsprechenden wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Diskussionen teilnimmt und die als „global player“ mit diesen divergierenden staatlichen Rechtslagen zu Sterbehilfe und (ärztlich) assistiertem Suizid konfrontiert wird, nicht nur eine kontinuierliche Reflexion auf moraltheologischer und lehramtlicher Ebene. Unabhängig von einer etwaigen staatlichen Legitimation bedarf es zudem eines Nachsinnens über die Konsequenzen entsprechender Handlungen für die Gestaltung der kirchlichen Ausübung von Seelsorge, d. h. sowohl ihre Möglichkeiten aber auch Grenzen. Die Ortsbischöfe und ihre Vertreter sind vor die Frage gestellt, welche Handlungen sie im konkreten Einzelfall vollziehen können, dürfen oder sogar müssen. Diese Frage stellt sich jedoch nicht dem Moraltheologen oder dem Dogmatiker, die auf der Ebene der ethischen Beurteilung bzw. der Doktrin stehenbleiben und auf die nahezu abgeschlossene kirchliche Lehre über Euthanasie als in sich schlechte Handlung (intrinsece malum) und schweres Verbrechen gegen Gott und die Kirche sowie über andere medizinische Interventionen am Lebensende wie die verpflichtende Anwendung therapeutischer Maßnahmen und Schmerzmittelgabe mit in Kauf genommener Herbeiführung des Todes verweisen.12 Es ist der Seelsorger vor Ort, der – bestenfalls pastoraltheologisch, liturgiewissenschaftlich und kirchenrechtlich ausgebildet – über diese imaginäre Linie hinwegschreitet. Will er in der Ausübung seines Dienstes auf die ganz konkreten Anfragen und Wünsche des Verstorbenen und der Hinterbliebenen nach einem kirchlichen Begräbnis eingehen, muss er fragen, ob aus liturgisch-theologischer Sicht die Feier eines kirchlichen Begräbnisses angezeigt ist, inwieweit pastoralpraktische bzw. -psychische Gründe für die Feier eines solchen sprechen und welche kirchenrechtlichen Vorgaben für die Feier des kirchlichen Begräbnisses nach Vollzug von Sterbehilfe existieren. Stellvertretend für seinen Diözesanbischof als obersten Hirten in der Ortskirche, wird vom Seelsorger vor Ort nicht weniger gefordert, als die Entscheidung über die Feier eines kirchlichen Begräbnisses unter Einbezug der humanwissenschaftlichen Erkenntnisse über die psychischen Bedingtheiten von unheilbar kranken Menschen und vor dem Hintergrund der theologisch-ekklesiologischen Relevanz dieser Sakramentalie, der kirchlich-moraltheologischen Beurteilung entsprechender Handlungen sowie der Erkenntnisse der Interpretation des kirchlichen Rechts und in Wertung aller entsprechenden konkreten Umstände des sich ihm darbietenden Einzelfalles innerhalb der vorgesehenen Zeit zwischen Tod und Begräbnis zu treffen.
Dass in solchen Fällen mitunter die von Kardinal Schönborn angesprochene Hilf- und Ratlosigkeit der Seelsorger und pastoralen Mitarbeiter13 über das richtige und der Situation angemessene pastorale Handeln auftreten und sich auch aufgrund medialer Verbreitung auf andere übertragen, soll an folgenden zwei Fallbeispielen veranschaulicht werden:
Fallbeispiel Krijn (2002)
Die 74-jährige niederländische Toos Krijn (1927-2002) entschied sich im Februar 2002 nach starken unerträglichen Schmerzen wegen einer langjährigen Multiple Sklerose-Erkrankung für die in den Niederlanden straffreie Lebensbeendigung durch bewusste Herbeiführung des Todes. Daraufhin wurden ihr in ihrer Pfarrei Herz Jesu (Eindhoven, Bistum ‘s-Herzogenbosch/Den Bosch), in der sie über mehrere Jahrzehnte sehr aktiv war und ehrenamtlich gewirkt hatte, sowohl durch den Pfarrer Bartholomé van Oudheusden als auch den Pfarrvikar Caspar Maria Rutz das kirchliche Begräbnis und die Feier eines Requiems verweigert, da ihre Handlung der Lehre der Kirche widersprochen habe.14 Diese Entscheidung ist beim Ehemann, den Angehörigen der Verstorbenen und den Gläubigen der Pfarrei sowie der gesamten Diözese auf Unverständnis gestoßen. Im Gegensatz zu den beiden bereits genannten Geistlichen erklärte sich der emeritierte Pastor C. Ruijs aus der Eindhovener Nachbarpfarrei St. Trudo bereit, das kirchliche Begräbnis zu feiern.15 Da der Fall von Toos Krijn fortwährend auch über die niederländischen Grenzen hinaus das Interesse der medialen Öffentlichkeit erregte, gab der damalige Diözesanbischof von ‘s-Hertogenbosch/Den Bosch Antoon Hurkmans eine Stellungnahme ab, in der er die Vorgehensweise der beiden Pfarreipriester billigte. Gleichzeitig betonte er, dass auch Pastor Ruijs nicht falsch gehandelt hätte.16 Bischof Hurkmans gab zwar an, dass die Kirche die Entscheidung jedes einzelnen für aktive Euthanasie respektiere, verlangte aber im Umkehrschluss ebenso, dass auch der Standpunkt der Kirche respektiert werde, demgemäß jede Zuwiderhandlung gegen die Unantastbarkeit des Leben zu verurteilen sei.17
Die Unsicherheit im Umgang mit lebensbeendenden Handlungen zeigt sich im Fall Krijn sowohl auf der Pfarr- als auch Diözesanebene. Einerseits wurden nach Sichtung desselben Sachverhalts durch drei verschiedene Priester über Gewährung oder Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses gegensätzliche Entscheidungen getroffen, andererseits hätten nach Ansicht des Diözesanbischofs alle drei agierenden Priester nicht falsch gehandelt, sodass er ihnen wenigstens kein unrechtmäßiges und rechtswidriges Handeln attestierte.
Während im Fall Krijn zumindest die vollzogene Handlung der bewusst herbeigeführten Lebensbeendigung klar ersichtlich war, sodass eher die pastorale Vorgehensweise der Seelsorger zur Disposition stand, verdeutlicht das nachfolgende Fallbeispiel aus der Diözese Rom aus dem Jahr 2006, welche Konsequenzen unterschiedliche Interpretationen von medizinischen Handlungen oder Unterlassungen am Lebensende nach sich ziehen können. Nachdem das Vikariat der Diözese Rom den Abbruch von künstlicher Beatmung und Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr als „Realeuthanasie“ interpretierte und die Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses verkündete, erhoben sich weltweit kritische Stimmen. Diese richteten sich zunächst gegen die Verweigerung des Begräbnisses, in einem nachfolgenden Schritt aber gegen deren Begründung, die in der fehlerhaften Interpretation der vollzogenen medizinischen Handlung durch die kirchliche Autorität ausgemacht wurde.18
Fallbeispiel Welby (2006)
Der Italiener Piergiorgio Welby (1945-2006) wendete sich im Dezember 2006 nach 40-jährigem Leiden an progressiver Muskeldystrophie (Muskelschwund) und nahezu vollständiger Lähmung an den damaligen italienischen Ministerpräsidenten Giorgio Napolitano und bat um die Abschaltung seiner lebenserhaltenden Beatmungsgeräte sowie die Einstellung der künstlichen Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr. Der daraufhin vollzogene Behandlungsabbruch führte dazu, dass Welby an den Symptomen seiner irreversiblen Krankheit starb. Diese Maßnahme aber, die in vielen westlichen Staaten als Ausdruck des persönlichen Selbstbestimmungsrechtes des Patienten akzeptiert und rechtlich legitimiert ist, wurde seitens des Vikariats von Rom als intendierte Herbeiführung des Todes interpretiert und ein kirchliches Begräbnis verweigert. Aufgrund der breitgefächerten Kritik an der kirchlichen Handlungsweise19 erklärte das Vikariat von Rom, dass Welby seinen Sterbewunsch bis zuletzt öffentlich und unmissverständlich wiederholt habe. Anders als bei Suizidanten, bei denen das Fehlen des vollen Bewusstseins und der bewussten Zustimmung präsumiert werden könne, habe sich Welby bewusst der kirchlichen Lehre widersetzt, worin die rechtliche Grundlage der Begräbnisverweigerung zu sehen sei.20 Der damalige Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz Kardinal Camillo Ruini verteidigte die kirchliche Interpretation der Handlung und die rechtmäßige Konsequenz der Begräbnisverweigerung, weil unter diesen Umständen „eine andere Entscheidung für die Kirche unmöglich und widersprüchlich gewesen [wäre], denn das hätte eine Haltung legitimiert, die gegen das Gesetz Gottes gerichtet ist“21.
Das Vikariat von Rom wurde für seine Interpretation des Behandlungsabbruchs als bewusste und intendierte Herbeiführung des Todes stark kritisiert. Dieser sei keine „keine Euthanasie [gewesen], sondern eine Sterbebegleitung wie sie der Patient ausdrücklich gewollt hat.“22
Die angeführten Fallbeispiele verdeutlichen die Komplexität und Brisanz, die der Forschungsfrage der vorliegenden Studie zu eigen sind. Noch bevor der Seelsorger sich die Frage nach der Möglichkeit der Feier oder Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses stellen kann, muss er den konkreten Sachverhalt und die vollzogene medizinische Handlung am Lebensende wahrnehmen und analysieren. Dies erfordert von ihm eine Bewertung der medizinischen Handlung in der Hermeneutik des lehramtlich-normativen Maßstabs, dessen Horizont von bewusster Herbeiführung des Todes durch eine Handlung oder Unterlassung bis hin zur zulässigen palliativmedizinischen Sterbebegleitung zur Vermeidung überstrapazierender Lebensverlängerung reicht. Erschwert wird dieses Unterfangen durch die kircheneigene Terminologie zur Unterscheidung und sittlichen Beurteilung der medizinischen Handlungen am Lebensende, die sich durch divergierende Differenzierungskriterien von der in Politik und Gesellschaft gebräuchlichen Terminologie absetzt.
Bevor der Seelsorger also über den moralischen Gehalt einer medizinischen Handlung urteilen kann, muss er
- die vollzogene medizinische Intervention am Lebensende eines schwerkranken Patienten nach staatlich-medizinischen Kategorien wahrnehmen,
- dem staatlichen bzw. gesellschaftlichen Begriffs- und Beurteilungsraster entheben und
- in die kirchliche Terminologie, d. h. in den Deutungs- und Interpretationskontext des kirchlichen Lehramtes transferieren.
Erst mit diesem hermeneutischen Zugang kann die Evaluation des moralischen Gehalts der vollzogenen Handlung unter Beurteilung ihrer Natur und der Intention des einwilligenden Verstorbenen erfolgen und gelingen. Dieser Prozess muss zeitlich gesehen noch vor der Betrachtung und Anwendung der kanonischen Normen zur Begräbnisverweigerung geschehen. Erst wenn zweifellos sicher ist, dass die vollzogene Handlung in die Kategorie ethisch unzulässig einzustufen ist, kann der nächste Schritt im Entscheidungsprozess gegangen werden.
Wünschen die Angehörigen des Verstorbenen trotz verurteilenswürdiger Handlung im konkreten Fall die Feier eines kirchlichen Begräbnisses, dann wird das eingangs nachgezeichnete Spannungsverhältnis zwischen der abstrakten kirchlichen Lehre bezüglich bestimmter Handlungen am Lebensende und der gelebten Wirklichkeit im konkreten Sachverhalt deutlich. In Reaktion auf diese Diskrepanz muss der Seelsorger in der Ausübung seines pastoralen Dienstes zwar die kirchliche Lehre verkündigen, aber ebenso auf die konkreten Wünsche und Ängste der Gläubigen eingehen und eine der entsprechenden Situation angemessene Seelsorge gestalten.23 Die liturgische Begräbnisfeier dabei als Instrument zur Annahme der kirchlichen Lehre seitens der Gläubigen zweckzuentfremden, ist nicht zulässig und rechtswidrig. Mit Blick auf den kirchlichen Sendungsauftrag, das Recht des Verstorbenen auf ein kirchliches Begräbnis sowie das kirchliche Begräbnisrecht als solchem ist der Seelsorger im konkreten Sachverhalt gefordert, die kirchliche Lehre und sein pastorales Handeln in eine kongruente Verbindung zu bringen. Um die von Kardinal Schönborn angesprochenen Handlungsextreme Rigorismus oder Laxismus im Sinne einer ethisch, theologisch und rechtlich verantworteten pastoralen Handlungsweise zu vermeiden, bedarf der Seelsorger daher grundsätzlich fundierte Kenntnisse über
- die psychologischen Implikationen von schwerer, irreversibler Krankheit,
- die Lehre der Kirche bezüglich Euthanasie, der Anwendung therapeutischer schmerzlindernder Mittel sowie
- das theologische Proprium des kirchlichen Begräbnisses zur Abwägung der verschiedenen möglichen Feierformen und -gestalten.
Während diese Aspekte losgelöst vom konkreten Kontext betrachtet und eruiert werden können, steht der Seelsorger zusätzlich noch vor der Aufgabe, den sich ihm darbietenden Sachverhalt in seiner Gänze zu erfassen und zu formulieren.24 Vor allem die Formulierung des Sachverhalts stellt eine große Herausforderung dar, weil in ihr bereits theologische, rechtliche sowie humanwissenschaftliche Implikationen zum Ausdruck kommen, die für den Ausgang der Entscheidung von hoher Relevanz sind. Beispielsweise muss der Seelsorger nach der psychischen Verfassung des Verstorbenen und den Auswirkungen seiner schweren, unheilbaren Krankheit, der Angst vor einem qualvollen und einsamen Tod sowie der Erfahrung unerträglicher Schmerzen auf die Entscheidungsfreiheit fragen. Dafür muss er den lebens- und krankheitsgeschichtlichen Kontext des Verstorbenen kennen und vor dem Hintergrund der Erkenntnisse der Humanwissenschaften, vorzugsweise der Psychologie und Suizidologie, reflektieren. Zudem ist für die Gewissensbildung des Verstorbenen das staatliche Recht nicht unerheblich, da es dem Verstorbenen suggerieren könnte, entsprechende lebensverkürzende Handlungen, die von der Kirche verurteilt werden, seien ethisch vertretbar und könnten rechtmäßig angewandt werden. Erst in der Sichtung aller den Sachverhalt tangierenden Umstände und unter Beachtung der kirchlichen Rechtsprinzipien wie beispielsweise der Epikie und aequitas canonica kann eine sowohl der kirchlichen Lehre als auch dem Leben des Verstorbenen angemessene Entscheidung über Gewährung oder Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses getroffen werden.
Aus den vorgebrachten Überlegungen über die Anforderungen an den Seelsorger ergeben sich mit Blick auf die Forschungsfrage für eine ekklesiologischkanonistische Aufarbeitung der Thematik folgende Unterfragen: Mit welcher Terminologie arbeitet das kirchliche Lehramt und welche medizinischen Handlungen werden darunter subsumiert? Nach welchen Kriterien werden sie differenziert? Welche medizinischen Handlungen gelten als ethisch zulässig und welche nicht? Welche Bedeutung wird der Intention beigemessen, die mit dem Vollzug einer bestimmten Handlung verfolgt wird? Gibt es Interpretationshilfen für Seelsorger, über subjektiv empfundene und geformte Intentionen zu urteilen, um Rückschlüsse auf die subjektive Zurechenbarkeit einer Handlung zu ziehen?
Mit Blick auf die erbetene Sakramentalie des kirchlichen Begräbnisses und der theologisch-ekklesiologischen Relevanz ihrer Feier ist nachzugehen: Was bedeutet es theologisch wie ekklesiologisch, ein kirchliches Begräbnis für einen Verstorbenen zu feiern? Was ist sein theologisches Proprium und welchen Heilscharakter hat es inne? Was wird in seiner Feiergestalt und seinen essentiellen Elementen zum Ausdruck gebracht und gibt es mögliche Abstufungen der liturgischen Feiergestalt?
Ferner ist zu fragen, wie der kirchliche Gesetzgeber das kirchliche Begräbnis durch rechtliche Normen strukturiert hat: Wer hat ein Recht auf das kirchliche Begräbnis und wem kommt die Pflicht zu, dieses zu feiern? In welcher Beziehung stehen Recht und Pflicht und wie werden sie hergeleitet? Wie wird die Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses theologisch und rechtlich begründet und welche Auswirkungen hat das Reueempfinden des Verstorbenen? Ist ein Zeichen der Reue im Kontext von bewusster Herbeiführung des Todes oder des Sterbenlassens durch Behandlungsabbruch bzw. -verzicht überhaupt denkbar? Wie könnte ein solches Zeichen aussehen? Wem kommt die Pflicht zu, die Sündhaftigkeit der vollzogenen Handlung nachzuweisen?
Schließlich ist mit Blick auf die Anwendung des Rechts folgenden Fragen nachzugehen: Welche Relevanz kommt der psychischen Verfassung des schwerkranken Patienten zu? Kann dessen Freiheit derart eingeschränkt sein, dass die vollzogene Handlung oder Einwilligung in die Herbeiführung des Todes nicht subjektiv zurechenbar war? Welche Erkenntnisse aus dem Bereich der Humanwissenschaften, besonders der Psychologie und Suizidologie können für die Betrachtung und Bewertung der konkreten psychischen Situation des schwerkranken Patienten mit Blick auf dessen Willens-, Entscheidungs- und sogar Handlungsfreiheit fruchtbar gemacht werden? Können historisch gewachsene Erkenntnisse aus dem kirchlichen Umgang mit Suizidanten auf den zu hinterfragenden Sachverhalt appliziert werden? Arbeitet der Gesetzgeber auf Basis solcher humanwissenschaftlicher Erkenntnisse eventuell mit Präsumtionen, die von vollständigem oder eingeschränktem Vernunftgebrauch ausgehen, um auf diese Weise Rechtssicherheit und Handlungsfähigkeit zu generieren? Was ist zu tun, wenn Rechts- oder Tatsachenzweifel auftreten? Existiert diesbezüglich ein auf Tradition beruhender Kriterienkatalog für weiteres Vorgehen? Nach welchen Rechtsinstitutionen und -prinzipien kann in der Rechtsanwendung der göttlichen Barmherzigkeit Wirkungskraft verschafft werden? Sind Dissimulation, Dispens und Aequitas canonica zu berücksichtigende Rechtsmittel?
Diesen Fragen ist im Rahmen der vorliegenden Studie nachzugehen. Es kann durchaus sein, dass sie nicht vollständig oder nicht zufriedenstellend beantwortet werden, weil eine vollumfassende Antwort zuvor weiterer Forschungen in anderen Wissenschaftsbereichen bedarf.
1.2. Forschungsstand
Der Forschungsfrage einer möglichen Feier des kirchlichen Begräbnisses nach Vollzug von Euthanasie und ethisch unzulässigen medizinischen Handlungen am Lebensende wurden zuvor weder eine wissenschaftliche Monographie noch andere Publikationen gewidmet. Allenfalls fand die Thematik in der Kommentierung des kirchlichen Begräbnisrechts einen mehr oder weniger rudimentären Anriss. Der italienische Kanonist Adolfo Zambon beschrieb zumindest 2002 die Fragestellung eines kirchlichen Begräbnisses nach Euthanasie im Kontext eines Aufsatzes über schwierige pastorale Situationen, ging aber nicht detailliert auf die kontextuellen Rechte und Pflichten der Betroffenen bzw. Beteiligten, die Bedingungen des konkreten Sachverhalts sowie die theologischen, ekklesiologischen und psychologischen Implikationen der Rechtsanwendung ein.25 Ein Jahr zuvor stellte der amerikanische Kanonist Robert Barry die Frage, ob vernunftbegabten Suizidanten, die sich aus Protest gegen das Verbot der Selbsttötung, aus politischen Gründen oder aber zum Beweis der vom kirchlichen Lehramt unabhängigen moralischen Gültigkeit des Freitods selbst töteten, ein kirchliches Begräbnis zu gewähren oder verweigern ist. Explizit grenzte er seine Untersuchung von der Frage nach einem kirchlichen Begräbnis nach Suizid als Flucht vor schwerer Krankheit ab.26 Entfernt ist zudem auf die Arbeit des US-amerikanischen Kanonisten John B. Doherty zu verweisen, der 2002 die Rechtsanwendung des kanonischen Straftatbestandes der Tötung (homicidium) auf den Sachverhalt des Abbruchs bzw. Verzichts von künstlicher Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr hinterfragte, um die Kirche in ihrer Rolle als Schützerin des Lebens zu stärken. Dabei engte er den wissenschaftlichen Fokus vor allem auf jene Gläubigen ein, die dem Wunsch eines Patenten nach Behandlungsabbruch bzw. -verzicht nachkamen und umsetzten. Die kirchenrechtlichen Konsequenzen für jene aber, die den Wunsch nach Abbruch oder Verzicht künstlicher Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr äußerten und in die entsprechende Handlung bzw. Unterlassung einwilligten, wurden nicht reflektiert.27
Neben der existierenden Forschungslücke, die hinsichtlich der Fragestellung der deutsch- und fremdsprachigen Kanonistik zu attestieren ist, muss zudem darauf hingewiesen werden, dass auch auf Seiten der kirchlichen Autorität eine breite Reflexion der rechtlichen Konsequenzen von ethisch unzulässigen medizinischen Interventionen am Lebensende fehlt. Auf Ebene der Bischofskonferenz haben lediglich die niederländischen Bischöfe im Jahr 2005 dieser Thematik eine umfassende Handreichung zur pastoralen Sorge rund um die Bitte nach Euthanasie und Beihilfe zum Suizid28 gewidmet.29 Eine Analyse der pastoralen Handreichung mittels kanonistischer Methode ist bisher nicht erfolgt.30
Auch wenn die vorliegende kirchenrechtliche Studie mit der zugrunde liegenden Fragestellung in der Kanonistik wissenschaftliches „Neuland“ betreten hat, konnten Erkenntnisse, die für die Bearbeitung der Fragestellung notwendig sind, aus entsprechenden Studien zu terminologischen, medizinischen, moraltheologischen, lehramtlichen, liturgiewissenschaftlichen sowie kanonistischen Aspekten von Euthanasie, medizinischen Handlungen am Lebensende, der Situation von schwerkranken und sterbenden Patienten sowie des kirchlichen Begräbnisses gesichtet und rezipiert werden. Sowohl für die Bestimmung der vom Lehramt verwendeten Terminologie in Abgrenzung zu den in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft gängigen Begriffen31 als auch für die Analyse der kirchlichen Lehre über die Unantastbarkeit menschlichen Lebens und der Verurteilung von Euthanasie und anderer medizinischer Interventionen am Lebensende stehen Dokumente des kirchlichen Lehramts und eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien in Moraltheologie und Ethik32 zur Verfügung, auf die in angemessener Weise zurückgegriffen wurde.
Für die Reflexion von Theologie und Ekklesiologie des kirchlichen Begräbnisses konnten sowohl kirchliche Dokumente33 als auch liturgiewissenschaftliche Studien rezipiert werden.34 Der profunden Analyse des jeweils zeitgenössischen kirchlichen Umgangs mit Suizidanten vor allem mit Blick das kirchliche Begräbnisrecht und dessen Applikation halfen rechtsgeschichtliche Untersuchungen. Sie unterstützten die Differenzierung der vom jeweiligen Zeitgeist gefärbten theologischen wie rechtlichen Gründe für eine Begräbnisverweigerung, die Klärung des gewandelten theologischen wie ekklesiologischen Verständnisses des kirchlichen Begräbnisses mit Blick auf dessen eschatologische Implikationen als auch die Ursachenforschung der historisch bedingten Interpretationen einer freiheitlichen Entscheidung für Selbsttötung seitens der katholischen Kirche.35 Dadurch offenbarten sich erhebliche Differenzen zwischen der kirchlichen Gesetzgebung über Gewährung und Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses nach Selbsttötung und der Anwendung der rechtlichen Normen im konkreten Einzelfall. Die zur Hilfe genommenen Rechtsquellen wie Konzilstexte, Bußbücher und Rituale sowie die kanonistischen Kommentare wurden vorwiegend in Form von Sekundärliteratur und nicht als Primärliteratur verwendet, sofern dies nicht explizit angegeben ist.36 Diese Vorgehensweise erschließt sich vor dem Hintergrund, dass kein Quellenkommentar an sich oder eine historisch-kritische Einordnung hinsichtlich des jeweils zeitgenössischen theologischen wie rechtlichen Verständnisses intendiert war, sondern die historischen Quellen als hermeneutischen Schlüssel zur Interpretation heutiger theologischer Aussagen und rechtlicher Normen herangezogen wurden.
Für die Rechtsinterpretation des kodikarischen Begräbnisrechts, gegeben im Codex Iuris Canonici von 1917 (=CIC/1917) und Codex Iuris Canonici von 1983 (=CIC/1983), wurde auf einschlägige Kommentare37 sowie wissenschaftliche Publikationen38 zurückgegriffen. Für die Frage nach der subjektiven Zurechenbarkeit der Einwilligung in Euthanasie und andere medizinische Interventionen am Lebensende und der daraus womöglich folgenden subjektiven Schuld des Verstorbenen wurden neben medizinischer und moraltheologischer Fachliteratur über Freiheitsentscheidungen im Kontext von schwerer Krankheit39 auch quantitativ-empirische Studien der Suizidologie herangezogen und deren Erkenntnisse über die Situation der schweren Krankheit sowie implizierte Zwänge, Furcht und Ängste aufgegriffen, reflektiert und wissenschaftlich eingeordnet.40 Mit Blick auf die Applikation des Rechts, insbesondere auf die Rechtsmittel der Barmherzigkeit, Dispens, Dissimulation und aequitas canonica, die alle der Förderung des Seelenheiles (salus animarum) dienen, und hinsichtlich der Bedeutung der Formulierung des konkreten Sachverhalts und deren theologischen Implikationen fand sich eine breitgefächerte kirchenrechtliche Literatur.41
In Anbetracht der Tatsache, dass sich die vorliegende Studie einem Forschungsgebiet aus nahezu unbehandelter Perspektive nähert, kann es nicht Ziel der Arbeit sein, die Thematik vollumfassend und abschließend zu erschließen und alle offenen Fragen zu beantworten, sondern einen ersten, weitere Fragen und Forschungsbereiche aufwerfenden Beitrag zu leisten. Es gilt zunächst, theologische wie kanonistische Wissenschaft und kirchliche Praxis für die Komplexität der Problemstellung zu sensibilisieren, die Relevanz dieses Themenkomplexes zu begründen und beteiligte Personen sprach- und handlungsfähig zu machen. Es soll zudem deutlich werden, dass eine theologisch-ethisch und kirchenrechtlich verantwortbare Ausübung von pastoraler Seelsorge nach dem Vollzug von Euthanasie und anderen medizinischen Handlungen nur im Dialog sowohl der innertheologischen Disziplinen als auch mit den juristischen und humanwissenschaftlichen Wissenschaften gelingen kann.42
1.3. Methodik und Gliederung der Arbeit
Fragen im Bereich des Heiligungsdienstes (munus sanctificandi) bewegen die katholische Kirche in ihrem innersten Wesen, da sie sich selbst in ihrer vorrangigen Aufgabe als Vermittlerin des Heils im Auftrag Christi versteht. Damit sie aber als „Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ (LG 1) auch wahrgenommen und verstanden wird, ist sie selbst gefordert, bei den Menschen zu sein und für sie zu wirken, sowie ihre Probleme und Nöte zu kennen, um mit pastoraler Sorge angemessen darauf reagieren und die kirchliche Lehre adäquat verkündigen zu können. Kirche ist daher gefordert, sich den Zeichen, Problemen und Fragen der Zeit43 zu stellen und trotz eventueller Verfehlungen – vor allem in solch speziellen Situationen wie schwerer Krankheit im Angesicht des nahenden Sterbens – ihren Sendungsauftrag mit seelsorglichem Wirken zu füllen. Die grundsätzliche Herangehensweise an einen solchen problembeladenen Sachverhalt muss geprägt sein von einem Suchen und Verkünden der Wahrheit in Verbindung mit einer Hermeneutik der göttlichen Barmherzigkeit und der Sendung Jesu zu allen Menschen, auch den Sündern.
Dies erfordert für die vorliegende Studie zunächst einen anthropologischen Zugang, der den aufgrund von Euthanasie oder anderen ethisch unzulässigen Handlungen verstorbenen schwerkranken Gläubigen mit seiner ganz konkreten krankheitsbedingten lebensgeschichtlichen Situation sowie dessen Angehörige mit ihrer Trauer und der Verarbeitung ihres Verlustes in den Mittelpunkt rückt und der Frage nachgeht, wie für diese angemessen Seelsorge zu gestalten ist. Ferner bedarf es eines lösungsorientierten Ansatzes, mit dem die in der Praxis auftretenden Probleme wahrgenommen, zur sachlichen Analyse ihres speziellen Kontextes abstrahiert, alle zu ihrer Klärung notwendigen Aspekte reflektiert und im Sinne einer synthetischen Zusammenschau zu einem Ergebnis bzw. zu einer Lösung zusammengebracht werden. Für diese Ausrichtung der vorliegenden Studie bedarf es einer kanonistischen Methodik, die die Erkenntnisse aus Theologie, Moraltheologie und Psychologie sowohl für die Interpretation als auch für die Anwendung des Rechts aufbereitet und als dessen Hermeneutik versteht. Eine ausschließliche Interpretation der Gesetze würde der Komplexität und Brisanz der Fragestellung nicht im Ansatz gerecht werden und erscheint daher als unzureichend. Die grundsätzlich offen formulierte Fragestellung erlaubt dabei ein ergebnisoffenes wissenschaftliches Arbeiten, wodurch der Druck, ein im Vorfeld gesetztes Ziel erreichen zu müssen, vermieden wurde.
Dennoch erhält die ergebnisoffene Herangehensweise durch das dem Verfasser eigene Verständnis des kirchlichen Rechts als Instrument der kirchlichen Autorität zur Förderung des Seelenheils, der Verkündigung der christlichen Botschaft und der kirchlichen Sendung einen ersten Perspektivfilter. Als theologisch-praktische Disziplin muss vor allem in der Anwendung des Rechts die Transferleistung zur Umsetzung von theoretischen Konzepten und Ansätzen zur Seelsorgeausübung in eine mit dem Glauben und der Lehre der Kirche zu vereinbarende Praxis und eine angemessene pastorale Gestalt zum Tragen kommen. Ein zweiter Perspektivfilter liegt in dem Verständnis, dass kirchenrechtliche Normen oftmals der Übersetzung theologischdoktrineller Erkenntnisse und Einsichten in die Rechtssprache dienen und deswegen auch in deren Licht interpretiert und angewendet werden müssen.44 Während die Theologie durch kontinuierliche Reflexion versucht, den Glauben zu verstehen (fides quaerens intellectum), intendiert das kirchliche Recht, der Gemeinschaft eine Struktur und Ordnung zu geben, damit diese gemäß der theologischen Erkenntnisse leben und handeln kann (fides quaerens actionem).45 Inhalt der theologischen Reflexion und später der rechtlich-strukturellen Umsetzung sind jene Güter, die seitens der Kirche für das Wachsen in Gottes Gnade, den Aufbau des Reiches Gottes auf Erden und letztlich für das Heil der Seele als gut und wertvoll erachtet werden.46 Da die Werte gewissermaßen auch die Ziele kirchlichen Handelns gemäß ihrem eigenen heilsmittlerischen Auftrag darstellen, schafft die Kirche mithilfe der rechtlichen Normen Strukturen, um die Erlösung des Menschen zu unterstützen.47 Die wissenschaftliche Theologie als reflektierende Akquise von Erkenntnissen über den Glauben, das kirchliche Recht als Gewährleistung eines Lebens gemäß dieser Einsichten verstehend, existiert zwischen Theologie und kirchlichem Recht ein enges organisches Verhältnis, sodass theologische Änderung entsprechende rechtliche Reformen bedingen.48 Das hier angedeutete Verständnis des Verhältnisses zwischen Theologie und kanonischem Recht, respektive der Lehren des II. Vatikanischen Konzils und des Codex Iuris Canonici von 1983 drückte Papst Johannes Paul II. (1920-2005, Papst: 1978-2005) in der Apostolischen Konstitution Sacrae disciplinae leges zur Promulgation des überarbeiteten CIC/1983 folgendermaßen aus. Der Codex müsse als „großes Bemühen aufgefaßt werden, eben diese Lehre, nämlich die konziliare Ekklesiologie, in die kanonische Sprache zu übersetzen.“49
Für die vorliegende Studie bedeutet dies beispielsweise, dass die Frage nach dem Recht auf ein kirchliches Begräbnis und dessen Verweigerung nicht allein im Licht der kirchlichen Normen beantwortet werden kann und darf. Sowohl das Recht auf das kirchliche Begräbnis als auch dessen Verweigerung sind nicht primär juridische, sondern theologische Sachverhalte, die der Gesetzgeber rezipiert und mit Normen ausgestaltet hat: Getaufte haben ein Recht auf ein kirchliches Begräbnis aufgrund ihrer Taufe, lediglich die rechtlichen Konsequenzen der Taufe hat der kirchliche Gesetzgeber normiert; die Begräbnisverweigerung ist die rechtlich normierte Konsequenz einer verborgenen theologisch-ekklesiologischen Spannung zwischen dem Vollzug einer objektiv wahrzunehmenden und subjektiv zurechenbaren sündhaften Handlung einerseits und dem Vollzug einer liturgischen Feier andererseits, in der die volle Gemeinschaft des Individuums mit Gott und der Kirche erneuert und vergegenwärtigt werden soll.
Daher erfordert die ausgewählte Methodik, die Komplexität der theologischen Problematik, die im Vollzug von Euthanasie und anderen, den Tod herbeiführenden medizinischen Handlungen für schwerkranke Menschen und der zeitgleich geäußerten Bitte um die Feier eines kirchlichen Begräbnisses begründet liegt, mit ihren Eigenheiten und Spezifika zu erfassen und die für die Fragestellung bedeutsamen Aspekte für die wissenschaftliche Reflexion zu sondieren. Diese wurden in der
- konkreten Situation schwerkranker Menschen mit ihren psychologischen Implikationen,
- im kirchlich-lehramtlichen Verständnis von Euthanasie und anderen medizinischen Handlungen am Lebensende sowie
- der theologisch-liturgischen Deutung des kirchlichen Begräbnisses
ausgemacht. Da sie die Grundlage für die anschließende Interpretation des kirchlichen Rechts bilden, bedarf es zu ihrer detaillierten Betrachtung lediglich einer deskriptiv-kritischen Methode, die die Thematik darstellt, ihre Problemfelder aufzeigt und eventuelle Erkenntnisse für die nachfolgende Rechtsinterpretation aufbereitet.
Im Rahmen dieser Rechtsinterpretation wurde zunächst mittels einer chronologisch-historischen Vorgehensweise eruiert, welche Erkenntnisse aus der Rechtstradition und der kirchlicher Historie als Interpretationszugänge und -kontexte verwendet werden können, um die derzeit geltenden Normen und deren Genese besser zu verstehen und ihre derzeitige Konzeption gegebenenfalls zu kritisieren. Anschließend wird zur Interpretation des kodikarischen Rechts eine systematisch-deduktive Methode verwendet, die einerseits Recht und Pflicht zur Feier des kirchlichen Begräbnisses im Horizont von Recht auf Empfang und Pflicht zu Spendung der geistlichen Güter der Kirche betrachtet, andererseits zunächst die allgemeinen Normen der Begräbnisverweigerung dargestellt, bevor abschließend auf die konkrete Fragestellung eingegangen wird.
Innerhalb der Conclusio wird mit Blick auf die Rechtsanwendung die Formulierung des konkreten Sachverhalts und deren Relevanz stark gemacht, da in ihr bereits theologische wie rechtliche Implikationen zum Tragen kommen, die den Entscheidungsfindungsprozess des Seelsorgers entschieden beeinflussen können.
Aus den Ausführungen zur Methodik erschließt sich eine Gliederung der Studie in insgesamt drei Hauptkapitel mit einer zusammenfassenden und ausblickenden Conclusio:
Im ersten Kapitel wird die Terminologie erarbeitet. Um Missverständnissen vorzubeugen und Verwirrungen über die thematisierten medizinischen Handlungen zu vermeiden, wird die Terminologie der Begriffe Euthanasie und Sterbehilfe vor dem Hintergrund ihrer historischen Genese dargestellt (2.1.) und um eine Betrachtung der verschiedenen sprachlichen Konzepte zur Bezeichnung der unterschiedlichen Handlungen in Politik, Gesellschaft und Kirche ergänzt (2.2.). Abschließend wird auf die vom Seelsorger geforderte terminologische Transferleistung eingegangen, die als Voraussetzung für eine ethische Beurteilung der vollzogenen Handlung gilt (2.3.).
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Aspekten der theologischen Spannung der Forschungsfrage. In einem ersten Schritt wird die Situation von schwer- und unheilbarkranken Menschen im Kontext moderner Medizin betrachtet. Die stetig zunehmende Konfrontation mit der Erfahrung und den Konsequenzen von hohem Alter sowie physischem und psychischem Abbau wird ebenso thematisiert (3.1.). Mit Blick auf die geforderte Entscheidung seitens des Individuums werden der Fokus auf die psychologischen Implikationen schwerer Krankheit gelegt und die Konsequenzen für eine freiverantwortliche Entscheidung erforscht (3.2.). In einem zweiten Schritt wird die ethische Beurteilung der verschiedenen medizinischen Handlungen am Lebensende durch das kirchliche Lehramt in den Fokus der Betrachtung gestellt. Dabei wird zunächst auf die historische Verurteilung der Selbsttötung eingegangen, weil dieselben Argumente als normativer Maßstab zur Bewertung von Euthanasie und anderen medizinischen Handlungen am Lebensende herangezogen werden (4.1.). Daraufhin folgt die Darstellung der Beurteilung von Euthanasie und Anwendung therapeutischer und schmerzlindernder Mittel durch das kirchliche Lehramt und der dafür anzuwendenden Kriterien (4.2.). In einem dritten Schritt wird die Theologie der kirchlichen Begräbnisliturgie unter Einbezug der historischen Entwicklung und jeweiligen zeitgenössischen Auffassungen des theologisch-eschatologischen Gehalts und der liturgischen Ausrichtung des kirchlichen Begräbnisses erforscht (5.1.). Ausführlich wird auf die postkonziliare Begräbnisliturgie im Licht der vom II. Vatikanum geforderten Aufwertung des österlichen Charakters und ihre ekklesiologischen Implikationen eingegangen (5.2.). Jeweils am Ende eines Unterpunktes wird die Relevanz des Erarbeiteten für die Fragestellung und die folgende Rechtsinterpretation aufgezeigt (3.3., 4.3., 5.3.).
Das dritte Kapitel widmet sich dem kirchlichen Begräbnisrecht in Geschichte und Gegenwart. Dabei wird ein besonderer Fokus auf das Recht der Gläubigen auf ein kirchliches Begräbnis sowie die Pflicht der Kirche zur Feier desselben gelegt, da der Seelsorger in dieses reziproke System von Rechten und Pflichten eingebunden ist. In einem ersten Schritt wird ein historischer Überblick über die theologische Begründung der Begräbnisverweigerung nach Selbsttötung (6.1.) sowie ihre Übersetzung in kirchenrechtliche Normen gegeben (6.2.). Die sich anschließende Betrachtung des kirchlichen Begräbnisrechts auf Basis des CIC/1917 (7.) als auch des CIC/1983 (8.) folgt grundlegend dem gleichen systematischen Aufbau.50 Nach einleitenden Worten zu Terminologie und Rechtssystematik (7.1., 8.1.) folgt die Reflexion des Rechts der Gläubigen auf ein kirchliches Begräbnis sowie der Pflicht der Seelsorger, dieses zu feiern (7.2., 8.2.). Erst danach schließt sich die Interpretation der Normen für die Begräbnisverweigerung an (7.3.1., 8.3.). Mit Blick auf das Begräbnisrecht des CIC/1917 schließt sich noch die Betrachtung der Spezialnormen zur Begräbnisverweigerung für Suizidanten an (7.3.2.). Die entsprechenden Unterpunkte werden mit einem Fazit (6.3., 7.4., 8.4.) abgeschlossen, in dem die für die Conclusio wichtigsten Aspekte zusammengefasst werden.
In der Conclusio werden die erarbeiteten Ergebnisse zusammengetragen und mit Betonung auf die Relevanz der Formulierung des Sachverhalts Wege zur Beantwortung der Fragestellung sowie offene Fragen aufgezeigt. Vor diesem Hintergrund soll die pastorale Handreichung der niederländischen Bischöfe (2005) als mögliches Modell für Normen zur Strukturierung von seelsorglichem Handeln im Kontext von Euthanasie betrachtet werden (10.).
1.4. Eingrenzung der Thematik
Zum adäquaten Verständnis der vorliegenden kanonistischen Studie mit Sichtung und Wertung der (moral-)theologischen, liturgischen und humanwissenschaftlichen Implikationen ist als erste Eingrenzung der Thematik klar herauszustellen, dass weder eine ethische Bewertung von Euthanasie und der medizinischen Handlungen am Lebensende selbst, die die Herbeiführung des Todes intendieren und diese ersuchen, noch ein Plädoyer für oder gegen ihre staatliche Legalisierung oder ihr Verbot vorgesehen ist. Die verschiedenen ethischen Argumente der entsprechenden Positionen oder die Gefahren eines Dammbruches (slippery-slope) werden nicht thematisiert.51 Es muss klar sein, dass der Entscheidungsfindungsprozess sowie die Möglichkeiten und Grenzen des pastoralen Handelns des Seelsorgers vor Ort Inhalt der Studie sind. Dieser nämlich ist den kirchenrechtlichen Normen verpflichtet und gefordert, auch dann seinen seelsorglichen Dienst auszuüben, wenn Menschen ihr Leben nicht an den kirchlichen Vorstellungen orientieren und diesen sogar zuwiderhandeln.
Ferner enthält die vorliegende Studie keine Evaluierung der rechtlichen Normen, mit denen die einzelnen Staaten Handlungen wie Euthanasie, (ärztlich) assistierten Suizid oder das Sterben zulassende (medizinische) Vollzüge legalisiert oder verboten haben. Diese staatlichen Gesetze werden nur in dem Maß berücksichtigt, wie sie die Gewissensbildung der Gläubigen, die um entsprechende Handlungen bitten und sich dafür entscheiden, beeinflussen können. Darin ist eine zweite Eingrenzung der Materie zu sehen.
Die Frage nach der Feier der kirchlichen Exequien nach Herbeiführung des Todes wurde bewusst von der Frage nach der Feier der Kranken- und Sterbesakramente abgegrenzt, da im Fall der Sakramentenspendung zunächst geklärt werden muss, ob die Intention, eine schwere Sünde zu begehen, denselben schwer sündhaften Charakter besitzt, wie die bewusst gewollte Handlung selbst. Erst wenn dies geklärt wäre, muss sich der Kirchenrechtler und Rechtsanwender die Frage stellen, ob die Krankensalbung, das Viatikum – das eigentliche Sterbesakrament der katholischen Kirche – und das Bußsakrament bei geäußertem Wunsch nach Euthanasie und assistiertem Suizid gespendet oder verweigert werden können, dürfen oder müssen. Diese dritte Eingrenzung wird erst in der Conclusio wieder aufgegriffen.
Die letzte und damit vierte Eingrenzung ist in der Reduzierung des Untersuchungsgegenstandes zu sehen. In der Studie wird nicht explizit auf den (ärztlich) assistierten Suizid eingegangen, da dieser eine Mischform von Tötung auf Verlangen und Suizid darstellt. Einerseits bedarf es für diese Art der Herbeiführung des Todes ähnlich der Euthanasieverrichtung einer längeren Planung, sodass mit Blick auf die Freiheitsfrage ein ähnlicher Kriterienkatalog zur Eruierung der Zurechenbarkeit nötig ist, andererseits bleibt der Suizid nach Bereitstellung der Medikamente z. B. durch den Arzt auch ohne Einwirken von außen und ohne Zeugen eine vom Verstorbenen selbst vollzogene Handlung.
1 http://www.kath.net/news/35938 (Zugriff: 14.07.2015).
2 Unter dem Begriff Seelsorger werden in der vorliegenden Studie sowohl Frauen als auch Männer verstanden, die qua Kirchenamt, bischöflicher Beauftragung oder Empfang des Weihesakramentes mit der Ausübung von Seelsorge beauftragt sind. Der Begriff Priester wird dann verwendet, wenn seelsorgliche Tätigkeiten thematisiert werden, die den Empfang der Priesterweihe voraussetzen (z. B. die Begräbnismesse). Die weibliche Form ist nicht inkludiert. Gleiches gilt für das Kirchenamt des Pfarrers oder Ortsbischofs. Die Begriffe verstorbener Gläubiger oder getaufter Verstorbener werden stellvertretend für weibliche wie männliche katholisch getaufte Verstorbene verwendet.
3 Als Beispiel für solche Lebenssituationen, die die Kirche damals als „unheil“ betrachtete und in denen das Ringen der Seelsorger um das pastoral angemessene Handeln sichtbar wurde, benannte Kardinal Schönborn die unverheiratet Zusammenlebenden, die wiederverheirateten Geschiedenen und die in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft Lebenden. [Vgl. ebd.]
4 Beispielhaft sei an dieser Stelle auf die aktuelle Debatte in Kanada und in der Schweiz verwiesen. Im Kontext von Bestrebungen der kanadischen Regierung, ärztlich assistierten Suizid zu legalisieren, äußerte sich der Erzbischof von Ottawa Terence Prendergast dass „Personen, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen, […] keine Sterbesakramente gespendet werden“ [http://www.kath.net/news/54228 (Zugriff: 31.05.2017).] dürfen. Zur Debatte in Kanada siehe http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/Kanada-legalisiert-Sterbehilfe/story/22754358 (Zugriff: 08.03.2017); http://www.theglobeandmail.com/news/national/canadas-largest-catholicarchdiocese-mobilizing-against-assisted-dying-law/article29045004/ (Zugriff: 08.06.2017); https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=27616 (Zugriff: 08.06.2017). Siehe dazu auch die Aussagen des Bischofs von Chur in der Schweiz Vitus Huonder, Humanes Sterben aus der Sicht des Glaubens. Wort zum Tag der Menschenrechte 10. Dezember 2016 (Wort des Bischofs XIII), in: http://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2016/12/Tag-der-Menschenrechte-2016-def-160817.pdf (Zugriff: 20.04.2017).
5 Die Tatsache, dass politische Debatten über besondere Sterbehilfegesetze nach dem europäischen Raum jetzt auch vermehrt im amerikanischen Kontext anzutreffen sind, zeigt die globale Entwicklung der Fragestellung nach einem selbstbestimmten Sterben. [Vgl. http://colombiareports.com/colombia-regulates-euthanasia-in-spite-of-church-objections/ (Zugriff: 13.07.2015); http://panampost.com/sabrina-martin/2015/04/23/colombian-physicians-get-the-final-go-ahead-for-euthanasia/ (Zugriff: 13.07.2015).] Dass die Thematik aber auch in die verschiedenen Gesellschaftsschichten vorgedrungen ist und dort analysiert und debattiert wird, belegen vor allem die populärwissenschaftlichen Publikationen zum Thema Sterben und Tod, deren Anzahl allein in Deutschland in den vergangenen Jahren signifikant gestiegen ist. [Vgl. in Auswahl: R. Spaemann/G. Hohendorf u.a. (Hg.), Vom guten Sterben. Warum es keinen assistierten Suizid geben darf. Mit einem Vorwort von Manfred Lütz, Freiburg/Br. 2015; R. Beckmann/C. Kaminski u.a. (Hg.), Es gibt kein gutes Töten. Acht Plädoyers gegen Sterbehilfe (Edition Sonderwege), Leipzig 2015; M. Stöhr, Selbstbestimmt Leben – Selbstbestimmt Sterben. Plädoyer für eine Legalisierung der Sterbehilfe, Aachen 2015; G. D. Borasio, Selbst bestimmt sterben. Was es bedeutet. Was uns daran hindert. Wie wir es erreichen können, München 2014; U.-C. Arnold, Letzte Hilfe. Ein Plädoyer für das selbstbestimmte Sterben, Reinbek 2014; G. v. Loenen, Das ist doch kein Leben mehr! Warum aktive Sterbehilfe zu Fremdbestimmung führt, Frankfurt/Main 2014; G. D. Borasio, Über das Sterben. Was wir wissen, was wir tun können, wie wir uns darauf einstellen, München 102012; M. de Ridder, Wie wollen wir sterben? Ein ärztliches Plädoyer für eine Sterbekultur in Zeiten der Hochleistungsmedizin, München 2011.]
6 Vgl. Die deutschen Bischöfe, Unsere Sorge um die Toten und die Hinterbliebenen. Bestattungskultur und Begleitung von Trauernden aus christlicher Sicht (22.11.1994) (DB 53), Bonn 42000, 13.
7 Vgl. G. Göckenjan, Sterben in unserer Gesellschaft – Ideale und Wirklichkeiten, in: APuZ 4 (2008) 7-14, 9-10.
8 Der Palliativmediziner Gian Domenico Borasio spricht von einem „Allmachtsgefühl in der Medizin“ [Borasio, Über das Sterben, 27.].
9 M. Frieß, Sterbehilfe. Zur theologischen Akzeptanz von assistiertem Suizid und aktiver Sterbehilfe, Stuttgart 2010, 7.
10 D. Fenner, Suizid – Krankheitssymptom oder Signatur der Freiheit? Eine medizinische Untersuchung (Angewandte Ethik 8), München 2008, 8.
11 Vgl. dazu M. Zimmermann-Acklin, Euthanasie. Eine theologisch-ethische Untersuchung (SThE 79), Freiburg/Schweiz 22002, 72. Eine entsprechende Diskussion innerhalb der Ärzteschaft lässt sich auch aufgrund der medialen Verbreitung verfolgen. [Vgl. http://www.tagesspiegel.de/wissen/ethikrat-aerztewollen-klarheit-bei-sterbehilfe/7189376.html (Zugriff: 09.03.2016).] Die Gefahr der Unklarheit bzw. Unschärfe rechtlicher Bestimmungen liegt darin, dass Ärzte in ihrem Wirken dem Wunsch des Patienten nach z. B. Behandlungsabbruch oder -verzicht aufgrund von Angst, eine Straftat zu begehen, nicht nachkommen und somit das Recht auf Selbstbestimmung versehentlich missachten.
12 Wohl aber ist es Aufgabe des Moraltheologen, auf Gefahren von Missbrauch hinzuweisen, entsprechende Tendenzen zu problematisieren und aufzuzeigen, was passiert, wenn beispielsweise „die aktive Sterbehilfe aus dem unmittelbaren Zusammenhang mit dem erleichterten Sterbeprozess heraustritt (nach juristischer Definition ist nur hier ihr eigentlicher Ort) und zur therapeutischen Option bei allen möglichen schweren Lasten durch physische und psychische Leiden innerhalb und außerhalb des eigentlichen Sterbeprozesses mutiert.“ [J. Römelt, Menschenwürdiges Sterben. Vom menschlichen Umgang mit dem verlangsamten Tod, in: HerKorr 58 (2004) 524-529, 526-527.]
13 Vgl. http://www.kath.net/news/35938 (Zugriff: 14.07.2015).
14 Vgl. http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20020205/teksten/bin.zelf.toos.timmermans.html (Zugriff: 06.05.2015).
15 Vgl. http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2779461/2002/02/19/Uitvaart-na-euthanasie-familie-zegt-gesprek-met-bisschop-af.dhtml (Zugriff: 23.04.2013); http://vorige.nrc.nl/krant/article1580975.ece (Zugriff: 06.05.2015).
16 Vgl. http://religionv1.orf.at/projekt02/news/0202/ne020220_niederlande_fr.htm (Zugriff: 23.04.2013).
17 Ebd.
18 Vgl. http://www.rp-online.de/leben/gesundheit/medizin/aufsehenerregende-sterbehilfe-faelle-bid-1.2105329 (Zugriff: 06.05.2015); http://www.thetablet.co.uk/article/9164 (Zugriff: 23.04.2013); http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/euthanasie-piergiorgio-welby-hat-sein-ziel-erreicht-1381463.html (Zugriff: 23.04.2013).
19 Vgl. http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/sterbehilfe-in-italien-katholische-kirche-verweigertbeerdigung-fuer-welby-a-456392.html (Zugriff: 16.07.2015); http://www.n-tv.de/panorama/Kircheverweigert-Beerdigung-article205441.html (Zugriff: 09.03.2016); http://www.independent.com.mt/articles/2007-01-11/letters/euthanasia-and-piergiorgio-welby-167463/ (Zugriff: 09.03.2016); http://www.lifenews.com/2009/02/12/bio-2747/ (Zugriff: 09.03.2016).
20 Vgl. „In merito alla richiesta di esequie ecclesiastiche per il defunto Dott. Piergiorgio Welby, il Vicariato di Roma precisa di non aver potuto concedere tali esequie perché, a differenza dai casi di suicidio nei quali si presume la mancanza delle condizioni di piena avvertenza e deliberato consenso, era nota, in quanto ripetutamente e pubblicamente affermata, la volontà del Dott. Welby di porre fine alla propria vita, ciò che contrasta con la dottrina cattolica (vedi il Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 2276-2283; 2324-2325). Non vengono meno però la preghiera della Chiesa per l’eterna salvezza del defunto e la partecipazione al dolore dei congiunti.“ [http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=1655&keywords=vicariato (Zugriff: 13.07.2015).]
21 http://www.zenit.org/de/articles/kardinal-camillo-ruini-zum-fall-welby (Zugriff: 13.07.2015). Ähnlich äußerte sich der damalige Vorsitzende der schweizerischen Bischofskonferenz und ehemalige Bischof von Basel Kurt Koch, dass die Gewährung eines kirchlichen Begräbnisses „das eindeutige Zeugnis der Kirche gefährdet [hätte], dass aktive Sterbehilfe in keinem Fall mit dem christlichen Glauben vereinbart werden kann.“ [http://de.radiovaticana.va/storico/2007/01/18/schweiz__fall_welby_eine_schwerwiegende_g%C3%BCterabw%C3%A4gung/ted-380946 (Zugriff: 16.04.2016).]
22 Vgl. http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/sterbehilfe-in-italien-katholische-kirche-verweigertbeerdigung-fuer-welby-a-456392.html (Zugriff: 16.07.2015).
23 Der Seelsorger muss in fundamentaler Weise bedenken, welche pastoralen Folgen mitunter durch die Begräbnisverweigerung für die Hinterbliebenen entstehen können: „Die Verweigerung der kirchlichen Bestattung stellt im Grunde auch eine Verweigerung des Fürbittgebetes und der Verkündigung der tröstenden und aufrichtenden Botschaft von Jesu Tod und Auferstehung dar. Darum betrifft eine solche Verweigerung nicht nur den Verstorbenen, sondern auch seine Angehörigen, die Mitchristen einer Gemeinde sowie die Öffentlichkeit von Kirche und Gesellschaft.“ [Die deutschen Bischöfe, Tote begraben und Trauernde trösten. Bestattungskultur im Wandel aus katholischer Sicht (DB 81), Bonn 2005, 44.]
24 Für die Beurteilung von Situationen, in denen Gläubige als wiederverheiratete Geschiedene zusammenleben, fordert beispielsweise Kardinal Walter Kasper „jede einzelne Situation verständnisvoll, diskret und taktvoll zu prüfen“ [W. Kasper, Nochmals: Die Zulassung von wiederverheiratet Geschiedenen zu den Sakramenten? Ein dorniges und komplexes Problem, in: StZ 233 (2015) 435-445, 441.] Es könne niemals eine allgemeine Lösung solch pastoraler Probleme geben, sondern nur Einzellösungen, da nicht von der „objektiven Situation der Sünde“ gesprochen werden könne, „ohne die Situation des Sünders in seiner je einmaligen personalen Würde zu bedenken.“ [Ebd.]
25 Vgl. A. Zambon, La celebrazione delle esequie in alcune situazioni particolari, in: Quaderni di diritto ecclesiale 15 (2002) 275-291. Dass Zambon in seinen Ausführungen den Sachverhalt des Euthanasiewunsches nicht separat, sondern in Ableitung und inhaltlicher Verbindung zum Suizidgesuch behandelt hat, ist als Defizit zu werten.
26 Vgl. R. Barry, Should the Catholic Church Give Christian Burial to Rational Suicides, in: Ang. 74 (2001) 513-550, 515.
27 Vgl. J. B. Doherty, The Withdrawal of Assisted Nutrition and Hydration and the Canonical Offence of Homicide (Canadian theses on microfiche), Ottawa 2002, 10.
28 Vgl. De Bischoppen van Nederland, Pastoraat rond het verzoek om euthanasie of hulp bij suïcide. Handreiking voor studie en bezinning, Utrecht 2005.
29 Das 2016 von der kanadischen Bischofskonferenz veröffentlichte Pastorale Statement für die Katholiken von Canada über den Report der Special Joint Committee of the Government of Canada mit dem Titel Medical Assistance in Dying: A Patient-Centred Approach kann nicht als eine solche Handreichung gewertet werden. [Vgl. Canadian Conference of Catholic Bishops, Pastoral Statement for the Catholics of Canada on the report issued by the Special Joint Committee of the Government of Canada, entitled Medical Assistance in Dying: A Patient-Centred Approach, in: http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Pastoral_statement_on_report_of_the_Special_Joint_Committee_-_EN.pdf (Zugriff: 10.03.2017).] Jedoch sind bereits seit Anfang des Jahres 2015 seitens der kanadischen Bischöfe gewisse Aktivitäten in der Behandlung der Thematik zu erkennen. Diese Bemühungen verblieben aber bis dato formal betrachtet vorwiegend auf der Diözesanebene. [Vgl. Atlantic Episcopal Assembly, A Pastoral Reflection on Medical Assistance in Dying, in: http://www.catholicregister.org/digital/2016/121116/Atlantic-euthanasia/Atlantic-assisted-dying (Zugriff: 20.04.2017) und in The Catholic Bishops of Alberta and the Northwest Territories, Guidelines for the Celebration of the Sacraments with Persons and Families Considering or Opting for Death by Assisted Suicide or Euthanasia: A Vademecum for Priests and Parishes, in: https://archgm.ca/wp-content/uploads/2016/10/2016-09-14_SacramentalPracticeinSituationsofEuthanasia.pdf?9910a6 (Zugriff: 20.04.2017).] Aufgrund ihres dezentralen Charakters werden die hier angegebenen Richtlinien in der vorliegenden Arbeit nicht dargestellt und kommentiert.
30 Eine rudimentäre kanonistische Reflexion kann in der beginnenden Debatte über die vom Erzbischof von Ottawa Terrence T. Prendergast geforderte Verweigerung der Krankensalbung, des Viatikums und des Bußsakramentes vor dem Vollzug von Euthanasie gesehen werden. [Vgl. R. Fastiggi, Euthanasia and the Anointing of the Sick. As Physician-Assisted Suicide Becomes more Pervasive, Priests Find themselves in a Pastoral Dilemma, in: https://www.osv.com/OSVNewsweekly/Article/TabId/535/ArtMID/13567/ArticleID/19411/Euthanasia-and-the-anointing-of-the-sick.aspx (Zugriff: 10.05.2017); http://www.kath.net/news/54228 (Zugriff: 31.05.2017); http://catholicherald.co.uk/news/2016/02/26/no-last-rites-for-catholics-who-seek-assisted-suicide-says-archbishop/ (Zugriff: 10.03.2016).]
31 Die Literatur zu Euthanasie und anderen medizinischen Handlungen am Lebensende sowie zur Terminologie konnte nur in stark reduzierter Auswahl in der vorliegenden Studie berücksichtigt werden. Standardwerke aus dem humanwissenschaftlichen, staatlich-rechtlichen und (moral-)theologischen Bereich sind M. Frieß, ‚Komm süßer Tod’ – Europa auf dem Weg zur Euthanasie? Zur theologischen Akzeptanz von assistiertem Suizid und aktiver Sterbehilfe (Forum Systematik 32), Stuttgart 2008; K. Feldmann, Sterben in der modernen Gesellschaft, in: G. D. Borasio/F.-J. Bormann (Hg.), Sterben. Dimensionen eines anthropologischen Grundphänomens, Berlin 2012, 23-40; M. Hoffmann, Sterben? Am liebsten plötzlich und unerwartet. Die Angst vor dem „sozialen Sterben“, Wiesbaden 2011; F. S. Oduncu, In Würde sterben. Medizinische, ethische und rechtliche Aspekte der Sterbehilfe, Sterbebegleitung und Patientenverfügung, Göttingen 2007; U. Benzenhöfer, Der gute Tod? Geschichte der Euthanasie und Sterbehilfe, Göttingen 2009; Zimmermann-Acklin, Euthanasie; I. Hillebrand, Ethische Aspekte der Sterbehilfe, in: Ders./C. Grimm, Sterbehilfe. Rechtliche und ethische Aspekte (Ethik in den Biowissenschaften – Sachstandsberichte des DRZE 8), Freiburg/Br. 2009, 85-167; C. Grimm, Rechtliche Aspekte der Sterbehilfe, in: Ders./I. Hillebrand, Sterbehilfe. Rechtliche und ethische Aspekte (Ethik in den Biowissenschaften – Sachstandsberichte des DRZE 8), Freiburg/Br. 2009, 13-84; B. Häcker, Die ethischen Probleme der Sterbehilfe. Eine kritische Analyse (Philosophie im Kontext 5), Hamburg 2008; J. Römelt, Dem Sterben einen Sinn geben. Ein theologischer Kommentar zur gegenwärtigen Debatte um Sterbehilfe und Sterbebegleitung (Zukunftsforum Politik 80), Sankt Augustin 2006; M. Fuchs, Sterbehilfe und selbstbestimmtes Sterben. Zur Diskussion in Mittel- und Westeuropa, den USA und Australien (Zukunftsforum Politik 79), Sankt Augustin 2006.
32 Vgl. J. Römelt, Ethik der Sterbebegleitung. Zwischen der Unverfügbarkeit des Lebens, dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen und der zwischenmenschlichen Solidarität, in: Ethica 21 (2013) 195-220; M. Bender, Verhältnismäßigkeit in der modernen Medizin. Von den außergewöhnlichen Mitteln zur Behandlungsqualität als personaler Abwägung (EThSt 109), Erfurt 2016; Römelt, Menschenwürdiges Sterben; C. Götz, Medizinische Ethik und die katholische Kirche (StdM 15), Münster 2000; E. Schockenhoff, Sterbehilfe und Menschenwürde. Begleitung zu einem „eigenen Tod“, Regensburg 1991; A. Lob-Hüdepohl, Schwierige Willensbekundung. Garantieren Patientenverfügungen würdevolles Sterben, in: HerKorr 61 (2007) 83-87; A. Lob-Hüdepohl, Das Widerfahrnis des Todes und die Erfahrung des Sterbens. Theologisch-ethische Erkundungen in schwierigem Terrain, in: A. Brüning/G. Piechotta (Hg.), Die Zeit des Sterbens. Diskussionen über das Lebensende des Menschen in der Gesellschaft (Praxis-Theorie-Innovation 2), Berlin 2005, 10-32; U. Eibach, Aktive Sterbehilfe – Recht auf Selbsttötung? Eine Stellungnahme aus christlicher Sicht und aus Sicht der Krankenhausseelsorge, in: ZME 52 (2006) 249-267; U. Eibach, Menschenwürde an den Grenzen des Lebens. Einführung in Fragen der Bioethik aus christlicher Sicht, Neukirchen 2000.
33 Vgl. Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Ordo exsequiarum. Editio typica, Vaticano 1969; Die kirchliche Begräbnisfeier in den katholischen Bistümern des internationalen deutschen Sprachgebietes. Hrsg. im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bischofs von Luxemburg, Einsiedeln 1973; Die kirchliche Begräbnisfeier. In den Bistümern des deutschen Sprachgebietes. Zweite authentische Ausgabe auf der Grundlage der editio typica von 1969. Hrsg. von der Ständigen Kommission für die Herausgabe der gemeinsamen liturgischen Bücher im deutschen Sprachgebiet, Freiburg/Br. 22009; Die kirchliche Begräbnisfeier. Manuale. Hrsg. im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, der Österreichischen Bischofskonferenz und der Schweizer Bischofskonferenz sowie des Bischofs von Bozen-Brixen und des Bischofs von Lüttich, Trier 2012.
34 Vgl. S. George, Die Toten bestatten und die Trauernden tösten. Vom doppelten Ziel christlicher Totenliturgie, in: Gd 45 (2011) 9-11; B. Kranemann, Damit ihr Hoffnung habt: Sterben – Tod – Leben. Liturgietheologische und pastoralliturgische Anmerkungen, in: PThI 30 (2010) 59-73; W. Haunerland, Die kirchliche Begräbnisfeier. Zur zweiten authentischen Ausgabe 2009, in: LJ 59 (2009) 215-245; W. Haunerland/A. Poschmann (Hg.), Engel mögen dich geleiten. Werkbuch zur kirchlichen Begräbnisfeier, Trier 2009; A. Franz, Begräbnisliturgie oder Trauerfeier?, in: A. Franz/A. Poschmann u.a. (Hg.), Liturgie und Bestattungskultur, Trier 2006, 13-30; K. Richter, Die christliche Sorge für die Toten im gesellschaftlichen Wandel, in: A. Franz/A. Poschmann u.a. (Hg.), Liturgie und Bestattungskultur, Trier 2006, 159-183; J. Bärsch, Tröstet die Liturgie? Beobachtungen anhand der kirchlichen Begräbnisfeier, in: LS 57 (2006) 17-21; J. Bärsch, Die nachkonziliare Begräbnisliturgie. Anmerkungen und Überlegungen zu Motiven ihrer Theologie und Feiergestalt, in: A. Gerhards/B. Kranemann (Hg.), Christliche Begräbnisliturgie und säkulare Gesellschaft (EThSchr 30), Leipzig 22003, 62-99; W. Haunerland, Auch ein Werk der Barmherzigkeit. Zum kirchlichen Dienst beim Begräbnis, in: ThPQ 150 (2002) 155-165; J. Bärsch/B. Kowalski (Hg.), Trauernde trösten – Tote beerdigen. Biblische, pastorale und liturgische Hilfen im Umkreis von Sterben und Tod (Feiern mit der Bibel 4), Stuttgart 1997; K. Richter, Der Umgang mit Toten und Trauernden in der christlichen Gemeinde. Eine Einführung, in: K. Richter (Hg.), Der Umgang mit den Toten. Tod und Bestattung in der christlichen Gemeinde (QD 123), Freiburg/Br. 1990, 9-26.
35 Vgl. G. Minois, Geschichte des Selbstmords, Düsseldorf 1996; P. Ariès, Geschichte des Todes, München 1993; L. Ruland, Geschichte der kirchlichen Leichenfeier, Regensburg 1903; P. Lex, Das kirchliche Begräbnisrecht – historisch-kanonistisch dargestellt, München 1904; W. Thümmel, Die Versagung der kirchlichen Bestattungsfeier, Leipzig 1902; C. A. Kerin, The Privation of Christian Burial. An Historical Synopsis and Commentary (Nachdruck Washington D.C. 1941) (CLSt 136), Cleveland 1985.
36 J. F. Schannat/J. Hartzheim (Hg.), Concilia Germaniae: in 11 tomis (Nachdruck Köln 1759-1790), Aalen 1970-1996; L. Körntgen, Studien zu den Quellen der frühmittelalterlichen Bußbücher (QFRM 7), Sigmaringen 1993; H. Jedin, Kleine Konziliengeschichte (Herderbücherei 51), Freiburg/Br. 81969; F. W. Wasserschleben (Hg.), Die Bußordnungen der abendländischen Kirche (Nachdruck Halle 1851), Graz 1958; G. Schneemann/T. Granderath (Hg.), Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum: Collectio lacensis, Freiburg/Br. 1870-1892; W. Smets (Hg.), Des hochheiligen, ökumenischen und allgemeinen Concils von Trient Canones und Beschlüsse: nebst den darauf bezüglichen päpstlichen Bullen und Verordnungen und einem vollständigen Inhaltsverzeichnisse, Bielefeld 51858; J. Hardouin (Hg.), Conciliorum Collectio Regia Maxima. Acta Conciliorum Et Epistolæ Decretales Ac Constitutiones Summorum Pontificum: Tomis Duodecim in folio, Parisiis 1714-1715.
37 Für den CIC/1917: F. X. Wernz/P. Vidal, Ius Canonicum. Tomus IV: De Rebus. Vol I: Sacramenta, Sacramentalia, Cultus divinus, Coemeteria et Sepultura ecclesiastica, Romae 1934; A. Vermeersch/J. Creusen, Epitome Iuris Canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum. Tomus II: Liber III Codicis Iuris Canonici (Museum Lessianum. Section théologique), Romae 71954; F. M. Cappello, Summa Iuris Canonici in usum scholarum concinnata. Volumen II, Romae 61962; M. Conte a Coronata, Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. Volumen II. De Rebus, Romae 51962; E. Eichmann, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici. Bd. II: Sachenrecht, Prozeßrecht, Strafrecht, Paderborn 31930. Für den CIC/1983: W. Aymans/K. Mörsdorf, Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici. Bd. III: Verkündigungsdienst und Heiligungsdienst, Paderborn 132007; S. Demel, Art. Bestattung, kirchliche, in: Dies., Handbuch Kirchenrecht. Grundbegriffe für Studium und Praxis, Freiburg/Br. 22013, 55-66; K. Lüdicke (Hg.), Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Essen seit 1984 (Loseblattwerk); J. P. Beal/J. A. Coriden u.a. (Hg.), New Commentary on the Code of Canon Law, New York 2000.
38 Vgl. J. Schnabel, Begräbnisverweigerung nach Selbsttötung? Eine rechtshistorische und rechtsdogmatische Untersuchung (Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit an der WWU Münster), Münster 2014; G. Stork, Das Recht auf ein kirchliches Begräbnis. Normenentwicklung vom Codex Iuris Canonici von 1917 zum Gesetzbuch von 1983 hinsichtlich der Begründung und der Grenzen dieses Rechts (Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit an der WWU Münster), Münster 1993; H. J. F. Reinhardt, Das kirchliche Begräbnis, in: J. Listl/H. Schmitz (Hg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg 21999, 1016-1020; R. Althaus, Das kirchliche Begräbnis – kirchenrechtliche Aspekte, in: W. Haunerland/A. Poschmann (Hg.), Engel mögen dich geleiten. Werkbuch zur kirchlichen Begräbnisfeier, Trier 2009, 33-50.
39 Vgl. H. Magon, Ängste und Bedürfnisse schwerkranker und sterbender Menschen (Teil 1), in: Z Palliativmed 15 (2014) 94-99; H. Schanda/T. Stompe (Hg.), Der freie Wille und die Schuldfähigkeit in Recht, Psychiatrie und Neurowissenschaften (Wiener Schriftenreihe für Forensische Psychiatrie), Berlin 2010; E. Schockenhoff, Die ethischen Grundlagen des Rechts (Kirche und Gesellschaft 349), Mönchengladbach 2008; F. Lettke/W. H. Eirmbter u.a., Krankheit und Gesellschaft. Zur Bedeutung von Krankheitsbildern und Gesundheitsvorstellungen für die Prävention, Konstanz 1999; J. Römelt, Freiheit, die mehr ist als Willkür. Christliche Ethik in zwischenmenschlicher Beziehung, Lebensgestaltung, Krankheit und Tod. Handbuch der Moraltheologie 2, Regensburg 1997.
40 Vgl. J. Sautermeister, Erschöpfter Lebenswille? Individualethische Anmerkungen zur Debatte um den assistierten Suizid, in: HerKorr 69 (2015) 78-83; T. Bronisch, Der Suizid. Ursache, Warnsignale, Prävention, München 62014; W. Dorrmann, Suizid. Therapeutische Interventionen bei Selbsttötungsabsichten, Stuttgart 72012; E. Bauer/R. Fartacek u.a., Wenn das Leben unerträglich wird. Suizid als philosophische und pastorale Herausforderung, Stuttgart 2011; V. Lenzen, Selbsttötung. Ein philosophisch-theologischer Diskurs mit einer Fallstudie über Cesare Pavese, Düsseldorf 1987; E. Ringel, Der Selbstmord. Abschluss einer krankhaften psychischen Entwicklung. Eine Untersuchung an 745 geretteten Selbstmördern (Reprints Psychologie 19), Frankfurt/Main 41985.
41 Vgl. W. Kasper, Barmherzigkeit: Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens, Freiburg/Br. 2012; M. Graulich, Salus animarum – suprema lex. Der Beitrag des Kirchenrechts zu einer Ethik der Seelsorge, in: M. Graulich/M. Seidnader (Hg.), Unterwegs zu einer Ethik pastoralen Handeln, Würzburg 2011, 23-40; R. Raith, Salus animarum und aequitas canonica als Grenzen des kirchlichen Verwaltungshandelns, in: U. Kaiser/R. Raith u.a. (Hg.), Salus animarum suprema lex. FS Max Hopfner (Adnotationes in ius canonicum 38), Frankfurt/Main 2006, 337-352; M. Wijlens, Salus animarum suprema lex. Mercy as a Legal Principle in the Application of Canon Law, in: Jurist 54 (1994) 560-590; T. Schüller, Die Barmherzigkeit als Prinzip der Rechtsapplikation in der Kirche im Dienste der salus animarum: ein kanonistischer Beitrag zu Methodenproblemen der Kirchenrechtstheorie (FzK 14), Würzburg 1993. Zur Bedeutung der Formulierung des konkreten Sachverhalts siehe M. Wijlens, Eucharistiegemeinschaft mit anderen Christen. Vom Verbot mit Ausnahmen zur Erlaubnis unter Bedingungen als Folge neuer ekklesiologischer Einsichten, in: E. Güthoff/S. Haering (Hg.), Ius quia iustum. FS Helmuth Pree (KStT 65), Berlin 2015, 625-649; M. Wijlens, Krankenseelsorge in konfessionsverbindenden Ehen. Eine ekklesiologisch-kirchenrechtliche Betrachtung, in: S. Haering/J. Hirnsperger u.a. (Hg.), In mandatis meditari. FS Hans Paarhammer (KStT 58), Berlin 2012, 781-799.
42 Einer generellen Gewährung oder Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses im Kontext von Euthanasie ist prinzipiell die Unvereinbarkeit allgemeiner Aussagen mit der Komplexität des konkreten Lebens mit seinen spezifischen und einzigartigen Situationen entgegenzuhalten. Eine allein auf Basis der Rechtsinterpretation ohne vorherige Reflexion des konkreten Sachverhalts getroffene Entscheidung unterläge immer dem Verdacht, entgegen der kanonischen Billigkeit der konkreten Situationen einen nicht passenden „Stempel“ aufzudrücken.
43 Die Beschäftigung mit den Zeichen der Zeit mit dem Ziel einer angemessenen theologischen wie pastoralen Reaktion und adäquaten Verkündigung der kirchlichen Lehre in der Welt von heute forderte Papst Johannes XXIII. (1881-1963, Papst: 1958-1963) am 11. Oktober 1962 in seiner Rede zur Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils (1962-1965): „Die Hauptaufgabe des Konzils [und in dessen Rezeption der Kirche] besteht darin, dass unveräußerliche Überlieferungsgut der christlichen Lehre wirksamer zu bewahren und zu lehren. […] Damit aber diese Lehre die vielen und verschiedenen Bereiche menschlicher Aktivitäten erreicht […], ist es vor allem notwendig, daß die Kirche sich nicht von der unveräußerlichen Glaubensüberlieferung abwendet, die sie aus der Vergangenheit empfangen hat. Gleichzeitig muß sie auf die Gegenwart achten, auf die neuen Lebensverhältnisse und -formen, wie sie durch die moderne Welt geschaffen wurden.“ [Vgl. Ioannes PP. XXIII., Allocutio Gaudet mater Ecclesia (11.10.1962), in: AAS 54 (1962) 786-796, 790-791 zitiert nach der deutschen Übersetzung von Nikolaus Klein in W. Bühlmann, Johannes XXIII. Der schmerzliche Weg eines Papstes. Mit dem authentischen Text der Konzilseröffnungsrede (TTB 259), Mainz 32000, 114-129, 120-121.] Dieser Leitsatz kirchlichen Denkend und Handelns wurde in der Pastoralkonstitution des Konzils Gaudium et spes wie folgt ausgedrückt: „Zur Erfüllung dieser Aufgabe obliegt der Kirche alle Zeit die Pflicht, die Zeichen der Zeit zu erforschen und im Licht des Evangeliums auszulegen, so dass sie in einer der jeweiligen Generation angemessenen Weise auf die beständigen Fragen der Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und nach ihrem gegenseitigen Verhältnis antworten kann. Es ist deshalb nötig, dass die Welt, in der wir leben, sowie ihre Erwartungen, Bestrebungen und ihr oft dramatischer Charakter erkannt und verstanden werden.“ [VatII GS Art. 4 Abs. 1. Abgedruckt in: Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II., Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes (07.12.1965), in: AAS 58 (1966) 1025-1115. Dt. Übersetzung: P. Hünermann/B. J. Hilberath (Hg.), Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil 1. Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Konstitutionen, Dekrete, Erklärungen. Lateinischdeutsche Studienausgabe, Freiburg/Br. 2004, 592-749. (Im Folgenden wird die Pastoralkonstitution unter Verwendung des Kürzels VatII zusammen mit den Initialen GS und Angabe der Artikel- und Abschnittsnummer zitiert.)]
44 Dieses Verständnis vom Verhältnis von Theologie und kanonischem Recht geht grundsätzlich zurück auf die niederländische Kanonistin und Theologin Myriam Wijlens [Vgl. M. Wijlens, Sharing the Eucharist. A Theological Evaluation of the Post Conciliar Legislation, Lanham 2000, 1-16.].
45 Vgl. ebd., 3.
46 Vgl. ebd., 4.
47 Nach Ansicht von Wijlens muss diese Hermeneutik des Verhältnisses von Theologie und Recht nicht nur in der Rechtsinterpretation und -anwendung, sondern auch in der Gesetzgebung das leitende Prinzip sein, wenn, wie der kirchliche Gesetzgeber selbst normiert hat, „das Heil der Seelen […] in der Kirche immer das oberste Gesetz“ [Vgl. ebd., 5.] ist.
48 Vgl. ebd., 6.
49 Ioannes Paulus PP. II., Constitutio apostolica Sacrae disciplinae leges (25.01.1983), in: AAS 75/II (1983) VII-XIV, XI. Dt. Übersetzung in: Ioannes Paulus PP. II. - Johannes Paul II., Constitutio Apostolica Sacrae disciplinae leges – Apostolische Konstitution zur Promulgation des CIC, in: Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannes Pauli PP. II. promulgatus – Codex des kanonischen Rechts. Lateinischdeutsche Ausgabe mit Sachverzeichnis. Im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, der Österreichischen Bischofskonferenz, der Schweizer Bischofskonferenz, der Erzbischöfe von Luxemburg und von Straßburg sowie der Bischöfe von Bozen-Brixen, von Lüttich und von Metz, Kevelaer 52001, X-XXIII, XIX. (Im Folgenden wird die Apostolische Konstitution in deutscher Übersetzung unter Verwendung der Initialen SDL und der römischen Seitenangaben zitiert.)
50 Der systematische Aufbau wurde mit Blick auf den CIC/1983 an die Konsequenzen der Theologie und Ekklesiologie des II. Vatikanischen Konzils als hermeneutischer Schlüssel der Codexreform und der Codexinterpretation angepasst (8.1.).
51 Zur Debatte um den befürchteten Slippery-Slope- bzw. Dammbruch-Effekt siehe G. v. Loenen, „Das ist doch kein Leben mehr!“ Sterbehilfe in den Niederlanden, in: R. Beckmann/C. Kaminski u.a. (Hg.), Es gibt kein gutes Töten. Acht Plädoyers gegen Sterbehilfe (Edition Sonderwege), Leipzig 2015, 159-169; J. Römelt, Christliche Ethik in moderner Gesellschaft. Bd. 2: Lebensbereiche, Freiburg/Br. 2009, 292; R. Kipke, Schiefe-Bahn-Argumente in der Sterbehilfe-Debatte, in: ZME 54 (2008) 135-145; H. Schlögel/M. Hoffmann, Passive und aktive Sterbehilfe. Neuere Definitions- und Unterscheidungsprobleme, in: StZ 225 (2007) 89-99, 93-94; G. Klinkhammer, „Ohne Dialog gibt es keine guten Entscheidungen.“ Interview mit Prof. Dr. med. Gian Domenico Borasio, in: DÄ 104 (2007) A224-A226, A225; F. Thiele, Aktive Sterbehilfe. Eine Einführung in die Diskussion, in: F. Thiele (Hg.), Aktive und passive Sterbehilfe. Medizinische, rechtswissenschaftliche und philosophische Aspekte (Neuzeit und Gegenwart), München 2005, 9-29, 16.