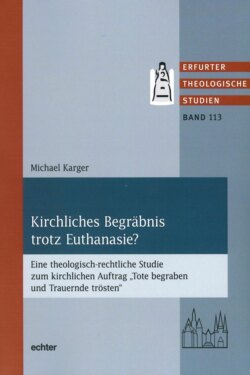Читать книгу Kirchliches Begräbnis trotz Euthanasie? - Michael Karger - Страница 11
ОглавлениеI. TERMINOLOGISCHE ABGRENZUNGEN
2. Begriffsbestimmung
Dem Betrachter der gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurse, der staatlich-gesetzlichen Regelungen sowie der kirchlich-lehramtlichen Aussagen über (ärztliche) Handlungen am Lebensende, die mit der Intention vollzogen werden, entweder den Tod von schwerkranken Menschen herbeizuführen oder diese sterben zu lassen, zeigt sich eine ambivalente Terminologie: erstens wird im internationalen Kontext vorwiegend von euthanasia gesprochen und somit an die antike Verwendung des Wortes angeknüpft, während im deutschsprachigen Raum wegen der historischen Ereignisse und der euphemistischen Karikatur des Euthanasiebegriffs durch das NS-Regime vor allem der Terminus Sterbehilfe Verwendung findet; zweitens werden die beiden Oberbegriffe und die verschiedenen darunter subsumierten Handlungen unter Zuhilfenahme von Adjektiven (wie aktiv – passiv, direkt – indirekt, freiwillig – unfreiwillig – nichtfreiwillig, etc.) inhaltlich ausgestaltet; drittens gibt es Konzepte, die auf diese Terminologie vollkommen verzichten und gänzlich andere Termini verwenden (Tötung auf Verlangen, Schmerzenslinderung, Sterbenlassen). Diese terminologische Ambivalenz erschwert eine einheitliche Diskussion und führt oftmals zu Missverständnissen und divergierenden moralischen Bewertungen, weshalb es für die vorliegende Studie aus Gründen der Wissenschaftlichkeit und der Versachlichung der Materie unerlässlich erscheint, den inhaltlichen Ausführungen eine Begriffsbestimmung voranzustellen.1
Zur Differenzierung der geläufigen Terminologie für die bewusste Herbeiführung des Todes, Behandlungsabbruch bzw. -verzicht und Todeseintritt nach Schmerzmittelgabe wird in einem ersten Schritt ein Überblick über die historische Genese sowohl des Euthanasie- als auch des Sterbehilfeterminus ‘ gegeben, ohne dabei in eine normative Beurteilung zu verfallen. Abgeschlossen wird dieser Punkt mit einer kritischen Analyse der beiden Termini. In einem zweiten Schritt wird der Betrachtungshorizont durch die unterschiedlichen Differenzierungen erweitert und zugrunde liegende Handlungen näher spezifiziert. Positionen, die eine gänzlich andere Terminologie vorschlagen, können aufgrund ihrer Fülle nicht vollständig aufgeführt werden. In einem dritten Schritt werden die in der Gesellschaft gängigen Begriffe zu der Terminologie des kirchlichen Lehramtes ins Verhältnis gesetzt.
2.1. Begriffsgenese – Euthanasie und Sterbehilfe
Die Begriffe Euthanasie und Sterbehilfe begegnen im gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs zur Bezeichnung der verschiedenen (medizinischen) Möglichkeiten zur Herbeiführung des Todes, zur Schmerzlinderung und zur Ermöglichung des Sterbens am häufigsten. Auch der Seelsorger vor Ort wird mit ihnen konfrontiert und muss um deren inhaltliche Konnotationen und terminologische Probleme wissen, da er für die Ausübung seines Dienstes die bezeichnete Handlung auf ihren moralischen Gehalt hin prüfen muss.
2.1.1. Zum Euthanasiebegriff
Griechische und römische Antike
Das in der griechisch-hellenistischen Antike gebräuchliche Wort εὐθάνατος entstand aus der Verbindung des griechischen Präfixes εὐ (gut, schön) mit dem Nomen Θάνατος (Tod). Seine ursprüngliche Bedeutung ist guter Tod.2 Der früheste Beleg für den Begriff εὐθάνατος findet sich beim griechischen Dichter Kratinos (um 500-um 420 v. Chr.),3 der darunter einen leichten Tod verstand und eine in der damaligen Gesellschaft und unter den Gelehrten für gut befundene Art des Todeseintritts beschrieb: ohne vorhergehende langwierige Krankheit. In ähnlicher Weise verwendete der Dichter Menandros (342/341-293/292 v. Chr.) den Begriff εὐθάνατος, um einen rechtzeitigen Tod zu beschreiben, da der zunehmende Alterungsprozess kritisch betrachtete wurde.4 Die substantivierte Form εὐθανασία verwendete erstmalig der Komödiendichter Posidipp (um 300 v. Chr.) als Form eines leichten und rechtzeitigen Todes.5 Die Stoiker bewerteten nicht den Eintritt des Todes, sondern die Einstellung des Menschen in Relation zu seinem Tod. Dieser war dann gut, wenn er würdevoll angenommen wurde.6 Nachdem es im Zuge der Expansion des römischen Reiches zu einer geistigen Beeinflussung des römisch-lateinischen Kulturkreises durch griechisch-hellenistisches Gedankengut gekommen war, begegneten im latinisierten Begriff euthanasia die inhaltlichen Vorstellungen zum εὐθάνατος bzw. zur εὐθανασία. So berichtet der jüdische Historiker Flavius Josephus (37/38-um 100 n. Chr.) vom ehrenvollen Tod.7 Schließlich beurteilte der Historiker Sueton (um 70-um 122 n. Chr.) den schnellen Tod des Kaisers Augustus (63 v. Chr.-14 n. Chr.) als gut.8 Es gilt festzuhalten, dass der Euthanasiebegriff in der Antike eine disparate Verwendung fand und vor allem der Beschreibung des Sterbeprozesses und der Beurteilung von dessen Annahme diente. Ausdruck einer intendierten oder bewussten Herbeiführung des Todes war er nicht.
Mittelalter und Renaissance
Im sich ausbreitenden Christentum gab es ebenfalls eine Reflexion über den Sterbeprozess. Sie zeigte sich eher als christlich eingefärbtes Nachdenken über die individuelle Gestaltung des Sterbens als Vorbereitung auf die eschatologische Gottesschau. Der sterbende Gläubige wurde im Moment des bevorstehenden Todes zu einer umfassenden moralischen Selbstprüfung aufgerufen, um Seele und Gewissen auf noch existierende, d. h. ungebeichtete Sünden hin zu ergründen. Diese letzte Chance sollte erkannt und genutzt werden, um für jene Vergehen, die „den Zutritt in den Himmel erschweren oder diesen ganz und gar unmöglich machen“9, Reue zu zeigen und womöglich Buße zu tun. Ziel war es, ungeachtet der bisherigen Lebensführung dem postmortalen Weg einen anderen Verlauf zu geben.10 Dieser Reflexionsprozess wurde jedoch nicht mit dem Begriff euthanasia bezeichnet, sondern unter dem Oberbegriff ars moriendi (Sterbekunst) zusammengefasst. Dahinter verbarg sich das theologische Verständnis, dass der Gläubigen „ewiges Geschick von ihrer sittlichen Verfassung in der Todesstunde abhinge.“11 Der Euthanasiebegriff verschwand für die folgenden Jahrhunderte in der Versenkung und erfuhr erst in den utopischen Schriften der Renaissance vor allem durch Thomas More (1478-1535) und Francis Bacon (1561-1626) eine Wiederbelebung.12
In Utopia beschrieb More die aktive Herbeiführung eines guten Todes als vernünftige Handlung am Lebensende, wenn „trotz optimaler Pflege und medizinischer Versorgung eine Genesung nicht mehr zu erreichen ist.“13 Er zeichnete einen Kontext, in dem Menschen an einer schweren, zum Tode führenden Krankheit litten, und unerträglichen Schmerzen geplagt wurden, den Aufgaben des Lebens nicht mehr gewachsen waren oder aber anderen zur Last fielen.14 Obwohl More den Euthanasiebegriff selbst nicht verwendete, transferierte er als erster Autor die Thematik von einer rein deskriptiven auf eine handlungsorientierte Ebene.15 Ein Jahrhundert später war es Francis Bacon, der den More’schen Ansatz im Horizont der Neuordnung der Wissenschaften und der Frage nach Stand und Möglichkeiten der Medizin16 aufgriff und mit dem Euthanasiebegriff in Verbindung brachte. Es forderte für die unheilbar Kranken ein schmerzloses Sterben, indem die Ärzte mithilfe einer medikamentösen Schmerzlinderung ein „schönes und leichtes Hinscheiden […] bewirken“17. Eine bewusste Herbeiführung des Todes subsumierte er unter dem Begriff Euthanasie nicht.
Das erneute Aufkommen des Euthanasiebegriffs steht in Verbindung mit dem immensen Entwicklungsschub der zeitgenössischen Medizin, der von tiefgreifenden Erkenntnissen bezüglich der menschlichen Anatomie, des Herz-Kreislauf-Systems, der Funktionalität der Organe und der diagnostischen Möglichkeiten begleitet war.18
Aufklärung
Mit der Aufklärung begann innerhalb der medizinischen Wissenschaft eine Reflexion des Euthanasiebegriffs und der zugrunde liegenden Handlungen. Während die aktive Herbeiführung des Todes auch trotz starker Schmerzen gänzlich abgelehnt wurde, gestaltete sich um Bacons Verständnis von Euthanasie als eine für Ärzte verpflichtende palliativmedizinische Sterbebegleitung eine rege Diskussion. Bacon rezipierend prägte der Mediziner Zacharias Philippus Schulz (Lebensdaten unbekannt) den Begriff der euthanasia medica, unter der er die ärztliche Begleitung eines Sterbenden durch Grundversorgung und Schmerzmittelgabe verstand. Da er wiederum den in Kauf genommenen Tod aufgrund schmerzlindernder Medikamente im Gegensatz zu Bacon strikt ablehnte,19 steckten Bacons und Schulz’ Ansätze in der folgenden medizinethischen Diskussion über die Zulässigkeit einer Medikamentengabe zur Linderung der Schmerzen für die Gestaltung eines guten Todes den Rahmen ab. Als Befürworter von Bacons Thesen, die um die Jahrhundertwende breiter akzeptiert waren,20 sind beispielsweise Nicolaus Paradys (1740-1812) und Johann Christian Reil (1759-1813) zu nennen. Sie erachteten euthanasia als genuine Aufgabe des Arztes, den Tod so leicht, so erträglich als möglich zu machen.21 Es gab allerdings auch vereinzelte Positionen, die unter Euthanasie eine aktive Tötung auf Verlangen verstanden.22
Neben den medizinischen Erkenntnissen evozierte Charles Darwin (1809-1882), der mit seiner Evolutionstheorie und seinen empirischen Forschungsergebnissen der natürlichen Selektion in der Tierwelt23 „ein neues Fundament für die Bewertung von Lebenswert bildete“24, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Überlegungen über eine Ausscheidung des Schwachen den Euthanasiebegriff.25 In Applikation von Darwins Thesen auf den Staat als lebenden Organismus wurde der Begriff der Sozialeuthanasie im Sinne eines Aussortierens des schlechten Erbguts sowie eines Sterbenlassens der kranken, behinderten und schwachen Mitglieder der Gesellschaft geprägt. Diesbezügliche wissenschaftstheoretische Studien des Sozialdarwinismus26, der Eugenik27 und der Rassenhygiene28 haben letztlich der NS-Ideologie der Vernichtung lebensunwerten Lebens und der damit einhergehenden Pervertierung des Euthanasiebegriffs den gedanklichen Boden bereitet. Diese Theorien des späten 19. Jahrhunderts verfolgten dabei keine aktive Tötung im medizinischen Sinn als Erlösung von Schmerzen, sodass der Begriff eine außermedizinische, rassenhygienische Konnotation erfuhr.
Für die Zeit der Aufklärung und des sich anschließenden 19. Jahrhunderts ist festzuhalten, dass die starke medizinische Entwicklung einerseits zu Fragen über Möglichkeiten und Grenzen der Behandlungsansätze und Therapien führte. Konfrontiert mit der Evolutionstheorie Darwins und den darin gründenden Selektionstheorien menschlicher Gesellschaft zur Verbesserung der Rasse wurde der Euthanasiebegriff andererseits häufiger in die inhaltliche Nähe zur Gestaltung eines guten Todes für behinderte, schwache, kranke und alte Menschen gestellt, die die Rasse schwächten. Der Euthanasiebegriff wurde einem spürbaren Wandel unterzogen und fast gänzlich seiner deskriptiven Beschreibung eines guten Todes entzogen. Er diente vorwiegend als Synonym einer zugrundeliegenden, den Tod herbeiführenden Handlung zur Ausscheidung der Schwachen.
Entwicklungen im 20. Jahrhundert
Die Selektionstheorien über die Volksgesundung führten im Übergang zum 20. Jahrhundert zu einer rechtstheoretischen Reflexion hinsichtlich ihrer Umsetzung. In Deutschland legte der Rassenhygieniker Roland Gerkan einen Gesetzesentwurf vor, der für unheilbar Kranke „ein Recht auf Sterbehilfe (Euthanasie)“ vorsah.29 Gerkans Entwurf geht zu großen Teilen auf die Gedanken des Psychologen Adolf Jost (1874-1908) zurück, der auf Basis utilitaristischen und sozialdarwinistischen Gedankenguts für ein Recht auf Tötung auf Verlangen plädierte, indem er den individuellen Wert eines menschlichen Lebens für das Individuum als auch die Gesellschaft in einem Verhältnis von Nutzen und Kosten darstellte.30 Waren die Kosten für die Aufrechterhaltung des Lebens größer als dessen Nutzen, sah Jost aus Gründen menschlichen Mitleids ein Recht auf Tötung auf Verlangen gegeben.31 Unter Betonung des gesellschaftlichen Mitleids mit dem Kranken als auch des Nutzenfaktors für Individuum und Gesellschaft sprach sich auch Haeckel explizit für die Ausscheidung des Schwachen aus.32
Abschließend bereiteten der Jurist Karl Binding (1841-1920) und der Psychiater und Neurologe Alfred Hoche (1865-1943) mit ihrer theoretische Studie Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Mass und ihre Form33 den inhaltlichen Boden für die diffamierende Verwendung des Euthanasiebegriffs durch das NS-Regime.34
Binding vertrat die These, dass jeder ein Recht auf seinen Tod beanspruchen und an eine andere Person delegieren könne, weshalb der mit der Ausführung der Tötung Beauftragte nicht nach eigenem Interesse, sondern auf Wunsch des Sterbewilligen handele.35 Durch diese Rechtsübertragung könne Euthanasie im Sinn einer Tötung auf Verlangen nicht verboten sein.36 Bezüglich des Umgangs mit schwachen, kranken und behinderten Menschen verwies Binding auf die Anwendung utilitaristischer und sozialdarwinistischer Prinzipien und sah bei negativem Lebenswert gemäß dem Jost’schen Berechnungsmaßstab37 den Gesetzgeber sogar in der Pflicht, das Leben der sogenannten Lebensunwerten unter bestimmten Voraussetzungen zur Vernichtung freizugeben.38 Diese Erweiterung des Euthanasiebegriffs um die Vernichtung lebensunwerten Lebens führte im Dritten Reich realiter aber zu einer semantischen Reduktion auf ebendiese. Da sich das NS-Regime die bestehende Ambivalenz des Euthanasiebegriffs in Wissenschaft und Gesellschaft zu Nutze machte und sein Vorhaben zur Stärkung der arischen Rasse auf Basis von Bindings und Hoches Rechtstheorie zur Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens und unter dem Deckmantel einer als Mitleidshandlung propagierten Euthanasie verwirkliche,39 verschwand die Tötung auf Verlangen als Erlösung vom Leiden gänzlich aus dem Deutungshorizont.40 Auch wenn die NS-Euthanasie unter der Bezeichnung aufgrund von Protesten aus der Gesellschaft41 und anderen Ursachen 1941 eingestellt wurde42, hatte der Euthanasiebegriff im deutschsprachigen Raum zu dem Zeitpunkt eine gravierende terminologische Metamorphose durchlaufen und bedeutete ausschließlich die „Ausmerzung von ‚lebensunwürdigen‘ Menschen (Geistesgestörte, Erbgeschädigte, schwerkranke, alte Menschen) kraft staatlicher Anordnung, ohne Frage nach Zustimmung oder Nicht-Zustimmung der Betroffenen oder ihrer Angehörigen.“43
Im internationalen Sprachgebrauch entwickelte sich der Euthanasiebegriff disparat, da er inhaltlich wieder von den selektionstheoretischen Tendenzen abgegrenzt wurde. Vor allem in Großbritannien und den USA fand er in der Diskussion um die Zulässigkeit der ärztlichen Herbeiführung des Todes für schwer kranke Menschen, sofern diese darum baten, eine neue Verwendung.44 Zu keiner Zeit war das Gedankengut der Vernichtung lebensunwerten Lebens Bestandteil der Debatten um Tötung auf Verlangen, sodass für den internationalen Kontext nicht von einem neuerlichen Wandel des Euthanasiebegriffs gesprochen werden kann.
Nach Kriegsende ist sowohl für den deutschen als auch den internationalen Sprachraum eine Ruhephase bzw. Tabuisierung der Diskussion um die Zulässigkeit der Tötung auf Verlangen und anderer medizinischer Handlungen am Lebensende zu verzeichnen.45 Damit endete im deutschsprachigen Raum nicht nur der Diskurs um Tötung auf Verlangen abrupt, sondern auch die Verwendung des Euthanasiebegriffs. Er wurde für unbrauchbar erklärt und durch den Terminus Sterbehilfe ersetzt, wodurch eine weltweit einheitliche Terminologie bezüglich Tötung auf Verlangen aufgegeben wurde.46
Nach in der Phase der Tabuisierung lässt sich im internationalen Sprachgebrauch für die erste Nachkriegsphase47 (1950-1960) eine zunehmende Unterscheidung der Formen von euthanasia in aktive und passive als Differenzierung des ärztlichen Handelns verzeichnen. In dieser nahm auch Papst Pius XII. (1876-1958, Papst: 1939-1958) zu konkreten, medizinethischen Problemen Stellung und übte dadurch einen großen Einfluss auf die Begriffsinterpretation über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus aus.48 Auf den enormen medizinischen Fortschritt in den 1950/60er Jahren folgte eine zweite Nachkriegsphase (1960-1970), in der spektakuläre Einzelschicksale und -fälle bekannt wurden, in denen lebensbeendende und -verkürzende Maßnahmen erbeten und in Anspruch genommen wurden. Dadurch wurde die Debatte um Tötung auf Verlangen als Ausdruck des gestaltenden Mitspracherechts der Patienten am Ende ihres Lebens zu einem bis heute zentralen Thema der öffentlichen Wahrnehmung und des gesellschaftlichen Diskurses.
Abschließend ist für den internationalen Sprachgebrauch eine breite Verwendung des Euthanasiebegriffs als Bezeichnung von ärztlich-medizinischen Handlungen festzuhalten, die in den menschlichen Sterbeprozess lebens- oder therapiebeendend oder schmerzlindernd mit in Kauf genommener Todesfolge eingreifen. Dementgegen ist bis ins 21. Jahrhundert hinein jeder Versuch zur Rehabilitation des Euthanasiebegriffs im deutschsprachigen Raum aufgrund seiner historischen Vorbelastung und euphemistischen Verwendung in der NS-Diktatur bereits im Ansatz zum Scheitern verurteilt.
2.1.2. Zum Sterbehilfebegriff
Seit der Nachkriegszeit ist für den deutschsprachigen Raum in Politik, Gesellschaft und Wissenschaftslandschaft eine Vermeidung des Euthanasiebegriffs festzustellen, um einer Verwechslung mit den Handlungen des NS-Regimes zu entgehen. Dieses hatte den Begriff aufgrund seiner Vernichtung lebensunwerten Lebens unter dem Deckmantel einer erlösenden Euthanasie innerhalb von nur sechs Jahren konterkariert. Stattdessen wird vorwiegend der Sterbehilfebegriff verwendet.49 Obwohl oftmals vermutet wird, dass er als Ersatz des Euthanasiebegriffs erst in der Nachkriegszeit geprägt wurde50, war er bereits Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt51 und wurde partiell als Äquivalent zu Euthanasie gebraucht wurde.52 Während 1914 der Sprachforscher und Philosoph Fritz Mauthner (1849-1923) den Sterbehilfebegriff als „vergeudung von sprachenergie“53 verspottete, führte ihn das Deutsche Wörterbuch der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm von 1941 mit folgender Erklärung:
„[S]terbehilfe, hilfeleistung beim sterben durch todbeschleunigende mittel, neue wortbildung“54.
Der Austausch der beiden Termini Euthanasie und Sterbehilfe im deutschen Sprachgebiet ist letztlich nicht exakt zu datieren. Die Debatte um vorzeitige Lebensbeendigung, d. h. Tötung auf Verlangen wurde jedoch nach Ende des II. Weltkriegs und überwundener Tabuisierung vorwiegend unter Zuhilfenahme des Sterbehilfeterminus aufgegriffen.55 Spätestens ab Mitte der 1970er Jahre hatte Sterbehilfe den Euthanasiebegriff im deutschen Sprachraum als adäquaten Terminus abgelöst.56
Kritisch ist anzumerken, dass der Sterbehilfebegriff kontinuierlich von Fehlinterpretationen und Missverständnissen begleitetet wurde, sodass mit zunehmender Differenzierung der bezeichneten medizinischen Handlungen die Forderung nach anderen Termini geäußert wurde. Die Ambivalenz des Sterbehilfebegriffs wird zum einen in der inhärenten Semantik des Begriffs selbst gesehen, der eine Verbindung der substantivierten Verben Helfen und Sterben darstellt. Aus Sicht der Kritiker bringe das Kompositum Sterbe-hilfe nicht klar zum Ausdruck, ob die Verknüpfung temporaler oder finaler Natur sei. Während die
- Hilfe beim/im Sterben eine zeitliche Kontingenz ausdrücke und einzig auf die umsorgende und schmerzlindernde Begleitung im Sinn einer palliativmedizinischen Grundversorgung im Sterbeprozess abziele, eine bewusste Lebensbeendigung aber nicht intendiere (temporal), bezeichne hingegen die
- Hilfe zum Sterben einen bewusst intendierten Eingriff in den Sterbeprozess des Menschen durch medizinisches Handeln oder Unterlassen, der auf die vorzeitige Herbeiführung des Todes des unheilbar Kranken hingeordnet ist bzw. dessen krankheitsbasierten Sterben keine Therapie entgegensetze (final).57
Auch die Begriffe Hilfe und Sterben wurden aufgrund ihres weitläufigen Interpretationsspielraums kritisiert. Die Verwendung des Wortes Hilfe erscheine hochgradig problematisch, da der Leser mit diesem Begriff eine wohlwollende, am Willen einer in Not geratenen Person orientierte Handlung assoziiere. Der Gebrauch des Wortes im Kontext von Tötung auf Verlangen sei eine Karikatur.58 Ebenso kritisch wurde der Begriff Sterben hinterfragt, da er nicht genau angebe, welche Phase innerhalb des Sterbeprozesses eines Menschen bezeichnet werde: jener Zeitraum, der dem krankheitsbedingten unausweichlichen Tod vorausgeht (Terminalphase, Final- oder Sterbephase), oder der Moment des Todeseintritts an sich.59 Je weitläufiger der Begriff Sterben ausgelegt und je früher der Zeitpunkt des Sterbebeginns angesetzt werde, desto komplexer gestalte sich die Frage nach einer angemessenen Sterbehilfe. Aufgrund des Fehlens eines einheitlichen Konzeptes, zu welchem Zeitpunkt das Sterben des Menschen beginnt,60 ist der Sterbehilfebegriff somit derzeit nicht vor Missverständnissen geschützt.
In Konsequenz der terminologischen Unzulänglichkeiten gibt es im deutschen Sprachraum kein einheitliches terminologisches Konzept, welches ganzheitliche Akzeptanz erhält. Es existieren nebeneinander Ansätze von absoluter Vermeidung des Euthanasiebegriffs61 über die Verwendung beider Begriffe als synonyme Oberbegriffe62 mit partieller adjektivischer Spezifizierung63 bis hin zum Gebrauch von Euthanasie als Äquivalent zur direkten, aktiven Sterbehilfe.64 Zudem gibt die Divergenz der terminologischen Konzepte kontinuierlich Anlass für neue Vorschläge, um irreführende und missverständliche Begriffe abzulösen.
Im Kontext eines Entwurfs eines Sterbehilfegesetzes in Deutschland wurde bereits 1986 die klassische Dreiteilung in aktive, passive und indirekte Sterbehilfe scharf kritisiert und als veraltet bezeichnet. Bei gleichzeitigem Verzicht der gängigen Begriffe wurde die Verwendung von Tötung auf Verlangen, Abbruch oder Unterlassung lebenserhaltender Maßnahmen und leidensmindernden Maßnahmen vorgeschlagen.65 Die jeweiligen medizinischen Handlungen sollten individuell benannt und nicht durch Subsumtion unter einen Oberbegriff sowohl formal wie auch materiell miteinander verknüpft werden. Für den medizinischen Bereich in Deutschland plädierte die Bundesärztekammer (=BÄK) in ihren Grundsätzen zur ärztlichen Sterbebegleitung von 1998, 2004 sowie letztmalig 2011 konsequent für den Verzicht auf den Sterbehilfebegriff.66 Auch der Nationale Ethikrat forderte 2006,
„die eingeführte, aber missverständliche und teilweise irreführende Terminologie von aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe aufzugeben. Entscheidungen und Handlungen am Lebensende, die sich mittelbar oder unmittelbar auf den Prozess des Sterbens und den Eintritt des Todes auswirken, können angemessen beschrieben und unterschieden werden, wenn man sich terminologisch an folgenden Begriffen orientiert: Sterbebegleitung, Therapie am Lebensende, Sterbenlassen, Beihilfe zur Selbsttötung, Tötung auf Verlangen.“67
Sofern der Nationale Ethikrat den Behandlungsabbruch bzw. -verzicht unter Sterbebegleitung verstanden wissen wollte, wurde wiederum kritisiert, dass er zumindest aus strafrechtlicher Perspektive ebenfalls missverständlich sei.68 Daher stand der Rechts- und Staatswissenschaftler Thomas Verrel in seinem Gutachten zu Patientenautonomie und Strafrecht bei der Sterbebegleitung für den 66. Deutschen Juristentag im Jahr 2006 für die Verwendung einer klaren und emotionsentladenen Terminologie wie Tötung auf Verlangen, Behandlungsbegrenzung und Leidensminderung ein.69
Trotz der stichhaltigen und schlüssigen Argumente gegen die Verwendung des Sterbehilfebegriffs konnte sich zumindest in der gesellschaftlichen Debatte im deutschsprachigen Raum keiner der vormals benannten Ablösungsvorschläge durchsetzen, ohne dies als Kompetenzzuweisung an den Sterbehilfebegriff aufgrund seiner Tradition misszuverstehen.
2.1.3. Zusammenfassung
Der Begriff Euthanasie diente in der Antike lediglich der Beschreibung eines guten Todes, der den Sterbenden auf leichte, schnelle, ruhmreiche oder auch würdevolle Art und Weise ereilte. Der Gedanke, selbst für einen guten Tod zu sorgen, trat erstmalig in den utopischen Schriften der Renaissance zum Vorschein, womit der Euthanasiebegriff einen ersten aktiven Einschnitt erfuhr. Zur Zeit der Aufklärung wurde unter Euthanasie die Aufgabe der Ärzte verstanden, für ein schmerzloses und angenehmes Sterben im Sinn einer palliativmedizinischen Sterbebegleitung zu sorgen. Im Horizont darwinistischen, selektionstheoretischen und utilitaristischen Gedankenguts wurde unter Zuhilfenahme des Euthanasiebegriffs ein Recht auf Tötung auf Verlangen in der Hermeneutik menschlichen Mitleids reflektiert. Diese theoretischen Gedanken setzte das NS-Regime in die Praxis um und verfolgte zur Stärkung der arischen Rasse die Vernichtung lebensunwerten Lebens, wodurch der Euthanasiebegriff im deutschsprachigen Raum konterkariert wurde. Während er im internationalen Kontext über die Nachkriegszeit hinaus für die Debatte über Tötung auf Verlangen kontinuierlich Verwendung fand, ist für den deutschsprachigen Raum ein Austausch zugunsten des Sterbehilfebegriffs zu verzeichnen. Zwar werden einerseits sowohl der Begriff selbst als auch die zur Differenzierung verwendeten Adjektive kritisch betrachtet, sodass aus dem medizinischen, juristischen und politischen Bereich terminologische Vorschläge geäußert werden, andererseits aber konnten sich diese nicht durchsetzen.
Nicht nur für den Seelsorger, der eine medizinische Handlung vor dem Hintergrund der kirchlichen Lehre nach ethischen Kriterien bewerten muss, um Möglichkeiten und Grenzen der Seelsorgegestaltung zu eruieren, sondern auch für den um die Feier eines kirchlichen Begräbnisses bittenden Gläubigen kann die aufgezeigte terminologische Varianz erhebliche Konsequenzen haben. Konfrontiert mit dem Vollzug von Tötung auf Verlangen oder Behandlungsabbruch bzw. -verzicht und der entsprechenden Entscheidung seitens des schwerkranken Menschen muss der Seelsorger die konkret verwendeten Begriffe auf ihre Valenz hinterfragen, um zu wissen, welche medizinische Handlung auch tatsächlich vollzogen wurde. In diesem Stadium seines Entscheidungsprozesses wird er aber mit weiteren disparaten terminologischen Konzepten konfrontiert, mit denen einerseits in Politik und Gesellschaft, andererseits vom kirchlichen Lehramt die Oberbegriffe spezifiziert werden. Hierin konkretisiert sich bereits ein erster und ernster Moment des Zweifels.
2.2. Terminologische Konzepte
Wie bereits angedeutet, finden sowohl der Sterbehilfe- als auch der Euthanasiebegriff im deutschsprachigen wie internationalen Kontext trotz Kritik und Ablösungsversuche weiterhin Verwendung. Ungeachtet seiner ungenügenden und unzureichenden Klarheit soll daher in einem ersten Schritt das geläufige Konzept zur Unterscheidung von lebensverkürzenden bzw. -beendenden Maßnahmen am Lebensende anhand der Begriffe aktive und passive Sterbehilfe bzw. euthanasia70 auf der Handlungsebene, direkte und indirekte auf der Intentionsebene sowie freiwillige, nichtfreiwillige und unfreiwillige auf der situativen Ebene dargestellt werden.71 Diese notwendige Differenzierung dient der Analyse jener Handlungen und Sachverhalte, die aus Sicht der katholischen Kirche eventuell als ethisch unzulässig zu bewerten sind und Konsequenzen für die Anwendung des kirchlichen Rechts nach sich ziehen könnten. So ist beispielsweise die Intention, mit der ein Medikament verabreicht wird, kirchenrechtlich höchst relevant. Die Intention, den Tod durch Medikamentengabe vorzeitig herbeizuführen, stellt einen vollkommen anderen Sachverhalt dar, als die anvisierte Schmerzlinderung mit in Kauf genommener Todesfolge. Zudem ist die Willenshaltung des Patienten bezüglich der vollzogenen Handlung für deren ethische Beurteilung und somit auch über die kirchenrechtlichen Konsequenzen bezüglich Gewährung oder Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses entscheidend. Aus diesem Grund soll in einem zweiten Schritt das terminologische Konzept dargestellt und hinterfragt werden, das in den lehramtlichen Dokumenten Verwendung findet. Diese Differenzierung dient der Klärung und Sondierung jener Sachverhalte, die aufgrund ihrer moralischen Fragwürdigkeit für die vorliegende kirchenrechtliche Studie von Belang sind.
2.2.1. Gängige Differenzierung des Sterbehilfebegriffs
Trotz vorgebrachter Alternativen wird auch weiterhin auf die klassische Dreiteilung des Sterbehilfebegriffs in aktiv, passiv und indirekt zurückgegriffen, obwohl diese unter medizinischen und juristischen Gesichtspunkten unzulänglich ist.72 Dem früheren Bamberger Moraltheologen Volker Eid zufolge wurde bereits 1975 unter
- aktiver Sterbehilfe die direkte Herbeiführung des Todes,
- unter passiver das durch Behandlungsverzicht oder -abbruch zugelassene Sterben und
- unter indirekter die intendierte Schmerzlinderung mit nicht intendierter, aber billigend in Kauf genommener Todesfolge als Nebenwirkung der Medikamentengabe
verstanden.73 Die erste offensichtliche Unterscheidung in aktiv/passiv bezeichnet kein physisches Handeln oder Unterlassen eines Dritten am Patienten, sondern qualifiziert das äußere Einwirken auf den natürlichen Sterbeprozess. Aktiv ist Sterbehilfe dann, wenn sie den natürlichen Sterbeprozess abbricht und der Tod aufgrund der Handlung eintritt. Sie ist passiv, wenn der Sterbeprozess nicht mehr mithilfe von Medikamenten oder Therapien verlangsamt oder aufgehalten wird und der Tod durch die Krankheit verursacht wird. An dieser Stelle ist klar hervorzuheben, dass die Begriffe aktiv wie passiv ohne nähere Bestimmung auf deskriptiver Ebene verharren und daher als solche wertneutral bleiben. Sie geben über die Todesursache Auskunft: Abbruch des natürlichen Sterbeprozesses (aktiv) oder das ungebremste und ungehinderte Zulassen des Sterbens durch die Krankheit (passiv).74
Eid verknüpfte den Begriff aktive Sterbehilfe mit der direkten Absicht, den Tod herbeizuführen. Er verstand darunter die direkte (aktive) Sterbehilfe, deren sachlogisches Pendant die indirekte Sterbehilfe darstellt, da auch sie de facto eine Herbeiführung des Todes und den Abbruch des natürlichen Sterbeprozesses bezeichne, auch wenn diese nicht intendiert wurden. Aufgrund ihrer Natur aber muss sie als Teilbereich der aktiven Sterbehilfe betrachtet werden, der bei gleichem Handlungsergebnis, der, wenn auch nicht intendierten Herbeiführung des Todes durch das Begriffspaar direkt/indirekt auf der Intentionsebene näher differenziert wird.75
Es bedarf für die moralische und juridische Klärung noch einer dritten Differenzierung, die im Kriterium der Willenshaltung des Patienten angesiedelt und durch freiwillig, nichtfreiwillig und unfreiwillig zu klassifizieren ist. Diese wird oftmals außer Acht gelassen, obwohl sie den Unterschied zwischen direkter aktiver, indirekter aktiver sowie passiver Sterbehilfe einerseits und Mord, Totschlag sowie fahrlässiger oder vorsätzlicher Tötung andererseits ausmacht.
Unterscheidung auf der Ebene der Todesursache – aktiv/passiv
Es wurde aufgezeigt, dass die erste Unterscheidung lebensverkürzender bzw. -nichterhaltender medizinischer Maßnahmen im Kontext von unheilbarer Krankheit in aktive und passive Sterbehilfe keine Information über die Intention oder die Art der Handlung seitens eines Dritten preisgibt, sondern etwas über die Qualität der Todesursache aussagt: Verstarb der Patient an der durch Behandlungsabbruch bzw. -verzicht ermöglichten ungehinderten Ausbreitung der Krankheit (passiv) oder aber ist der Tod als direkte Folge eines Eingriffs einer außenstehenden Person (aktiv) eingetreten.
Als aktive Sterbehilfe sind jene medizinischen Eingriffe einzuordnen, die unmittelbar zum Tod des schwerkranken Patienten führen, sodass der Todeseintritt primär als Folge des äußeren Eingriffs und nicht der bestehenden Krankheit anzusehen ist. Im Gegensatz zu einem üblicherweise präsumierten Tod durch Krankheit kommt es zu einem Wechsel der Todesursache im Zeichen eines dem natürlichen krankheitsbedingten Tod vorweggegriffenen Todes. Für die Charakterisierung einer Handlung als aktive Sterbehilfe ist die Intention des Handelnden irrelevant. Tritt der Tod unabhängig der Intention zur Todesherbeiführung oder zur Schmerzlinderung als Resultat einer Medikamentengabe ein, erfolgte unweigerlich ein Austausch der Todesursache, sodass die Handlung als aktive Sterbehilfe zu qualifizieren ist. Ebenso irrelevant für die Bestimmung einer Handlung als aktiv oder passiv ist die Situation der schweren, unheilbaren Krankheit selbst, die ein entsprechendes (ärztliches) Handeln erst möglich bzw. nötig gemacht hat. Sie ist zwar die conditio sine qua non für das äußere Handeln, nicht aber die direkte Ursache für den Tod.
Als passive Sterbehilfe werden indes jene medizinischen Interventionen angesehen, bei denen die Verlängerung des Lebens bzw. Verzögerung des Sterbeprozesses mithilfe lebenserhaltender oder -verlängernder Therapien nicht mehr verfolgt wird.76 Nach Änderung des Therapieziels gemäß einem würdevollen Sterben wird dem Sterbeprozess nicht mehr mithilfe therapeutischer und intensivmedizinischer Maximalbehandlung entgegengewirkt, sondern stattdessen das aufgrund der Krankheit unausweichliche Sterben lediglich palliativmedizinisch und schmerzlindernd begleitet. Der schwerkranke Patient stirbt zwar in Folge des Behandlungsabbruchs und -verzichts, der Tod aber ist keine direkte Folge des ärztlichen Einwirkens ist, sondern tritt aufgrund der fortschreitenden Krankheit als natürlicher Tod eintritt.77 Weder wird der Tod herbeigeführt noch der Sterbeprozess verkürzt, da lediglich die lebenserhaltenden bzw. -verlängernden therapeutischen Maßnahmen beendet werden oder bereits vor deren Beginn auf diese verzichtet wurde.
Als Argument gegen die Verwendung des Begriffspaares aktiv/passiv wird immer wieder die Konnotation dieser beiden Adjektive mit der Beschreibung menschlichen Handelns als Tun (aktiv) und Unterlassen (passiv) ins Feld geführt. Diese Hermeneutik hätte das Missverständnis zur Folge, dass jedes Tätigwerden eines Dritten – z. B. des Arztes oder Krankenpflegers – als aktive Sterbehilfe und einzig das physische Nichtagieren als passive Sterbehilfe zu bezeichnen seien. Demnach müssten neben der Tötung auf Verlangen und der intendierten Schmerzlinderung mit billigend in Kauf genommener Todesfolge auch sämtliche Formen des Behandlungsabbruchs wie das Abschalten von Beatmungsgeräten oder die Beendigung von künstlicher Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr zum Bereich der aktiven Sterbehilfe gezählt werden, da sie alle eine Tätigkeit implizieren. Als passive Sterbehilfe könnte nach diesem Verständnis einzig der Verzicht auf eine Therapie oder Behandlung verstanden werden.78 Dem ist logisch zu erwidern, dass gerade die Zuordnung sowohl des Behandlungsabbruchs (aktives Verhalten) als auch -verzichts (passives Verhalten) zum Bereich der passiven Sterbehilfe zeigt, dass sich der Begriff passiv eben nicht am menschlichen Tun oder Unterlassen orientiert, zumal weder nach deutschem noch internationalem Recht in der juristischen Bewertung zwischen der Einstellung einer bereits laufenden Therapie und des Behandlungsverzichts unterschieden wird.79
Vor der Assoziation von passiver Sterbehilfe mit einem passiven Verhalten gegenüber Sterbenden im Sinn eines Nichtstuns ist auch mit Blick auf die palliativmedizinische Versorgung zu warnen, da diese dann auch abgebrochen werden müsste, obwohl sie neben „menschenwürdige[r] Unterbringung, Zuwendung, Körperpflege, Linderung von Schmerzen, Atemnot und Übelkeit sowie Stillen von Hunger und Durst“80 zur immer verpflichtend auszuübenden Basisversorgung des Patienten gehört. Ein auf der Fehlinterpretation des Begriffs passive Sterbehilfe beruhendes inaktives Verhalten seitens des medizinischen Personals würde beträchtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Unterscheidung auf der Ebene der Intention – direkt/indirekt
Die vorhergehende Differenzierung in aktive und passive Sterbehilfe impliziert sie Subsumtion jener Handlungen unter aktive Sterbehilfe, die einen Wechsel der Todesursache bewirken. Für ihre juristische wie moralische Bewertung gilt es zu klären, ob der durch die medizinische Intervention verursachte Tod vom Handelnden bewusst und zielgerichtet herbeigeführt oder lediglich billigend in Kauf genommen wurde. Dies zieht je nach Sach- und Rechtslage unterschiedliche Konsequenzen nach sich. Vom verwendeten Begriffspaar direkt und indirekt wird das jeweils Zutreffende dem Terminus der aktiven Sterbehilfe vorangestellt.
Als direkte aktive Sterbehilfe sind jene medizinischen Handlungen am Lebensende zu qualifizieren, die erstens den Tod verursacht haben (aktiv) und bei denen zweitens die Herbeiführung des Todes seitens des Handelnden zielgerichtet intendiert war (direkt). Im Gegensatz dazu sind medizinische Interventionen am Lebensende als indirekte aktive Sterbehilfe zu bezeichnen, wenn sie zwar ebenso den Tod verursachen (aktiv), diesen aber aufgrund ihrer palliativmedizinischen Ausrichtung und der schmerzlindernden Intention lediglich billigend, d. h. als vollkommen unbeabsichtigte Nebenwirkung in Kauf nehmen (indirekt).81 Eine solche schmerzlindernde Handlung mit billigend in Kauf genommener Todesfolge wird auf Basis des ethischen Prinzips der Doppelwirkung einer Handlung, welches auf den Kirchenlehrer Thomas von Aquin (1225-1274) zurückgeht,82 nicht als Tötung auf Verlangen gewertet, da sie aufgrund ihres sittlichen Gehalts eindeutig als eine das Gut der Schmerzenslinderung intendierende Handlung zu qualifizieren ist. Alle Handlungen, die dem Bereich der indirekten aktiven Sterbehilfe zuzurechnen sind, gelten daher sowohl nach ethischen wie rechtlichen Maßstäben als zulässig und geboten. Als positives Gut der palliativmedizinischen Umsorgung verfolgen sie langfristig ein würdevolles Sterben.83
Unbeschadet der notwendigen theoretischen Differenzierungen im Bereich der aktiven Sterbehilfe existiere nach Borasio in der Realität jedoch nur noch die direkte aktive Sterbehilfe. Aufgrund der bestehenden Möglichkeiten einer nahezu fehlerlosen Schmerzeinstellung sei die indirekte aktive Sterbehilfe eigentlich inexistent.84
Unterscheidung auf der Ebene der Willenshaltung – freiwillig/unfreiwillig/nichtfreiwillig
Nach der Differenzierung in direkte aktive, indirekte aktive und passive Sterbehilfe mithilfe der Kriterien der Todesursache und der Handlungsintention bedarf es noch einer dritten Unterscheidung, um die moralischen wie rechtlichen Implikationen der Handlung vollends zu erfassen. Dazu sind die verschiedenen Willenshaltungen zu betrachten, die ein schwerkranker Patient in Relation zur jeweiligen medizinischen Handlung einnehmen kann. In der Literatur werden insgesamt drei Sachverhalte unterschieden: freiwillig, unfreiwillig und nichtfreiwillig.85 Wird vom Schwerkranken der Wunsch nach Herbeiführung des Todes, Linderung der Schmerzen durch Medikamente oder Behandlungsabbruch bzw. -verzicht geäußert und in freier Entscheidung einem Vollzug zugestimmt, dann wird von freiwilliger Sterbehilfe gesprochen.86 Werden entsprechende medizinische Eingriffe vorgenommen, obwohl der einwilligungs- und entscheidungsfähige Patient diese abgelehnt bzw. seine Einwilligung verweigert hat oder aber sein Wille von vornherein nicht erfragt wurde, handelt es sich um unfreiwillige Sterbehilfe.87 Als ebenso unfreiwillig werden alle unter Zwang und Druck getroffenen mutmaßlichen Einwilligungen erachtet.88 Der Vollzug von aktiver oder passiver Sterbehilfe an einem entscheidungs- bzw. einwilligungsunfähigen Patienten, der im Zustand der Bewusstlosigkeit verharrt oder seines Vernunftgebrauchs entbehrt, wird nach aktueller Terminologie als nichtfreiwillig bezeichnet.89 Der Patient war nicht in der Lage, eine Entscheidung über den weiteren Behandlungsverlauf zu fällen oder bereits getroffene Entscheidungen zu kommunizieren. In solchen Fällen müssen die behandelnden Ärzte den weiteren Therapieverlauf und das Therapieziel an der medizinischen Indikation auszurichten und weitere Interaktionen mittels einer eventuell vorliegenden Patientenverfügung bzw. bei deren Fehlen durch Eruierung des mutmaßlichen Willens der Person bestimmen.90 Der Begriff nichtfreiwillig bezeichnet die aktuelle Nichtfähigkeit des Patienten zur Willensbekundung.
Zusammenfassung
Als Zusammenfassung der dargelegten Differenzierungen von Sterbehilfe in aktiv/passiv, direkt/indirekt sowie freiwillig/unfreiwillig/nichtfreiwillig soll das folgende Schaubild91 fungieren:
Inmitten der Unterscheidung in aktive und passive Sterbehilfe wurde die (ärztliche) Beihilfe zum Suizid92 aufgenommen, wobei die gestrichelte Linie bewusst die Ambivalenz dieser Subsumtion verdeutlicht. Für eine Aufnahme der Beihilfe zum Suizid in den Bereich der Sterbehilfehandlungen wird ins Feld geführt, dass die außenstehende Person dem darum bittenden schwerkranken Menschen alle benötigten Mittel derart zur Verfügung stellt, dass dieser sich eigenständig das Leben nehmen kann. Der Suizid hätte zwar nicht ohne äußere Handlung vollzogen werden können, dennoch wird die Handlung vom Suizidanten selbst ausgeübt, wodurch dieser den Tod direkt herbeiführt. Als Argument gegen eine Auslegung der Suizidbeihilfe als Sterbehilfe vorgebracht, dass eine Einwirkung auf das Leben bzw. den Sterbeprozess seitens des Außenstehenden weder aktiv noch passiv gegeben ist.93 Dass dem Suizidant die Tatherrschaft zukommt, ist vor allem für die rechtliche Qualifizierung eines Suizids als Suizid und nicht als Sterbehilfehandlung von immenser Bedeutung.94
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass zwischen Suizidbeihilfe und Sterbehilfe zwar eine gewisse Ähnlichkeit besteht, die im Versuch zur Realisierung des Patientenwillens gründet. Die gleichzeitige Unähnlichkeit der beiden Handlungen insinuiert daher auch eine Ungleichwertigkeit.
2.2.2. Die Terminologie des kirchlichen Lehramts seit 1980
Das Lehramt der katholischen Kirche gebraucht in seinen zurückliegenden Verlautbarungen und Stellungnahmen zum ethischen Gehalt von medizinischen Handlungen am Lebensende eine eigene Terminologie. Indem die Teilbereiche Euthanasie als Herbeiführung des Todes, die Anwendung therapeutischer Mittel und die Anwendung schmerzstillender Mittel nach Art ihrer Handlung differenziert und deskribiert werden, wird auf einen terminologischen Oberbegriff wie Sterbehilfe oder Euthanasie sowie dessen adjektivische Ergänzung gänzlich verzichtet. Dadurch bedarf es auch zum näheren Verständnis der terminologischen Differenzierung der einzelnen Handlungskategorien im Gegensatz zur Sterbehilfeterminologie keines verborgenen Kriterienkatalogs (Todesursache, Intention, Willenshaltung).95
Die lehramtlichen Terminologie wurde nicht explizit konstruiert, sondern ist im Kontext des immensen medizinischen Fortschritts in den 1940-50er Jahren gewachsen. Pius XII. wurde als Gesprächspartner nach der ethischen Beurteilung bzw. moralischen Zulässigkeit diverser medizinischer Handlungen gefragt und äußerte sich grundlegend zur euthanasia96 als Herbeiführung des Todes zum Erlös von Schmerzen durch Handlung oder Unterlassung.97 Er prägte „den Unterschied zwischen ordentlichen, immer einzusetzenden, und außerordentlichen, nicht in jedem Fall einzusetzenden Mitteln, um damit die Fragen um einen möglichen Behandlungsabbruch bzw. -verzicht bei einem schwer Leidenden bzw. Sterbenden differenzierter betrachten zu können“98 und verwies hinsichtlich der Schmerzmittelgabe mit nichtintendierter Todesfolge auf das traditionelle Prinzip der Doppelwirkung einer Handlung.
Nach einer gewissen Ruhephase in der Nachkriegszeit, die sich auch im Fehlen kirchlicher Stellungsnahmen abbildet, ist parallel zum Anstieg des politischen, medizinischen und gesellschaftlichen Reflektierens über Tötung auf Verlangen, Behandlungsabbruch und -verzicht sowie Schmerzlinderung mit unbeabsichtigter Todesfolge auch seitens des kirchlichen Lehramts eine Zunahme entsprechender Veröffentlichungen zu verzeichnen. Inhaltlich auf die gesellschaftlichen Fragen und Tendenzen reagierend haben diese die kirchliche Lehre von der Unantastbarkeit menschlichen Lebens und die ethische Beurteilung medizinischer Handlungen am Lebensende zum Inhalt. Der Umstand, dass seitens des Apostolischen Stuhls zwischen 1980 und 1995 insgesamt fünf eigenständige Dokumente veröffentlicht wurden, die allgemein dem Kontext von schwerer Krankheit, der Lebenswirklichkeit schwerkranker Patienten und dem Dienst der im medizinischen und pflegerischen Bereich Tätigen gewidmet sind und speziell zur Euthanasie und zur Anwendung therapeutischer und schmerzstillender Mittel Stellung nehmen, zeigt die Bedeutung und Relevanz des gesamten Themenkomplexes, die ihnen seitens des kirchlichen Lehramtes für den christlichen Glauben, den einzelnen Gläubigen als auch die Menschheit selbst beigemessen wurde.
Die päpstlichen Aussagen von Pius XII. aufgreifend veröffentlichte die Heilige Kongregation für die Glaubenslehre am 5. Mai 1980 die Erklärung Iura et bona99 zu einigen Fragen zur kirchlichen Lehre bezüglich der Euthanasie. Obwohl die von den vorangegangenen Päpsten herausgestellten Grundsätze der kirchlichen Lehre zur Euthanasie und anderen medizinischen Handlungen am Lebensende ihr volles Gewicht behielten, erforderten der medizinische Fortschritt und mit ihm die gewachsenen medizinischen Möglichkeiten eine Klärung hinsichtlich der ethischen Zulässigkeit entsprechender Eingriffe seitens des kirchlichen Lehramts.100 Da die Erklärung der Glaubenskongregation als Grundlagendokument verstanden und in den nachfolgenden lehramtlichen Veröffentlichungen kontinuierlich rezitiert wurde, prägte sie die lehramtliche Terminologie entschieden. Nur ein Jahr später publizierte der Päpstliche Rat Cor Unum am 27. Juni 1981 aufgrund des regen Interesses ein internes Arbeitsdokument aus dem Jahr 1976, welches sich vorwiegend pastoralen Fragen widmete.101 Als dritte Veröffentlichung ist der am 11. Oktober 1992 publizierte Catechisme de l’Église catholique102 zu nennen, der bewusst nicht als theologischwissenschaftliches Lehr- und Arbeitsbuch konzipiert wurde. Als Kompendium der katholischen Glaubenslehre sollte er die kirchliche Glaubens- und Sittenlehre als ganze normativ zusammenfassen, um ein Werkzeug des katechetischen und verkündenden Wirkens der Kirche zu sein.103 Im Jahr 1995 wurden noch zwei weitere kirchenamtliche Lehrschreiben veröffentlicht, die sich mit Euthanasie als Angriff auf das menschliche Leben und der ethischen Beurteilung anderer medizinischer Handlungen am Lebensende beschäftigten, wobei das zweite im Schatten des ersten fast der öffentlichen Wahrnehmung entzogen blieb: die Enzyklika Evangelium vitae104 von Papst Johannes Paul II. vom 25. März 1995 und die Charta der im Gesundheitsdienst tätigen Personen105 des Päpstlichen Rates für die Seelsorge im Krankendienst vom Mai 1995. Während der Papst das von Gott geschenkte Leben als hermeneutischen Zugang zur Betrachtung menschlicher Eingriffe auf selbiges und deren ethischer Bewertung gebrauchend unter anderem die kirchliche Lehre zu Euthanasie und anderen medizinischen Interventionen am Lebensende darlegte,106 verfolgte der päpstliche Rat mit seiner Charta die Verbreitung, Erklärung und Verteidigung der kirchlichen Lehre im Bereich der Gesundheitsversorgung.107 In inhaltlicher Kontinuität mit den vorausgegangenen lehramtlichen Dokumenten bezieht die Charta als vollständig und unverzüglich von der Glaubenskongregation approbierter und bestätigter Text volle Gültigkeit und zuverlässige lehramtliche Autorität zuzuerkennen.108
Im Folgenden wird ein systematischer Überblick über die vom Lehramt verwendete Terminologie bezüglich Euthanasie, Anwendung therapeutischer Mittel und Anwendung schmerzstillender Mittel gegeben. Die ethische Beurteilung der entsprechenden Handlungen erfolgt im weiteren Verlauf der Arbeit.109
Euthanasie
Bereits 1980 wies die Glaubenskongregation darauf hin, dass die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes Euthanasie verloren gegangen sei und „vielmehr an einen ärztlichen Eingriff [gedacht werde], durch den die Schmerzen der Krankheit oder des Todeskampfes vermindert werden“110. In der Beschreibung von Euthanasie, die grundlegend auf den Differenzierungen von Pius XII. basiert und in den nachfolgenden Dokumenten rezipiert wurde, fehlt das Element des ärztlichen Eingriffs jedoch:
„Unter Euthanasie wird hier eine Handlung oder Unterlassung verstanden, die ihrer Natur nach oder aus bewußter Absicht den Tod herbeiführt, um so jeden Schmerz zu beenden. Euthanasie wird also auf der Ebene der Intention wie auch der angewandten Methoden betrachtet.“111
Eine erste Unterscheidung ist in der Differenzierung in Handlung oder Unterlassung zu sehen. Dabei erscheint es als irrelevant, ob die medizinische Intervention als ein Tätig-Werden zu werten ist oder nicht. Ebenso ist unwesentlich, ob „die Herbeiführung des Todes methodenimmanent ist (z.B. tödliche Injektion) oder etwa durch die Unterlassung einer Therapiemaßnahme unmittelbar intendiert ist.“112 Eine zweite Unterscheidung erfährt die mit dem Euthanasiebegriff bezeichnete Handlung durch ihre Eigenarten, da sie entweder mit der Intention ausgeübt worden sein muss, den Tod herbeizuführen, oder aber – und hierin liegt ein entscheidender Zusatz – den Tod aus ihrer Natur heraus herbeigeführt hat. Die Glaubenskongregation gibt zu bedenken, dass die Kriterien zur Unterscheidung, wann medizinische Eingriffe am Lebensende unter die Kategorie Euthanasie fallen, in der Intention und der inneren Wirkweise implizit enthalten sind und sich grundlegend an jenem zu verurteilenden Wunsch bzw. Willen orientieren, sich „zum Herrn über den Tod zu machen, indem man ihn vorzeitig herbeiführt und so dem eigenen oder dem Leben anderer ‚auf sanfte Weise’ ein Ende bereitet.“113
Woran sich die Eigenschaft der Natur nach den Tod herbeiführen letztlich bestimmt, bleibt in den lehramtlichen Dokumenten unscharf. Die Frage ist, wie unterlassene oder abgebrochene medizinische Therapien, die ihrer Natur nach zum Tode führen, von denen zu unterscheiden sind, die ihrer Natur nach nicht zum Tode führen, aber dennoch das Sterben zulassen. Diese Unklarheit kommt besonders mit Blick auf die Unterscheidung der therapeutischen Mittel in ethisch verpflichtende und nicht verpflichtende zum Tragen.114 Es erwächst daraus die Frage, ob Verzicht oder Abbruch von ethisch verpflichtenden therapeutischen Maßnahmen als eigenständige Kategorie oder als Euthanasie im Sinn einer Unterlassung, die der Natur nach zum Tode führt, zu werten sind. Der Möglichkeit einer missverständlichen Nutzung des Euthanasiebegriffs Gewahr werdend, plädierte der Päpstliche Rat Cor Unum daher bereits 1981 für eine präzise Verwendung.115 Der Euthanasiebegriff sei weder als adäquate Bezeichnung für eine intendierte Schmerzlinderung mit Todesfolge noch für den Abbruch bzw. Verzicht ethisch nicht verpflichtender therapeutischer Mittel geeignet, da keiner der benannten Handlungen die Intention zugrunde liege, den Tod herbeizuführen, oder die Herbeiführung des Todes – nicht zu verwechseln mit dem annehmenden Sterbenlassen – in der Natur der Sache selbst liege.116 Vielmehr seien das Gewähren eines menschenwürdigen Sterbens und die Vermeidung eines unangemessenen Hinauszögerns des Sterbeprozesses intendiert und umgesetzt. Daraus lässt sich aber ableiten, dass der Euthanasiebegriff für den Abbruch bzw. Verzicht von ethisch verpflichtenden therapeutischen Maßnahmen durchaus geeignet wäre.
Diese Interpretation erhält durch die Ausführungen des Katechismus, der Enzyklika Evangelium vitae und der Charta aufgrund ihrer differenzierteren Verwendung des Euthanasiebegriffs weitere Argumente. Im Gegensatz zur Glaubenskongregation und zum Päpstlichen Rat Cor Unum, die nur euthanasia117 und l‘euthanasie118 als solche behandelten, sprach der Katechismus erstmals von l’euthanasie directe und sah diese – unbeschadet in der gewählten Form – in der Lebensbeendigung behinderter, kranker oder sterbender Menschen begründet.119 Die Beliebigkeit der existierenden Gründe und der verwendeten Mittel verschleiert dabei den Inhalt der näheren Qualifizierung der Euthanasie als direkt, zumal im Folgesatz die allgemein gehaltene Euthanasiebeschreibung der Glaubenskongregation von 1980 rezipiert wird,120 ohne einen Verweis auf die indirekte Euthanasie oder eine Beschreibung dessen, was darunter allenfalls zu verstehen sei, zu geben. Die die lehramtliche Terminologie wurde an dieser Stelle nicht nachhaltig geschärft.
Johannes Paul II. verwendet in seiner Enzyklika Evangelium vitae den Euthanasiebegriff zunächst in allgemeiner Form für die Versuchung und Entscheidung, den Tod vorzeitig und bewusst herbeizuführen.121 Die darauf folgende Beschreibung schlägt jedoch einen differenzierteren Ton an, da nunmehr von Euthanasie im eigentlichen Sinn die Rede ist:
„Unter Euthanasie im eigentlichen Sinn versteht man eine Handlung oder Unterlassung, die ihrer Natur nach und aus bewußter Absicht den Tod herbeiführt, um auf diese Weise jeden Schmerz zu beenden. ‚Bei Euthanasie dreht es sich also wesentlich um den Vorsatz des Willens und um die Vorgehensweisen, die angewandt werden‘.“122
Die Reduktion der definitionsähnlichen Beschreibung auf Euthanasie im eigentlichen Sinn hat zwangsläufig zur Folge gehabt, dass die näheren Attribute der Handlung oder Unterlassung, die die Glaubenskongregation noch in einem variablen Verhältnis sah, sodass von ihnen nur eines hinreichend vorhanden sein musste, damit es sich um Euthanasie handelte, nunmehr additiv miteinander verknüpft wurden. Euthanasie im eigentlichen Sinn ist demnach keine Handlung oder Unterlassung, die aus ihrer Natur heraus oder (vel) auf Basis der Intention den Tod herbeiführt, sondern stattdessen jene, die ihrer Natur nach und (et) aus bewusster Absicht zum Tode führt.123
Es stellt sich die Frage, ob aus dieser Differenzierung das Verständnis von Euthanasie im uneigentlichen Sinn als Handlung oder Unterlassung abzuleiten ist, die nur der Natur nach oder nur der Intention nach den Tod herbeiführt. Wenn der Papst aber bezüglich des Verzichts bzw. des Abbruchs von ethisch nicht verpflichtenden therapeutischen Maßnahmen deutlich hervorhebt, dass diese „nicht gleichzusetzen [sind] mit Selbstmord oder Euthanasie“, da sie „vielmehr Ausdruck dafür [sind], daß die menschliche Situation angesichts des Todes akzeptiert wird“124, dann können unter Euthanasie im uneigentlichen Sinn nur noch der Abbruch oder Verzicht jener therapeutischen Mittel zu verstehen sein, die ethisch verpflichtend anzuwenden sind. Aufgrund der fehlenden Quellenlage ist diese These aber nicht verifiziert.
Neben die Konzepte der direkten Euthanasie (1992) und der Euthanasie im eigentlichen Sinn (1995) stellte der Päpstliche Rat für die Seelsorge im Krankendienst ein weiteres Verständnis von Euthanasie, indem die im Katechismus verwendete Terminologie aufgegriffen und durch die Attribute aktiv und passiv ergänzt wurde: eutanasia diretta, attiva o passiva.125 Die Einführung dieser gesellschaftlich gängigen, aber zuvor vom Lehramt nicht verwendete Spezifizierung verwundert, da sich die Verfasser der Charta eigentlich dafür entschieden hatten, zur Vermeidung widersprüchlicher Interpretationen vor allem „die Stellungnahmen der Päpste bzw. der von den Dikasterien der Römischen Kurie veröffentlichten maßgeblichen Texte fast immer direkt zu Wort kommen zu lassen“126. Nichtsdestotrotz wird nach Zitation der Beschreibung der Glaubenskongregation formuliert, dass Mitleid niemals eine direkte, aktive oder passive Euthanasie rechtfertige, sodass es sich dabei
„nicht um die Hilfeleistung an einen Kranken [handelt], sondern um die absichtliche Tötung eines Menschen.“127
Im Gegensatz zum Katechismus, der direkte Euthanasie undifferenziert als Lebensbeendigung bezeichnete, wird der Begriff direkt in der Charta mit der Intention verbunden, den Tod herbeizuführen. Das Begriffspaar aktiv oder passiv scheint jedoch nicht auf die Todesursache zu rekurrieren, sondern als Synonym für Handlung oder Unterlassung zu fungieren. Erneut fehlt eine Beschreibung dessen, was unter einer indirekten, aktiven oder passiven Euthanasie zu verstehen ist.
Die Verwendung des Euthanasiebegriffs durch das kirchliche Lehramt offenbart den Konsens, Euthanasie als Handlung oder Unterlassung zu verstehen, die der Natur nach oder intendiert den Tod herbeiführt. Die jüngeren Dokumente zeugen von weiteren Differenzierungen, die vor allem die intendierte Tötung näher spezifizieren und als Euthanasie im eigentlichen Sinn oder direkte Euthanasie bezeichnen. Um ferner zu bestimmen, welche Handlungen bzw. Unterlassungen, die den Tod zwar nicht intendieren, diesen aber ihrer Natur nach herbeiführen ebenso zur Kategorie der Euthanasie (im uneigentlichen Sinn) zu rechnen sind, enthalten alle benannten Dokumente separate Abhandlungen über die Anwendung therapeutischer Mittel sowie die Kriterien zur Unterscheidung ihres ethisch verpflichtenden Charakters.
Anwendung therapeutischer Mittel
Das kirchliche Lehramt nannte ihre Reflexion über Abbruch bzw. Verzicht medizinischer Therapien und Interventionen und deren ethische Zulässigkeit Anwendung therapeutischer Mittel. Dahinter verbirgt sich die Frage nach dem Verpflichtungsgrad, alle von der Medizin bereitgestellten Therapien und Interventionen anzuwenden, mit denen das Leben unheilbar kranker Menschen nicht nur erhalten, sondern auch entschieden verlängert werden kann.128 Nach Ansicht von Papst Pius XII., der bereits 1957 zu dieser Thematik um Stellungnahme gebeten wurde, können über den moralischen Verpflichtungsgrad einer medizinischen Therapie keine allgemeinen Aussagen getroffen werden, da sich dieser nur vor dem Hintergrund einer ganz konkreten und einzigartigen krankheitsbedingten Lebenssituation in Würdigung der situativen Umstände, des absehbaren Aufwands der medizinischen Intervention und deren zu erwartenden Erfolgs bestimmen lasse. Der Papst unterschied zwei Kategorien von therapeutischen Maßnahmen, die üblichen und die unüblichen, indem er auf das Verhältnis von Aufwand und Ertrag eines therapeutischen Mittels für den Patienten rekurrierte. Ohne einer utilitaristischen Argumentation zu unterliegen, verknüpfte er mit der Kategorie der üblichen therapeutischen Mittel im Sinn eines würdevollen und ethisch vertretbaren Umgangs mit dem Geschenk des menschlichen Lebens eine moralische Verpflichtungskraft zu deren Anwendung, da sie den schwerkranken Menschen in seiner Situation nichts Außergewöhnliches aufbürden und ihr Ertrag gegenüber dem Aufwand mit den einhergehenden Belastungen überwiegen würde.129 Zeichnete sich aber ein Überhang der negativen Konsequenzen durch subjektive Einschätzung des Patienten oder mittels objektiver Kriterien seitens der Ärzte ab, sei die medizinische Intervention als unübliches therapeutisches Mittel zu kategorisieren, für deren Anwendung der Papst keine ethische Verpflichtung gegeben sah. Eine solche unübliche, da außergewöhnlich belastende Therapie konnte ethisch zulässig abgebrochen oder von vornherein auf sie verzichtet werden konnte, um in der Unausweichlichkeit des Todes das Anrecht auf ein würdevolles Sterben zu wahren und therapeutischen Übereifer zu vermeiden. Abbruch bzw. Verzicht von üblichen therapeutischen Mitteln auch bei fehlender Intention zur Herbeiführung des Todes wurden indes als ethisch unzulässig gewertet und als schwer sündhaft verurteilt. Die Schlussfolgerung, diese Art Handlung oder Unterlassung als (indirekte bzw. uneigentliche) Euthanasie zu bezeichnen, ist gemäß der lehramtlichen Terminologie zulässig und konsistent.
Diese päpstliche Unterscheidung innerhalb der Anwendung therapeutischer Mittel greifen die nachfolgenden lehramtlichen Schreiben auf: Usus remediorum therapeuticorum130, Les moyens thérapeutiques131, procédures médicales132, medicos interventus133 und i mezzi usati134. Gegenüber der oberbegrifflichen Kontinuität in den Dokumenten zeigt sich eine Diversität hinsichtlich der gebrauchten Adjektive zur näheren Beschreibung der Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Ertrag. Anstatt die therapeutischen Mittel wie Pius XII. in übliche und unübliche zu teilen oder auf ähnliche, in der klassischen Moraltheologie gebräuchliche Begriffe wie gewöhnliche und außergewöhnliche oder ordentliche und außerordentlich zu rekurrieren,135 verwendete die Glaubenskongregation in ihrer Erklärung von 1980 die Begriffe verhältnismäßige und unverhältnismäßige Mittel. Darin komme das Kriterium, mit dem sich der Verpflichtungscharakter der therapeutischen Maßnahme bestimmen lasse, besser zum Ausdruck.136 Die Verfasser des Katechismus legten bezüglich der Anwendung therapeutischer Maßnahmen lediglich fest, dass außerordentliche, d. h. zum erhofften Ergebnis in keinem Verhältnis stehende aufwendige und gefährliche medizinische Verfahren nicht ethisch verpflichtend anzuwenden seien, deren Gegenteil aber benannten sie eigens nicht.137 Johannes Paul II. verzichtete dann auf eine direkte Bezeichnung der beiden Kategorien und verwies auf das in der Literatur gebräuchliche Prinzip der Verhältnismäßigkeit als hermeneutischen Zugang zur Analyse der Lebenssituation des schwerkranken Menschen.
Hervorzuheben ist, dass gleichzeitig die Materie zur Bestimmung der Verhältnismäßigkeit unter Bezugnahme auf das Krankheitsbild und -stadium, die Belastbarkeit sowie die konkrete Lebenssituation des Kranken ebenso die individuelle Situation von dessen Familie und deren Strapazierfähigkeit erweitert wurde.138 Da das Prinzip der Verhältnismäßigkeit der therapeutischen Mittel von der Charta der im Gesundheitsdienst tätigen Personen rezipiert wurde,139 ist von einem neuen Sprachduktus zu sprechen.
Anwendung schmerzstillender Mittel
Neben der Euthanasie und der Anwendung therapeutischer Mittel behandeln die lehramtlichen Schreiben die Anwendung schmerzstillender Mittel besonders mit Blick auf die nicht intendierte, sondern als Begleiterscheinung der beabsichtigten Schmerzlinderung in Kauf genommene Lebensverkürzung. Schon 1980 hielt die Glaubenskongregation diesbezüglich fest, dass in diese Kategorie nur jene Handlungen fallen, bei denen
„der Tod keineswegs gewollt oder gesucht wird, auch wenn man aus einem vernünftigen Grund die Todesgefahr in Kauf nimmt; man beabsichtigt nur, die Schmerzen wirksam zu lindern, und verwendet dazu jene schmerzstillenden Mittel, die der ärztlichen Kunst zur Verfügung stehen.“140
Das kirchliche Lehramt gebraucht für solche schmerzlindernden Handlungen mit in Kauf genommener Beschleunigung des Todes oder des Todes selbst die Bezeichnung des Usus remediorum analgesicorum141, l’usage des analgésiques dans la phase terminale (Gebrauch von Schmerzmitteln in der Terminalphase)142, l’usage des analgésiques143, curae palliativae (palliative Behandlungsweisen)144 und l’uso degli analgesici nei malati terminali (Anwendung schmerzstillender Mittel)145. Es fällt auf, dass die Glaubenskongregation und der Katechismus allgemein auf die Anwendung schmerzstillender Mittel zu sprechen kommen, während sowohl der Päpstliche Rat Cor Unum und die Charta für die im Gesundheitsdienst Tätigen die Verwendung der Schmerzmittel speziell im Kontext der terminalen Phase ansetzen. Letzteres scheint auch auf die Ausführungen von Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Evangelium vitae zuzutreffen, da er die schmerzstillenden Maßnahmen unter dem Terminus Palliative Sorge zusammenfasst, die nachweislich die „umfassende Behandlung eines letztlich unheilbaren Zustandes“146 und die schmerzlindernde Versorgung unheilbar Schwerkranker und Sterbender bezeichnet. Im Kontext der Palliativmedizin, die „das Leiden im Endstadium der Krankheit erträglicher machen und gleichzeitig für den Patienten eine angemessene menschliche Begleitung gewährleisten sollen“147, benennt und thematisiert der Papst dann die „Anwendung der verschiedenen Schmerzlinderungs- und Beruhigungsmittel“148. Er hebt expressis verbis hervor, dass diese nicht unter den Euthanasiebegriff fallen.149
Zusammenfassung
Die Sichtung der lehramtlichen Dokumente, die seit 1980 der kirchlichen Lehre über Euthanasie und andere medizinische Handlungen am Lebensende gewidmet wurden, hat eine in sich nahezu konsistente Terminologie aufgezeigt. Eine inhaltliche und von der Grundbestimmung wenig abweichende Verwendung der Begriffe ist sowohl hinsichtlich der Anwendung schmerzstillender Mittel als auch der Anwendung therapeutischer Mittel mit dem hermeneutischen Kriterium des Prinzips der Verhältnismäßigkeit gegeben, sodass diese in der vorliegenden Studie verwendet wurden. Der Einfachheit und Eindeutigkeit halber wird aber nicht allgemein von Anwendung therapeutischer Mittel, sondern bezüglich der ethischen Zulässigkeit differenzierend von
- Abbruch bzw. Verzicht verhältnismäßiger therapeutischer Mittel (=AVvtM) sowie
- Abbruch bzw. Verzicht unverhältnismäßiger therapeutischer Mittel (=AVutM)
gesprochen. Für die Handlungen und Unterlassungen, die ihrer Natur oder der Intention nach den Tod herbeiführen, wird in Kohärenz mit der lehramtlichen Terminologie der Euthanasiebegriff ohne nähere Differenzierung in aktiv/passiv oder direkt/indirekt gebraucht. Folgende Argumente sprechen trotz der im deutschsprachigen Raum existierenden negativen Konnotation aufgrund der NS-Euthanasie für die Verwendung des Begriffs Euthanasie:
- Die katholische Kirche wird als global player nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern weltweit mit der Frage nach einem kirchlichen Begräbnis trotz Euthanasie konfrontiert. Demnach betreffen die Ergebnisse der vorliegenden Studie nicht nur die partikularkirchliche Ebene eines Sprachraums, sondern vor allem die Universalkirche. Sie bedürfen daher einer einheitlichen und konsentierten Terminologie.
- Der Euthanasiebegriff wird in den offiziellen deutschen Übersetzungen der lehramtlichen Dokumente verwendet wird.150
- Die deutschsprachigen Bischöfe verwenden den Terminus Euthanasie.151
Anhand der Analyse der lehramtlichen Terminologie konnte nicht vollends geklärt werden, ob der Abbruch bzw. Verzicht verhältnismäßiger und damit ethisch verpflichtend anzuwendender therapeutischer Mittel ohne intendierte Todesherbeiführung als Euthanasie im Sinn einer Handlung oder Unterlassung, die lediglich der Natur nach den Tod herbeiführt, gezählt wird. Dies wird im folgenden terminologischen Schema mit einem Fragezeichen ausgedrückt:
Die Unklarheit in der lehramtlichen Terminologie, die in der vorliegenden Studie übernommen wurde, fällt hinsichtlich der Frage nach einem kirchlichen Begräbnis für katholische Gläubige, die nach Vollzug von Euthanasie oder einer anderen medizinischen Intervention am Lebensende verstorben sind, nicht besonders ins Gewicht, da die Normen zur Begräbnisgewährung bzw. -verweigerung lediglich die Existenz einer offenkundigen Sünde fordern, diese aber nicht näher qualifizieren. Um die Unschärfe nicht kontinuierlich benennen zu müssen, werden beide Termini – Euthanasie und AVvtM – im Verlauf der Arbeit sowohl nebeneinander als auch eigenständig verwendet.
2.3. Konsequenzen für die kanonistische Betrachtung
Die terminologische Analyse hat aufgezeigt, dass sich die in der Gesellschaft und in den lehramtlichen Dokumenten verwendeten Begriffe inhaltlich und semantisch nicht decken. Damit sowohl der Patient und der Arzt einerseits als auch der schwerkranke Gläubige und dessen Seelsorger andererseits in einer konkreten lebensgeschichtlichen Situation von derselben medizinischen Handlung sprechen und sich verständigen können, bedarf es also einer Übersetzungsleistung, die die medizinischen Handlungen, die vorwiegend mit den gesellschaftlich akzeptierten Begriffen direkte aktive, indirekte aktive und passive Sterbehilfe kommuniziert werden, in das lehramtliche terminologische Cluster von Euthanasie, Anwendung therapeutischer Mittel und Anwendung schmerzstillender Mittel überführt. Durch diese Transferleistung wird Missverständnissen vorgebeugt und der kontextuelle wie semantische Rahmen geklärt.
Welche Komplikationen terminologische Divergenz und Ungenauigkeit hinsichtlich des vom Lehramt verwendeten Euthanasiebegriffs als intendierte oder naturimmanente Herbeiführung des Todes durch eine Handlung oder Unterlassung mit Blick auf den ethisch unzulässigen AVvtM mit sich bringen, zeigt sich deutlich am eingangs benannten Fall des ALS-Patienten Welby. Dessen Wunsch nach Abbruch künstlicher Beatmung sowie künstlicher Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr wurde weltweit als Form der passiven Sterbehilfe wahrgenommen. Dass auch die kirchliche Autorität nicht vor „Übersetzungsfehlern“ gefeit ist, zeigt der Umstand, dass die vollzogenen Handlungen zum einen in der gesellschaftlichen Terminologie fälschlicherweise als aktive Sterbehilfe bezeichnet und zum anderen im Sinn eines Abbruchs verhältnismäßiger therapeutischer Maßnahmen als Euthanasie im lehramtlichen Verständnis übersetzt wurden, obwohl der Patient nicht aufgrund der Handlung bzw. Unterlassung, sondern aufgrund der Krankheit verstarb.152
Der Seelsorger vor Ort bzw. derjenige, der über die Gewährung oder Verweigerung des kirchlichen Begräbnis entscheidet, steht also vor der Herausforderung, zunächst die einem konkreten Einzelfall zugrunde liegende Handlung sowie ihre rechtlichen und medizinischen Implikationen präzise zu erfassen. In einem zweiten Schritt muss der Frage nachgegangen werden, ob die Handlung die Zustimmung des schwerkranken und sterbenden Menschen gefunden hat. Nur vor diesem Hintergrund kann eine entsprechende medizinische Handlung oder Unterlassung, die den Tod intendiert oder das Sterben aus kirchlich ethischer Perspektive unzulässig herbeigeführt hat, als subjektiv schuldhaft verstanden werden und kirchenrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Aufgrund der vom staatlichen und kirchlichen Gesetzgeber geforderten freiverantworteten und freiwilligen Entscheidung können demnach als Objekt der vorliegenden Studie nur folgende im Schema hervorgehobenen Handlungen gelten:
Als drittes gilt es, die medizinische Intervention, die zumeist mit gesellschaftlich akzeptierten Begriffen bezeichnet werden, in das kirchliche Begriffskonzept zu transferieren. Erst auf dieser Basis kann die vollzogene Handlung aus ethischer Perspektive beurteilt werden. Wird der konkrete Einzelfall betrachtet, ergeben sich daraus für die Anwendung des kirchlichen Rechts unterschiedliche Voraussetzungen, die letztlich für die Gewährung oder Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses entscheidend sind. Folgendes Schaubild soll die Transferleistung verdeutlichen:
Schließlich, in einem vierten Schritt, kann und muss der Seelsorger anhand der gewonnenen Erkenntnisse über die Art der Handlung und deren ethischen Gehalt vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Rechtsinterpretation, der Analyse des konkreten Sachverhalts und der lebensgeschichtlichen Situation des Verstorbenen in den Entscheidungsprozess übergehen, in dessen Rahmen das Recht angewendet wird.
1 Die Notwendigkeit einer solchen terminologischen Klärung zeigt die oftmals undifferenzierte Verwendung der Begriffe Selbstmord, Freitod, Suizid und Selbsttötung. Beispielsweise wird in der dritten Auflage des LThK unter den Artikeln Selbstmord, Selbsttötung und Freitod lediglich auf den Artikel Suizid verwiesen und alle drei Begriffe als gleichwertig betrachtet. [Vgl. A. Eser, Art. Suizid. I. Anthropologisch. II. Rechtlich, in: LThK 9 (32000) 1105-1106; A. Holderegger, Art. Suizid. III. Theologischethisch, in: LThK 9 (320 00) 1106-1108.] Der Begriff Selbstmord brachte über viele Jahrhunderte das Verständnis zum Ausdruck, dass jemand an sich selbst einen Mord, d. h. eine aufgrund von niedereren Beweggründen, vorsätzlich gewalttätige und daher unrechtmäßige Tötung menschlichen Lebens beging. In gegenwärtiger Verwendung ist diese normative Konnotation jedoch in den Hintergrund getreten. [Vgl. Bauer/Fartacek u.a., Suizid, 17.] Der Terminus Freitod hingegen entstammt dem Gedankengut der Aufklärung und verkörpert die absolute, auch über das Ende des eigenen Lebens bestimmende Freiheit des Menschen. [D. v. Engelhardt, Die Beurteilung des Suizids im Wandel der Geschichte, in: K. W. Schmidt/G. Wolfslast (Hg.), Suizid und Suizidversuch. Ethische und Rechtliche Herausforderung im klinischen Alltag, Stuttgart 2005, 11-26, 22.] Der neutral wirkende Terminus Suizid suggeriert aufgrund des lateinischen Bezugs eine gewisse Sachlichkeit und Wertfreiheit, obwohl er letztlich eine direkte Übersetzung des Begriffs Selbstmord ins Lateinische ist. [Vgl. K.-P. Jörns, Nicht leben und nicht sterben können. Suizidgefährdung. Suche nach dem Leben, Göttingen 1979, 21.]. Der Begriff Selbsttötung verweist als „nicht durch moralisches Vorverständnis und normatives Urteil a priori“ [Lenzen, Selbsttötung, 15.] wertbesetzter Begriff auf den Handlungscharakter, die Prozesshaftigkeit und Zeitlichkeit des Geschehens hin und expliziert die Rückbezogenheit der Aktion und die Spaltung des Handelnden in Subjekt und Objekt. Aufgrund der disparaten ethischen Konnotation wird in der vorliegenden Studie, sofern notwendig, von Suizid oder Selbsttötung gesprochen. In direkten Zitaten werden die Begriffe allerdings unverändert wiedergegeben, um die Variation der verschiedenen Bedeutungen im zeitgeschichtlichen Kontext zum Ausdruck zu bringen und „die Begriffe dynamisch in ihrem jeweiligen Bedeutungskontext und Diskussionszusammenhang zu verstehen und zu benutzen.“ [Ebd., 16.]
2 Zur Begriffsentwicklung und -verwendung in der Antike siehe Benzenhöfer, Der gute Tod?, 11-36; V. Zimmermann, Die ‚Heiligkeit des Lebens’. Geschichte der Euthanasie in Grundzügen, in: A. Frewer/C. Eickhoff (Hg.), ‚Euthanasie’ und die aktuelle Sterbehilfe-Debatte. Die historischen Hintergründe medizinischer Ethik, Frankfurt/Main 2000, 27-45, 27-29; Zimmermann-Acklin, Euthanasie, 21-29; Frieß, Sterbehilfe, 17-18; Oduncu, In Würde sterben, 23-26; V. Eid, Geschichtliche Aspekte des Euthanasieproblems, in: V. Eid (Hg.), Euthanasie oder Soll man auf Verlangen töten? (Moraltheologie interdisziplinär), Mainz 21985, 12-24, 13-15; Schockenhoff, Sterbehilfe, 50.
3 Vgl. Benzenhöfer, Der gute Tod?, 13; Oduncu, In Würde sterben, 23.
4 Vgl. Oduncu, In Würde sterben, 24.
5 Posidipps Verständnis ist kongruent mit dem von Kratinos und Menandros. [Vgl. Benzenhöfer, Der gute Tod?, 13; Eid, Aspekte, 13.]
6 Vgl. T. Potthoff, Euthanasie in der Antike. Diss. med, Münster 1982, 15. Belege für die weitere Verwendung des Euthanasiebegriffs als Ausdruck eines würdigen und rechten Todes finden sich u.a. in den Werken des Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.). Vgl. M. T. Cicero, Atticus-Briefe: lateinischdeutsch. Hrsg. und über. von Helmut Kasten (Sammlung Tusculum), München 41990, 1068.
7 Vgl. F. Josephus, Des Flavius Josephus Jüdische Altertümer. Übers. und mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Heinrich Clementz, Wiesbaden 111993, 557-558.
8 Vgl. C. Suetonius Tranquillus, De vita Caesarum/Die Kaiserviten. De viris illustribus/Berühmte Männer: lateinisch-deutsch. Hrsg. und übers. von Hans Martinet (Sammlung Tusculum), Düsseldorf 32006, 313.
9 J.-P. Wils, Ars moriendi. Über das Sterben, Frankfurt/Main 2007, 24.
10 Vgl. P. Ariès, Geschichte des Todes, München 122002, 136.
11 Wils, Ars moriendi, 24.
12 Zum Euthanasiebegriff in der Renaissance siehe Benzenhöfer, Der gute Tod?, 11-36; Zimmermann, ‚Heiligkeit des Lebens’, 27-29; Zimmermann-Acklin, Euthanasie, 21-29; Frieß, Sterbehilfe, 17-18; Oduncu, In Würde sterben, 23-26; Eid, Aspekte, 13-15; Schockenhoff, Sterbehilfe, 50.
13 Frieß, Sterbehilfe, 19. Weitere Literatur: Vgl. T. Morus, Utopia, Leuven 1516; Zimmermann-Acklin, Euthanasie, 35-38; Benzenhöfer, Der gute Tod?, 54-58.
14 „Ist aber die Krankheit nicht nur aussichtslos, sondern dazu noch dauernd schmerzhaft und qualvoll, dann geben die Priester und die Behörden dem Manne zu bedenken […]; da das Leben für ihn eine Qual sei, solle er nicht zögern zu sterben, sondern solle getrost und guter Hoffnung aus diesem unerfreulichen Dasein, diesem wahren Kerker und Foltergehäuse, sich entweder selber befreien oder andere ihn daraus entführen lassen“ [T. Morus, Utopia. Aus dem Lateinischen von Alfred Hartmann, Zürich 1981, 130-131.].
15 Vgl. J. Timmermann, Das Thema Sterbehilfe in Thomas Morus’ „Utopia“ (Medizinethische Materialien 85), Bochum 1993, 3.
16 Vgl. Benzenhöfer, Der gute Tod?, 59.
17 Vgl. F. Bacon, Über die Würde und die Förderung der Wissenschaften (London 1605/1623). Aus dem Englischen übertragen von Jutta Schlösser. Hrsg. von Hermann Klenner, Freiburg/Br. 2006, 236. (Kursivsetzung im Original nicht enthalten)]
18 Da diese medizinischen Entwicklungen begünstigt durch die Erfindung des Buchdrucks flächendeckend tradiert und rezipiert werden konnten, wurden sowohl das Entwicklungspotential, die Möglichkeiten und Grenzen der Medizin als auch die Aufgabe der Ärzteschaft mit zunehmendem medizinischen Fortschritt kritisch hinterfragt. [Vgl. W. U. Eckart, Geschichte der Medizin, Berlin 21994, 107-133.] Ein ähnliches Phänomen, dass Gedanken über Euthanasie oder Behandlungsabbruch bzw. -verzicht dann stark gemacht werden, wenn die Medizin einen Entwicklungssprung durchläuft, lässt sich auch für das 20. Jahrhundert mit seinem immensen medizinischen Fortschritt in den 1950/60er Jahren beobachten. Es scheint einen kausalen Zusammenhang zwischen dem medizinischen Fortschritt einerseits und dem Reflektieren über Anwendung und Abbruch entsprechender, neu entwickelter Methoden und Therapien andererseits zu geben.
19 Vgl. M. Alberti/Z. P. Schulz, Dissertatio inauguralis medica. De euthanasia medica. Vom leichten Todt, Halle/Madgeburg 1735, 11.
20 Vgl. Benzenhöfer, Der gute Tod?, 63.
21 Vgl. N. Paradys, Rede […] über das, was die Arzneywissenschaft vermag, den Tod leicht und schmerzlos zu machen, bey Gelegenheit seines Abschieds von dem akademischen Prorectorat gehalten den 8. Februar 1794. Aus dem Lateinischen übers. von Johann Georg Klees, in: Neues Magazin für Aerzte 18 (1796) 560-572, 561; J. C. Reil, Entwurf einer allgemeinen Therapie, Halle 1816, 573. Zum Verständnis der Euthanasie als Ausdruck einer palliativmedizinischen ärztlichen Sterbebegleitung erschienen in den Folgejahren allein in Deutschland über 15 medizinische Dissertationen. Siehe dazu in Auswahl K. F. H. Marx, De euthanasia medica prolusio. Dissertatio inauguralis medica, Göttingen 1826; F. Kessler, De euthanasia medica. Dissertatio inauguralis medica, Berlin 1828; L. Beschütz, De euthanasia medica. Dissertatio inauguralis medica, Berlin 1832; C. C. Salzmann, De euthanasia medica. Dissertatio inauguralis medica, Berlin 1835; J. Stubendorff, De euthanasia medica. Dissertatio inauguralis medica, Dorpat 1836; W. Schriever, De euthanasia. Dissertatio inauguralis medica, Berlin 1836; E. W. Schalle, De euthanasia medica. Dissertatio inauguralis medico-Philosophica, Leipzig 1839; C. Pfeiffer, De euthanasia medica. Dissertatio inauguralis medica, Berlin 1839; J. D. L. Jahn, De euthanasia. Dissertatio inauguralis medica, Kiel 1839; J. Goetz, De euthanasia, qualis medicorum est. Dissertatio inauguralis medica, Rostock 1841; W. Baltes, De euthanasia. Dissertatio inauguralis medica, Berlin 1842; F. T. Hauffe, De euthanasia. Dissertatio inauguralis medica, Würzburg 1843; H. Brockerhoff, De euthanasia medica. Dissertatio inauguralis medica, Berlin 1843; W. L. Ziemssen, De euthanasia medica. Dissertatio inauguralis medica, Greifswald 1845; R. Heinzelmann, De euthanasia medica. Dissertatio inauguralis medica, Berlin 1845; O. Hellwag, De euthanasia. Dissertatio inauguralis medica, Berlin 1845.
22 Es gab allerdings auch vereinzelte Positionen, die unter Euthanasie eine aktive Tötung auf Verlangen verstanden. Vgl. S. D. Williams, Euthanasia, in: Popular Science Monthly 3 (1873) 91-96, 91 zitiert nach E. J. Emanuel, The History of Euthanasia Debates in the United States and Britain, in: Ann Int Med 121 (1994) 793-802, 794.
23 C. Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection: or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, London 1859; C. Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. In two volumes, London 1871. Dt. Übersetzung: C. Darwin, Die Abstammung des Menschen. Übers. von Heinrich Schmidt. Mit einer Einführung von Christian Vogel, Stuttgart 1982.
24 N. Wolf, Entscheidungen über Leben und Tod. Vergleich der Entscheidungsfaktoren für die Positionierung gesellschaftlicher Akteure zu den Themen Sterbehilfe, Schwangerschaftsabbruch und Stammzellforschung, Hamburg 2014, 77.
25 Vgl. Benzenhöfer, Der gute Tod?, 69. Darwin selbst stand einer solchen Übertragung auf die Gattung Mensch eher skeptisch und weniger radikal gegenüber.
26 Die führenden Verfechter des Sozialdarwinismus waren Ernst Haeckel (1834-1919) und Alexander Tille (1866-1912), die grundlegende Konzepte zur Vermeidung der Vererbung von minderwertigem Genmaterial erarbeiteten. [Vgl. E. Haeckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Entwicklungstheorie im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck im Besonderen, über die Anwendung derselben auf den Ursprung des Menschen und andere damit zusammenhängende Grundlagen der Naturwissenschaft, Berlin 21870, 133-156; A. Tille, Von Darwin bis Nietzsche. Ein Buch Entwicklungsethik, Leipzig 1895.]
27 Unter Eugenik wird der im angelsächsischen Raum vertretene Ansatz von Francis Galton (1822-1911) verstanden, demnach die Verbreitung von schlechtem Erbgut mithilfe des konsequenten Austauschs durch gutes zu verhindern sei. [Vgl. F. Galton, Inquiries into Human Faculty and its Development (1883) (Classics in psychology: 1855-1914 19), Bristol 1998, 24-25.] Er unterschied positiv- und negativ-eugenische Maßnahmen. [Vgl. M. Vodopivec, Art. Eugenik, in: LThK 3 (21959) 1175-1178, 1175-1176; H.-W. Schmuhl, Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie. Von der Verhütung zur Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ (1890-1945), Göttingen 21992, 30.]
28 Das deutschsprachige Äquivalent zur Eugenik bezeichnete sich als Rassenhygiene. Ihr bekanntester Vertreter war der Nationalökonom und Arzt Alfred Ploetz (1860-1940), der ökonomisches und medizinisches Fachwissen verband und für die Initiation eines idealen Rassenprozesses warb. Vgl. A. Ploetz, Die Tüchtigkeit unserer Rasse und der Schutz der Schwachen, Berlin 1895, 147.
29 R. Gerkan, Euthanasie, in: Das monistische Jahrhundert 2 (1913) 170-172, 171. Signifikant ist, dass einerseits die Begriffe Sterbehilfe und Euthanasie als Synonyme verwendet wurden und andererseits kein Recht seitens des Staates, sondern der unheilbaren Kranken normiert werden sollte. Ob dieser Gesetzesvorschlag die Legalisierung von Sterbehilfe für unheilbar Kranke auf deren Wunsch oder aber die Legalisierung von Sterbehilfe an ihnen intendierte und damit eigentlich auf die Lockerung des seit Mitte des 19. Jahrhunderts existierenden Tötungsverbotes abzielte, ist unklar. Zu einer Gesetzesänderung kam es jedenfalls nicht.
30 Vgl. A. Jost, Das Recht auf den Tod. Sociale Studie, Göttingen 1895, 13.
31 Vgl. ebd.
32 E. Haeckel, Lebenswunder. Gemeinverständliche Studien über biologische Philosophie, Stuttgart 1904, 135.
33 K. Binding/A. Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Mass und ihre Form, Leipzig 1920. Eine ausführliche Kommentierung findet sich u. a. bei Zimmermann-Acklin, Euthanasie, 64-68.
34 Hans-Walther Schmuhl bezeichnete diesen Transfer als Sprung von der Ideengeschichte der Euthanasie zu ihrer Realgeschichte. [Vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, 127-354.]
35 Vgl. Binding/Hoche, Freigabe, 12.
36 Vgl. ebd., 17. Binding wehrte sich bewusst gegen den neu aufkommenden, aus seiner Sicht zweideutigen Sterbehilfebegriff, da es ihm einzig um die aktive Form der Lebensverkürzung durch Austausch der Todesursache, nicht aber Rückführung der Krankheit in den Urzustand ging. [Ebd., 16.]
37 Binding sprach sich damit für die Tötung „nicht nur absolut wertloser, sondern negativ zu wertender Existenzen“ [Ebd., 26-27.] aus.
38 Als Bedingung gab Binding an, dass jede unverbotene Tötungshandlung wenigstens „als Erlösung mindestens für ihn selbst empfunden werden [muss]: sonst verbietet sich die Freigabe von selbst“ [Ebd., 27.].
39 Eine Aussage Hitlers von 1929 lässt seine Ambitionen zur Stärkung der Rasse deutlich werden: „Würde Deutschland jährlich eine Million Kinder bekommen und 700 000 bis 800 000 der Schwächsten beseitigen, dann würde am Ende das Ergebnis vielleicht sogar eine Kräftesteigerung sein. Das Gefährlichste ist, daß wir selbst den natürlichen Ausleseprozeß abschneiden (durch Pflege der Kranken und Schwachen)“ [K. Nowak, „Euthanasie“ und Sterilisation im „Dritten Reich“. Die Konfrontation der evangelischen und katholischen Kirche mit dem Gesetz der Verhütung erbkranken Nachwuchses und der „Euthanasie“-Aktion, Göttingen 31984, 63-64.].
40 Vgl. Zimmermann-Acklin, Euthanasie, 64-66. Weiterführende Informationen siehe Frieß, Sterbehilfe, 26; Benzenhöfer, Der gute Tod?, 101-103; K.-P. Drechsel, Beurteilt – vermessen – ermordet. Die Praxis der Euthanasie bis zum Ende des deutschen Faschismus, Duisburg 1993, 35; E. Klee, „Euthanasie“ im NS-Staat. Die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“, Frankfurt/Main 31983.
41 Beispielhaft sei hier auf die Protestpredigten des Münsteraner Diözesanbischofs Clemens August Graf von Galen (1878-1946) verwiesen: C. A. v. Galen, Predigt am 3. August 1941, in: C. A. v. Galen, Akten, Briefe und Predigten: 1933-1946 / Bischof Clemens August Graf von Galen. Bearb. von Peter Löffler (VKZG: Reihe A, Quellen 42), Mainz 21996, 874-883. Vgl. diesbezüglich W. Süss, Ein Skandal im Sommer 1941. Reaktionen auf den „Euthanasie“-Protest des Bischofs von Münster, in: H. Wolf/T. Flammer u.a. (Hg.), Clemens August von Galen. Ein Kirchenfürst im Nationalsozialismus, Darmstadt 2007, 181-198.
42 Vgl. Klee, „Euthanasie“ im NS-Staat, 339.
43 Eid, Aspekte, 21.
44 Durch Gründung von Euthanasiegesellschaften wurde die wissenschaftliche Debatte um Tötung auf Verlangen institutionalisiert und deren Legalisierung gefordert. [Vgl. Emanuel, Euthanasia Debates, 796-797; Zimmermann-Acklin, Euthanasie, 71-73; G. Simon, Die Sterbehilfe-Bewegung. Entstehung, Entwicklung, Bedeutung und Aussichten, Erlangen-Nürnberg 1987, 94-95.]
45 Vgl. Frieß, Sterbehilfe, 32; Benzenhöfer, Der gute Tod?, 118, 125-128; Zimmermann-Acklin, Euthanasie, 73; H. Doucet, Der Beitrag der Theologie zur Euthanasiedebatte, in: A. Holderegger/D. Müller u.a. (Hg.), Theologie und biomedizinische Ethik. Grundlagen und Konkretionen, Fribourg 2002, 316-325; Emanuel, Euthanasia Debates, 797.
46 Während sich in Deutschland der Sterbehilfebegriff etablierte, wurde der Euthanasiebegriff international weiterhin verwendet (engl.: euthanasia, franz.: l‘euthanasie, span.: eutanasia, ital.: eutanasia, niederl.: euthanasie, pol.: eutanajza).
47 Die Unterscheidung in erste und zweite Nachkriegsphase geht zurück auf Schockenhoff, Sterbehilfe, 55-62.
48 Für eine differenziertere Betrachtung der medizinethischen Beiträge von Pius XII. siehe Punkt 4.2.1.
49 Vgl. Oduncu, In Würde sterben, 23; Borasio, Über das Sterben, 160; Zimmermann-Acklin, Euthanasie, 19.
50 Vgl. M. v. Lutterotti, Art. Sterbehilfe. I. Medizin, in: A. Eser/M. v. Lutterotti (Hg.), Lexikon Medizin, Ethik, Recht, Freiburg/Br. 1989, 1086-1095, 1086.
51 In den einschlägigen Lexika vor 1900 fehlt eine entsprechende Begriffsbestimmung von Sterbehilfe. [Vgl. F. Kaulen (Hg.), Brockhaus‘ Konversations-Lexikon 15: Social-Türken, Leipzig 141895, 325; H. J. Wetzer/B. Welte, Wetzer und Welte’s Kirchenlexikon oder Encyklopädie der katholischen Theologie und ihrer Hülfswissenschaften 11: Sculptur-Trient, Freiburg/Br. 21899, 780-781; J. Mayer (Hg.), Meyers Großes Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 18: Schöneberg-Sternbedeckung, Leipzig 61909, 942.]
52 Vgl. Zimmermann-Acklin, Euthanasie, 63.
53 Vgl. F. Mauthner, Gespräche im Himmel und andere Ketzereien, München 1914, 161.
54 J. Grimm/W. Grimm, Deutsches Wörterbuch 18 (Nachdruck München 1941), Leipzig 1991, 2408.
55 Einen ausführlichen Überblick der Sterbehilfediskussion in Deutschland ab 1945 bieten J. E. Lunshof/A. Simon, Die Diskussion um Sterbehilfe und Euthanasie in Deutschland von 1945 bis in die Gegenwart, in: A. Frewer/C. Eickhoff (Hg.), ‚Euthanasie’ und die aktuelle Sterbehilfe-Debatte, Frankurt/Main 2000, 237-249; T. Lohmann, Euthanasie in der Diskussion. Zu den Beiträgen aus Medizin und Theologie seit 1945, Düsseldorf 1975. Den Sterbehilfeterminus in die Nähe der Begleitung und des seelsorglichen Beistands von Kranken und Sterbenden stellte Lutterotti, Sterbehilfe, 1087.
56 Das langsame, aber kontinuierliche Ablösen des Euthanasiebegriffs durch den Sterbehilfebegriff lässt sich mithilfe der drei Auflagen des Lexikons für Theologie und Kirche veranschaulichen. Während in der ersten Auflage ein Artikel zum Begriff Sterbehilfe fehlt und zu diesem Stichwort lediglich ein Verweis auf den Artikel zu Euthanasie existiert [Vgl. M. Buchberger (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche 9, Freiburg/Br. 1937, 811.], wurden in der zweiten Auflage beide Begriffe behandelt. Dabei wurden unter Euthanasie alle aktiven Handlungen zur Tötung auf Verlangen zusammengefasst und Sterbehilfe vorwiegend als Schmerzenslinderung mit nichtintendierter tödlicher Nebenwirkung verstanden. [Vgl. W. Schöllgen, Art. Euthanasie, in: LThK 3 (21959) 1207-1208; H. Vorgrimler, Art. Sterbehilfe, in: LThK 9 (21964) 1053-1054, 1053-1054.] In der dritten Auflage zeigt sich durch den Verweis bei Euthanasie auf den Artikel zu Sterbehilfe wiederum eine einseitige Darstellung zugunsten des Sterbehilfebegriffs. [Vgl. W. Kasper/K. Baumgartner u.a. (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche 3, Freiburg/Br. 31995, 1019.]
57 Vgl. N. Hoerster, Sterbehilfe im säkularen Staat (stw 1377), Frankfurt/Main 22002, 7.
58 Vgl. U. Kämpfer, Die Selbstbestimmung Sterbewilliger. Sterbehilfe im deutschen und amerikanischen Verfassungsrecht (Schriften zum internationalen Recht 154), Berlin 2005, 35; K. Woellert/H.-P. Schmiedebach, Sterbehilfe, München 2008, 17.
59 Vgl. Kämpfer, Selbstbestimmung, 36. Die Zeit der voranschreitenden aber noch nicht lebensbedrohlichen Krankheit wird Terminalphase genannt (Wochen und Monate vor dem Tod) und mündet dann in die Sterbe- bzw. Finalphase (letzten Stunden oder höchstens Tage des Lebens), wobei der Begriff Phase auch wahlweise durch Stadium ersetzt werden kann. [Vgl. G. Becker/C. Xander, Zur Erkennbarkeit des Beginns des Sterbeprozesses, in: G. D. Borasio/F.-J. Bormann (Hg.), Sterben. Dimensionen eines anthropologischen Grundphänomens, Berlin 2012, 116-136, 128-131; G. D. Borasio, Palliativmedizin – weit mehr als nur Schmerztherapie, in: ZME 52 (2006) 215-223, 218.
60 Zur philosophischen Unterscheidung von Sterben, Sterbeprozess und Tod siehe G. D. Borasio/F.-J. Bormann (Hg.), Sterben. Dimensionen eines anthropologischen Grundphänomens, Berlin 2012.
61 Vertreter sind u.a. D. Birnbacher, Tun und Unterlassen, Stuttgart 1995, 338; Oduncu, In Würde sterben, 26; Borasio, Über das Sterben, 160.
62 Der Erfurter Moraltheologe Josef Römelt spricht beispielsweise sowohl von aktiver Sterbehilfe [Vgl. Römelt, Sterben, 7, 21, 33, 35, 37, 39.] als auch in gleicher Weise von aktiver Euthanasie [Vgl. ebd., 7, 8, 19, 21, 23, 24, 28- 32, 40- 45, 48; Römelt, Christliche Ethik/II, 289-294.].
63 Vgl. Zimmermann-Acklin, Euthanasie, 154; Benzenhöfer, Der gute Tod?, 63; Schlögel/Hoffmann, Passive und aktive Sterbehilfe, 89; Oduncu, In Würde sterben, 21, 23.
64 Vgl. Frieß, Sterbehilfe, 33.
65 Vgl. J. Baumann (Hg.), Alternativentwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe (AE-Sterbehilfe). Entwurf eines Arbeitskreises von Professoren des Strafrechts und der Medizin sowie ihrer Mitarbeiter, Stuttgart 1986.
66 Vgl. Bundesärztekammer, Grundsätze zur ärztlichen Sterbebegleitung (1998), in: DÄ 95 (1998) A2366-A2367; Bundesärztekammer, Grundsätze zur ärztlichen Sterbebegleitung (2004), in: DÄ 101 (2004) A1298-A1299; Bundesärztekammer, Grundsätze zur ärztlichen Sterbebegleitung (2011), in: DÄ 108 (2011) A346-A348. Dieser Forderung schloss sich mit Gian Domenico Borasio einer der bekanntesten Palliativmediziner Europas an. Er schlug Tötung auf Verlangen für aktive, Nichteinleitung oder Nichtfortführung lebenserhaltender Maßnahmen für passive sowie zulässige Leidenslinderung bei Gefahr der Lebensverkürzung für indirekte Sterbehilfe vor. [Vgl. G. D. Borasio, Der assistierte Tod aus palliativmedizinischer Sicht, in: ZME 55 (2009) 235-242, 235; Borasio, Über das Sterben, 168.]
67 Nationaler Ethikrat, Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende. Stellungnahme, Berlin 2006, 53. (Kursivsetzung im Original nicht enthalten)
68 Vgl. C. Roxin, Zur strafrechtlichen Beurteilung der Sterbehilfe, in: C. Roxin/U. Schroth (Hg.), Medizinstrafrecht. Im Spannungsfeld von Medizin, Ethik und Strafrecht, Stuttgart 2001, 87-112, 87.
69 Vgl. T. Verrel, Patientenautonomie und Strafrecht bei der Sterbebegleitung. Gutachten C für den 66. Deutschen Juristentag, München 2006, 60-62; A. Simon/T. Verrel, Patientenverfügungen. Rechtliche und ethische Aspekte (Ethik in den Biowissenschaften – Sachstandsberichte des DRZE 11), Freiburg/Br. 2010. Eigene, von der klassischen Dreiteilung abweichende Definitions- und Unterscheidungsvorschläge geben F.-J. Bormann, Töten oder Sterbenlassen? Zur bleibenden Bedeutung der Aktiv-Passiv-Unterscheidung in der Euthanasiediskussion, in: ThPh 76 (2001) 63-99; Schlögel/Hoffmann, Passive und aktive Sterbehilfe.
70 Der englische Begriff euthanasia steht hier stellvertretend für die Verwendung des Wortes in anderen Ländern und Sprachen. Wird im Folgenden nur noch der Sterbehilfebegriff verwendet, so ist die internationale Verwendung des Euthanasiebegriffs als impliziert enthalten zu betrachten.
71 Ein weiteres Differenzierungskonzept, auf welches hier nicht näher eingegangen wird, liefert Martin Frieß. Er unterscheidet zwischen fünf Formen (aktive, passive, indirekte Sterbehilfe, assistierter Suizid, Palliativmedizin), drei Arten (freiwillige, nichtfreiwillige, unfreiwillige Sterbehilfe) und zwei Situationen (terminale, finale Phase). [Vgl. Frieß, Sterbehilfe, 12-29; Frieß, ‚Komm süßer Tod’, 33-63.] Die terminologische Unterscheidung zwischen Formen und Arten ist sehr irreführend, zumal diese in der eingesehenen Literatur nicht einheitlich verwendet wird. So gebraucht Barbara Häcker den Begriff Arten für jene Unterscheidung in aktiv, passiv und indirekt, die Frieß mit Formen bezeichnet. [Vgl. Häcker, Die ethischen Probleme der Sterbehilfe, 24.]
72 Vgl. Punkt 2.1.2.
73 Vgl. Eid, Aspekte, 23-24.
74 Verallgemeinernde Aussagen wie folgende, dass aktive Sterbehilfe „das über die Beendigung einer medizinischen Behandlung hinausgehende aktive Handeln Dritter [ist], das gezielt, kausal und unmittelbar zu einer Lebensbeendigung führt, z. B. eine tödliche Injektion durch den Arzt“ [Kämpfer, Selbstbestimmung, 37.], würde nach vorliegendem Verständnis eine Verkürzung des Sachverhalts darstellen.
75 Eid ordnete die indirekte Sterbehilfe jedoch der passiven zu. [Vgl. Eid, Aspekte, 23-24.]
76 Borasio stellt zu Recht fest, dass in manchen Situationen statt Lebensverlängerung eigentlich Sterbeverlängerung betrieben wird. [Vgl. G. D. Borasio, Wann dürfen Menschen sterben?, in: ÖR 56 (2007) 248-251, 248.]
77 Zur Debatte über die Existenz eines natürlichen Todes siehe F.-J. Bormann, Ist die Vorstellung eines ‚natürlichen Todes’ noch zeitgemäß? Moraltheologische Überlegungen zu einem umstrittenen Begriff, in: G. D. Borasio/F.-J. Bormann (Hg.), Sterben. Dimensionen eines anthropologischen Grundphänomens, Berlin 2012, 325-350; J. Schuster, Der Tod aus theologischer Sicht, in: V. Schumpelick (Hg.), Klinische Sterbehilfe und Menschenwürde. Ein deutsch-niederländischer Dialog. Akten des Symposiums vom 5.-8. Oktober 2002 in Cadenabbia, Freiburg/Br. 2003, 35-40.
78 Vgl. Römelt, Christliche Ethik/II, 291; Kämpfer, Selbstbestimmung, 37. Der Arzt und Medizinethiker Jochen Vollmann sieht die Gefahr, dass diese terminologischen Unklarheiten im medizinischen Alltag zu großer Verunsicherung beim medizinischen Personal darüber führen, welche medizinischen Handlungen nach juristischen Kriterien erlaubt sind. Vor allem die Konnotation von physischem Tun mit aktiver Sterbehilfe führe in der Praxis dazu, dass Behandlungsabbruch als aktive Sterbehilfe missverstanden wird, obwohl dieser eigentlich dem Bereich der passiven Sterbehilfe zuzurechnen sei. [Vgl. J. Vollmann, Sterbebegleitung (Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2), Berlin 2001, 7.] Ähnliches vermuten auch Vollmann und Borasio. [Vgl. G. D. Borasio/B. Weltermann u.a., Einstellungen zur Patientenbetreuung in der letzten Lebensphase. Eine Umfrage bei neurologischen Chefärzten, in: Der Nervenarzt 75 (2004) 1187-1193; Vollmann, Sterbebegleitung, 7.]
79 Vgl. Borasio, Über das Sterben, 163.
80 Siehe diesbezüglich Bundesärztekammer, Grundsätze zur ärztlichen Sterbebegleitung (2011), A364. Wie notwendig eine Differenzierung zwischen der pflichtgemäßen Basisversorgung und der therapeutischen Behandlung des Patienten ist, zeigt die folgenschwere Gleichsetzung des Stillens von Hunger und Durst mit der künstlichen Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr. Während Hunger und Durst von Sterbenden bereits durch die Befeuchtung der Mundschleimhäute mittels eines Eiswürfels oder geringer Tropfen Wasser gestillt werden können, ist die künstliche Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr für den sterbenden und alten Menschen nicht nur sehr beschwerlich, sondern zusätzlich kontraproduktiv. [Vgl. Borasio, Über das Sterben, 108-114; G. D. Borasio, Ernährung und Flüssigkeit am Lebensende aus palliativmedizinischer Sicht, in: G. D. Borasio/F.-J. Bormann (Hg.), Sterben. Dimensionen eines anthropologischen Grundphänomens, Berlin 2012, 150-158; G. D. Borasio, Medizinischer Kommentar zum Fallbericht, in: ZME 55 (2009) 426-429.]
81 Vgl. Woellert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 18.
82 Thomas geht in seiner Summa theologica der Frage nach, ob es im Rahmen der Selbstverteidigung jemandem erlaubt sei, einen anderen zu töten. Seiner Argumentation zufolge stehe der Tatsache „nichts im Wege, daß ein und dieselbe Handlung zwei Wirkungen hat, von denen nur die eine beabsichtigt ist, während die andere außerhalb der Absicht liegt. Die sittlichen Handlungen aber empfangen ihre Eigenart von dem, was beabsichtigt ist, nicht aber von dem, was außerhalb der Absicht liegt, da es zufällig ist […]. So kann auch aus der Handlung dessen, der sich selbst verteidigt, eine doppelte Wirkung folgen: die eine ist die Rettung des eigenen Lebens; die andere ist die Tötung des Angreifers. Eine solche Handlung hat auf Grund der Absicht, die auf die Rettung des eigenen Lebens geht, nichts Unerlaubtes“ [Thomas von Aquin, Summa theologica, II-II, 57-79: Recht und Gerechtigkeit, in: Albertus-Magnus-Akademie (Hg.), Die deutsche Thomas-Ausgabe. Vollständige, ungekürzte deutsch-lateinische Ausgabe der Summa theologica 18, Heidelberg 1953, q. 64, a. 7.].
83 Vgl. Thiele, Aktive Sterbehilfe, 17. Eine ausführliche Darstellung bietet Häcker, Die ethischen Probleme der Sterbehilfe, 54-59.
84 Vgl. Borasio, Über das Sterben, 165. Er beruft sich neben persönlicher Erfahrung auf eine Studie der englischen Palliativmediziner Nigel Sykes und Andrew Thorns aus dem Jahr 2003, die nach Analyse von 3000 Fällen aufzeigen konnten, dass die hohe Dosierung von starken Schmerzmitteln wie Opioiden oder Sedativa in der letzten Lebensphase keine Lebensverkürzung nach sich zog. Stattdessen sei es aufgrund der medizinisch indizierten Sedierung sogar zu einer lebensverlängernden Wirkung gekommen. [Vgl. N. Sykes/A. Thorns, The Use of Opioids and Sedatives at the End of Life, in: LO 4 (2003) 312-318, 317.]
85 Diese Dreiteilung geht auf den Philosophen und Ethiker Peter Singer und seine Differenzierung in voluntary, involuntary und nonvoluntary zurück. [Vgl. P. Singer, Practical ethics, New York 32011.] Die Unterscheidung in freiwillige, unfreiwillige und nichtfreiwillige Sterbehilfe verwenden u.a. Zimmermann-Acklin, Euthanasie, 105-106; Häcker, Die ethischen Probleme der Sterbehilfe, 25-26; P. Foot, Euthanasie, in: A. Leist (Hg.), Um Leben und Tod. Moralische Probleme bei Abtreibung, künstlicher Befruchtung, Euthanasie und Selbstmord, Frankfurt/Main 1990, 285-317, 306-308; Thiele, Aktive Sterbehilfe, 23-24; Birnbacher, Tun und Unterlassen, 362-363; Frieß, ‚Komm süßer Tod’, 37-43; Woellert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 23, 31.
86 Vgl. Frieß, Sterbehilfe, 23. Zur Debatte der Freiheit einer entsprechenden Willensentscheidung siehe Punkt 4.2.2.
87 Vgl. Thiele, Aktive Sterbehilfe, 20; Frieß, Sterbehilfe, 25. Diese ist als (fahrlässige) Tötung eines einwilligungsfähigen Patienten zu qualifizieren. [Vgl. Woellert/Schmiedebach, Sterbehilfe, 34-35; Frieß, Sterbehilfe, 41.]
88 Vgl. Thiele, Aktive Sterbehilfe, 20; Häcker, Die ethischen Probleme der Sterbehilfe, 26.
89 Ein Patient ist nur dann einwilligungsfähig, wenn er die Bedeutung, den Umfang, die Tragweite und die Folgen eines geplanten Behandlungseingriffs geistig erfassen kann, zu diesem mit dem geforderten Urteils- und Einsichtsvermögens Stellung nimmt und seinen eigenen Willen bestimmt. [Vgl. D. Griesen, Art. Einwilligung, in: LBE 1 (2000) 539-543, 540.]
90 Zur Bestimmung des mutmaßlichen Willens anhand früherer Aussagen des Patienten gegenüber Familienangehörigen, Freunden, Ärzten, Pflegern und/oder Betreuern siehe u. a. G. D. Borasio/H.-J. Heßler u.a., Patientenverfügungsgesetz. Umsetzung in der klinischen Praxis, in: DÄ 106 (2009) A1952-A1957; M. Parzeller/M. Wenk u.a., Aufklärung und Einwilligung bei ärztlichen Eingriffen, in: DÄ 104 (2007) A576-A586; A. May, Autonomie und Fremdbestimmung bei medizinischen Entscheidungen für Nichteinwilligungsfähige (Ethik in der Praxis. Studien 1), Münster 22001.
91 Vgl. Häcker, Die ethischen Probleme der Sterbehilfe, 28.
92 Andere Kombination wie (ärztliche) Suizidbeihilfe, Beihilfe zur Selbsttötung, assistierter Suizid lassen sich finden unter Verrel, Patientenautonomie und Strafrecht bei der Sterbebegleitung, 17-20; Hillebrand, Ethische Aspekte der Sterbehilfe, 127; Nationaler Ethikrat, Selbstbestimmung, 55; Frieß, Sterbehilfe, 14. Zur Diskussion, ob Ärzte beim Suizid helfen dürfen, siehe G. Klinkhammer, Darf ein Arzt beim Sterben helfen? Medizinethiker, Ärzte, Juristen und Vertreter der Ärztekammern nehmen teilweise konträre Positionen ein, in: DÄ 110 (2013) A500-A501; E. Richter-Kuhlmann, Sterbehilfe. Gesetz liegt voerst auf Eis, in: DÄ 110 (2013) A112; E. Richter-Kuhlmann, Assistierter Suizid. Dissens um die Arztrolle, in: DÄ 109 (2012) A1970; F. S. Oduncu/G. Hohendorf, Die ethische Verantwortung des Arztes, in: DÄ 108 (2011) A1362-A1364; V. Lipp/A. Simon, Beihilfe zum Suizid. Keine ärztliche Aufgabe, in: DÄ 108 (2011) A212-A216.
93 Vgl. Birnbacher, Tun und Unterlassen, 339. Zur Verfahrensweise von (ärztlich) assistiertem Suizid siehe die Beschreibung der Arbeitsweise der Schweizer Sterbehilfeorganisation EXIT in Punkt 3.1.3.
94 Vgl. Grimm, Rechtliche Aspekte der Sterbehilfe, 26. Solange die Tatherrschaft beim Suizidanten liegt, ist es nach juristischen Gesichtspunkten sogar irrelevant, in welcher Beziehung sich die außenstehende Person zum Sterbewilligen befindet. Zur Straffreiheit von Suizidbeihilfe siehe Benzenhöfer, Der gute Tod?, 179-181; Oduncu, In Würde sterben, 42-44; Bauer/Fartacek u.a., Suizid, 136-141; Grimm, Rechtliche Aspekte der Sterbehilfe, 51-54; C. Paterson, Assisted Suicide and Euthanasia. A Natural Law Ethics Approach, Hampshire 2008, 26; 103-128; Frieß, ‚Komm süßer Tod’, 61-63; Kämpfer, Selbstbestimmung, 39-40.
95 Zur ethischen Beurteilung der jeweiligen Handlungen durch die katholische Kirche siehe Punkt 4.2.
96 Der vom kirchlichen Lehramt genutzte lateinische Begriff euthanasia wird im Folgenden direkt mit Euthanasie widergegeben. Sofern nicht explizit von NS-Euthanasie gesprochen wird, ist der Begriff Euthanasie ausschließlich als Herbeiführung des Todes zum Erlös von Schmerzen durch Handlung oder Unterlassung im Sinn des kirchlichen Lehramtes zu verstehen.
97 Zu den Ausführungen von Pius XII. siehe Punkt 4.1.
98 Zimmermann-Acklin, Euthanasie, 74.
99 Vgl. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio de euthanasia Iura et bona (05.05.1980), in: AAS 72 (1980) 542-552. Dt. Übersetzung: Heilige Kongregation für die Glaubenslehre, Erklärung Iura et bona zur Euthanasie (VApS 20), Bonn 1980. Auch abgedruckt in: Heilige Kongregation für die Glaubenslehre, Ethische Grundsätze über Euthanasie. Eine Erklärung der Heiligen Glaubenskongregation, in: HerKorr 34 (1980) 451-454. (Im Folgenden wird die Erklärung in der Übersetzung der Deutschen Bischofskonferenz (=DBK) unter Verwendung der Initialen IB und mit Angabe der Abschnittsnummer zitiert.)
100 Vgl. IB Einleitung.
101 Vgl. Conseil Pontifical Cor Unum, Document Dans le cadre. Quelques questions d’éthique relatives aux grands malades et aux mourants (27.06.1981), Cité du Vatican 1981. Auch abgedruckt in: Conseil Pontifical Cor Unum, Document Dans le cadre. Quelques questions d’éthique relatives aux grands malades et aux mourants (27.06.1981), in: EnchVat 7 (1982) 1132-1173. Inhalt des Dokuments waren die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Tagung im Jahr 1976 für ausgewählte Theologen, Ärzte, Mitglieder von Ordensinstituten, Krankenpfleger und Seelsorger. Ihre Aufgabe bestand darin, ethische Fragen in Bezug auf schwerkranke und sterbende Menschen zu reflektieren, die zu beachtenden lehramtlichen Grundlagen zu analysieren und praktische Antworten auf Fragen der Pastorale und der Betreuung von Sterbenden zu geben. [Vgl. ebd., Nr. 1237.]
102 Vgl. L’Église catholique, Catéchisme de l’Église catholique, Paris 1992. Dt. Übersetzung: Ecclesia Catholica, Katechismus der Katholischen Kirche, München 1993. (Im Folgenden wird aus dem französischen Originaltext und aus der deutschen Übersetzung unter Verwendung der Initialen CÉC bzw. KKK und Angabe der Abschnittsnummer zitiert.) Weiterführende Literatur zur Entstehungsgeschichte, Promulgation und Verbindlichkeit des Katechismus’ siehe M. Simon, Le ‚Catéchisme de l’Église catholique’. De Vatican II à Jean-Paul II, in: RTL 32 (2001) 3-23, 18-21; U. Ruh, Warum nicht? Der „Weltkatechismus“ und das Latein in der Kirche, in: HerKorr 51 (1997) 545-546; R. J. Barrett, The Normative Status of the Catechism, in: PerCan 85 (1996) 9-34; H. Vorgrimler, Der „Katechismus der Katholischen Kirche“ in der Perspektive systematischer Theologie. Einblicke in eine Diskussion, in: ThRv 91 (1995) 3-8, 4; U. Ruh, Der Weltkatechismus. Anspruch und Grenzen, Freiburg/Br. 1993, 45-57; M. Simon, Un catéchisme universel pour l’Église catholique. Du concile de Trente à nos jours, Löwen 1992.
103 Vgl. Ioannes Paulus PP. II., Constitutio apostolica Fidei depositum (11.10.1992), in: AAS 86 (1994) 113-118, 4. Dt. Übersetzung: Johannes Paul II., Apostolische Konstitution Fidei depositum (11.10.1992), in: Ecclesia Catholica, Katechismus der Katholischen Kirche, München 1993, 29-35, 4.
104 Vgl. Ioannes Paulus PP. II., Litterae encyclicae Evangelium vitae (25.03.1995), in: AAS 87 (1995) 401-522. Dt. Übersetzung: Johannes Paul II., Enzyklika Evangelium vitae an die Bischöfe, Priester und Diakone, die Ordensleute und Laien sowie an alle Menschen guten Willens über den Wert und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens (VApS 120), Bonn 1995. (Im Folgenden wird die Enzyklika in der Übersetzung der DBK unter Verwendung der Initialen EV und Angabe der Abschnittsnummer zitiert.)
105 Vgl. Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari, Carta degli Operatori Sanitari, Città del Vaticano 1995. Dt. Übersetzung: Päpstlicher Rat für die Seelsorge im Krankendienst, Charta der im Gesundheitsdienst tätigen Personen, Vatikanstadt 1995. (Im Folgenden wird die Charta unter Verwendung des Kurztitels Charta und Angabe der Abschnittsnummer zitiert.)
106 Vgl. EV 3.
107 Die Charta erhebt an sich selbst den Anspruch, eine „organische und erschöpfende Synthese der Haltung der Kirche zu allem zu bieten, was auf dem Gebiet des Gesundheitswesens die Beteuerung des vorrangigen und absoluten Wertes des Lebens betrifft: des ganzen Lebens und des Lebens jedes einzelnen Menschen.“ [F. Angelini, Vorwort, in: Päpstlicher Rat für die Seelsorge im Krankendienst, Charta der im Gesundheitsdienst tätigen Personen, Vatikanstadt 1995, 5-6, 6.] Sie gibt einen „Pflichtencodex für die Ärzte und das im Krankendienst tätige Personal“ [Ebd., 5.] und ist zur Grundausbildung und Weiterbildung der im Krankendienst tätigen Personen gedacht.
108 Vgl. ebd.
109 Vgl. Punkt 5.2.
110 IB 2. Siehe auch: „Historiquement et étymologiquement, le mot ‘euthanasie’ signifie ‘une mort paisible et sans douleurs’. Dans l‘usage courant contemporain, le mot connote un acte ou une omission vivant à abréger le vie du patient.“ [Conseil Pontifical Cor Unum, Document Dans le cadre, Nr. 1253.].
111 IB 2. Im lat. Original: „Nomine euthanasiae significatur actio vel omissio quae suapte natura vel consilio mentis mortem affert, ut hoc modo omnis dolor removeatur. Euthanasia igitur in voluntatis proposito et in procedendi rationibus, quae adhibentur, continetur.“ [Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio de euthanasia Iura et bona, 546.]
112 Götz, Medizinische Ethik, 267. Hingegen dem lehramtlichen Verständnis ist der Moraltheologe Karl-Heinz Peschke der Auffassung, dass gerade diese Unterscheidung zwischen aktiver Tötung und passivem Verzicht als lebenserhaltende bzw. -verlängernde Maßnahmen für die sittliche Bewertung grundlegend ist. [Vgl. K.-H. Peschke, Christliche Ethik. Spezielle Moraltheologie, Trier 1995, 344.]
113 EV 64.
114 Vgl. Punkt 4.2.3.
115 Vgl. „Cette acception commune ne va pas sans entraîner dans le débats sur l’euthanasie une confusion notable qu’il est urgent de dissiper.“ [Conseil Pontifical Cor Unum, Document Dans le cadre, Nr. 1253.].
116 Vgl. ebd., Nr. 1254.
117 Vgl. IB 2.
118 Vgl. Conseil Pontifical Cor Unum, Document Dans le cadre, Nr. 1253.
119 Vgl. „Quels qu’en soient les motifs et les moyens, l’euthanasie directe consiste à mettre fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes.“ [CÉC 2277.]
120 Vgl. KKK 2277.
121 Vgl. „Hisce in rerum adiunctis magis ac magis alliciuntur homines ad euthanasiam, ut morte videlicet dominentur in antecessum inducenda morte sicque suae vel alienae vitae ‚dulciter’ imponendo finem.“ [EV 64.]
122 Vgl. „Sub nomine euthanasiae vero proprioque sensu accipitur actio vel omissio quae suapte natura et consilio mentis mortem affert ut hoc modo omnis dolor removeatur. ‘Euthanasia igitur in voluntatis proposito et procedendi rationibus, quae adhibentur, continetur’.“ [EV 65.]
123 Die Verbindung der beiden Kriterien der Natur nach und Intention durch das Bindewort et lässt keine andere Interpretation zu. Zudem gibt es aber auch keine intendierten Tötungshandlungen, ohne dass die angewandte Methode nicht auch gleichzeitig aus ihrer Natur heraus zum Tod führen würde.
124 EV 65.
125 Vgl. „La pietà suscitata dal dolore e dalla sofferenza verso malati terminali, bambini anormali, malati mentali, anzianti, persone affette da mali inguaribili, non autorizza nessuna eutanasia diretta, attiva o passiva.“ [Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari, Carta, Nr. 147.]
126 Angelini, Vorwort, 6.
127 Charta 147.
128 Vgl. IB 4; EV 65.
129 Vgl. Pius PP. XII., Allocutio Adstantibus multis honorabilibus Viris ac praeclaris Medicis et Studiosis, quorum plerique Nosocomiis praesunt vel in magnis Lyceis docent, qui Romam convenerant invitatu et arcessitu Instituti Genetici „Gregorio Mendel“, Summus Pontifex propositis quaesitis de „reanimatione“ respondit (24.11.1957), in: AAS 49 (1957) 1027-1033, 1031-1032. Dt. Übersetzung: A.-F. Utz/J.-F. Groner (Hg.), Aufbau und Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens. Soziale Summe Pius XII. Bd. III, Freiburg/Schweiz 1961, Nrn. 5538-5554, Nr. 5544. (Im Folgenden wird bei erstmaliger Nennung die vollständige Literaturangabe mit Abschnittsnummer und im weiteren Verlauf unter Verwendung der Initialen UG und Angabe der Abschnittsnummer zitiert.) Als Synonyme für übliche und unübliche therapeutische Mittel sind die Unterscheidungen in gewöhnliche und ungewöhnliche sowie in ordentliche und außerordentliche zu sehen. Einen ausführlichen Überblick über die Begriffsgenese bietet Bender, Verhältnismäßigkeit, 33-57.
130 Vgl. IB 4.
131 Vgl. Conseil Pontifical Cor Unum, Document Dans le cadre, Nr. 1248.
132 Vgl. CÉC 2278.
133 Vgl. EV 65.
134 Vgl. Charta 120.
135 Vgl. IB 4. Zwar enthält das vom Päpstlichen Rat Cor Unum 1981 veröffentlichte Arbeitsdokument noch die Unterscheidung in Anwendung gewöhnlicher und außergewöhnlicher therapeutischer Maßnahmen. Dies ist aber darauf zurückzuführen, dass es bereits 1976 erstellt wurde. [Vgl. Conseil Pontifical Cor Unum, Document Dans le cadre, Nr. 1248.] Eventuell hat die Glaubenskongregation das Arbeitsdokument studiert und rezipiert.
136 Vgl. IB 4.
137 Vgl. ebd.
138 Vgl. EV 65. Diese terminologische Sprachänderung bezeichnete der Moraltheologe Klaus Demmer (1931-2014) als stillschweigenden Paradigmenwechsel, weil eine Verschiebung des Blickwinkels von den objektiven Kriterien hin zur subjektiv einzuschätzenden Situation des Patienten und dessen Wohl zum Ausdruck kommt. [Vgl. K. Demmer, Leben in Menschenhand. Grundlagen des bioethischen Gesprächs (SThE 23), Freiburg 1987, 146.]
139 Vgl. Charta 65, 120.
140 IB 3.
141 Vgl. IB 3.
142 Vgl. Conseil Pontifical Cor Unum, Document Dans le cadre, Nr. 1256.
143 Vgl. CÉC 2279.
144 Vgl. EV 65.
145 Vgl. Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari, Carta, Nrn. 122-123.
146 H. Pichlmaier, Art. Palliative Therapie. 1. Zum Problemstand, in: LBE 2 (2000) 818-819, 818.
147 EV 65.
148 Ebd.
149 Vgl. ebd.
150 Vgl. KKK 2277; EV 65.
151 Vgl. Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland / Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Sterbebegleitung statt aktiver Sterbehilfe. Eine Sammlung kirchlicher Texte (GT 17), Bonn 22011, 9; Die deutschen Bischöfe, Menschenwürdig sterben und christlich sterben (DB 17), Bonn 1978, 3; Die deutschen Bischöfe, Das Lebensrecht des Menschen und die Euthanasie (DB 4), Bonn 1975, 7; Die österreichischen Bischöfe, Leben in Fülle. Leitlinien für katholische Einrichtungen im Dienst der Gesundheitsfürsorge (Die österreichischen Bischöfe 6), Wien 2006, 22.
152 Vgl. Vicariato di Roma, Ufficio stampa e comunicazioni sociali (22. Dezember 2006), in: http://www.radioradicale.it/il-vicariato-di-roma-sospende-i-funerali-per-welby-cerimonia-laicadomenica-mattina (Zugriff: 16.04.2016).