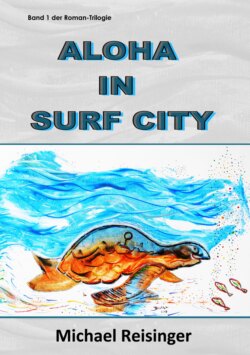Читать книгу Aloha in Surf City - Michael Reisinger - Страница 10
8
ОглавлениеRing, ring, ring. Joe kommt langsam zu Bewusstsein. Es ist dunkel um ihn herum. Orientierungslosigkeit lässt ihn rätseln, wo er gerade ist. Er fühlt sich schrecklich, sehr müde, hat pochendes Kopfweh und seine Kehle ist ausgetrocknet. Ring, ring, ring. Dieses verfluchte Geräusch. Klingt wie ein Telefon. Ring, ring, ring. Wie sein Telefon, um genau zu sein. Ring, ring, ring. Sein Telefon! Langsam kommt die Orientierung zurück; er ist in seinem Bett und das Geräusch ist sein Handy, das pausenlos klingelt. Ring, ring, ring. Ein kurzer Blick auf den Wecker, es ist 3 Uhr 15 morgens. Wer ruft denn um diese gottverlassene Zeit an? Schlaftrunken schaut er auf das Display.
Der Anrufer ist Mario. Joe hebt ab. „Hey Mario. Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Muss ich dich von der Polizeiwache holen, oder was?“ Kurzes Schweigen am anderen Ende der Leitung. Dann antwortet eine Frauenstimme: „Hier ist nicht Mario. Hier ist Lissy, seine Schwester.“ Schluchzen. Stille. Nochmaliges Schluchzen. Wieder Stille. Auf einmal schießt eine gehörige Menge Adrenalin in Joes Blut und erhöht die Geschwindigkeit von Ruhepuls in die Herzinfarktzone in weniger als einer Sekunde. Joe könnte kotzten, so schlecht ist ihm. Tausend Mal schon hat er sich vor diesem Moment gefürchtet. Er hat ihn in seinen Gedanken immer und immer wieder durchgespielt, hat versucht, sich darauf vorzubereiten. Doch jetzt wo der Moment gekommen ist, ist seine ganze Vorbereitung für den Arsch. Fassungslosigkeit und unkontrollierbare Angst haben Besitz über seinen Körper und seinen Geist erlangt. Am liebsten will er einfach nur laut losschreien. Trotzdem reißt er sich für einen flüchtigen Augenblick zusammen und antwortet: „Lissy! Was ist passiert?“ Wieder Stille.
Nach qualvollen Sekunden hat sich auch Lissy soweit gefangen, dass ihr Schluchzen zu einem Hintergrundwimmern reduziert wurde. Tapfer versucht sie das Gespräch fortzuführen: „Mario ist ins Koma gefallen.“ Oh Gott, ausgesprochen klingt es einfach nur noch grausamer. „Wo seid ihr? Ich meine, in welchem Krankenhaus?“ „Äh, äh, das im Zentrum, äh, Städtisches, glaub ich.“ Pause. Schniefen. „Ja, Städtisches Krankenhaus.“ „Ok. Ich bin sofort da.“ Joe hat nicht mal Lissys Antwort abgewartet, sondern sofort den roten Knopf gedrückt, um das Gespräch zu beenden. Für Höflichkeiten hat er jetzt keine Zeit. Sie wird es verstehen.
Er hat einen neuen Streckenrekord mit dem Fahrrad von seiner Wohnung ins Städtische Krankenhaus aufgestellt, dementsprechend verschwitzt und ausgelaugt kommt er auf der Intensivstation an. Aber sein Erscheinungsbild ist ihm gerade so etwas von scheißegal. Mario liegt hier irgendwo, unter ständiger Beobachtung und angeschlossen an diverse Maschinen, um sein Leben ringend. Joe muss ihn finden, muss so schnell wie möglich zu ihm, seinem Kumpel Beistand leisten. Er stürmt am Anmeldeschalter vorbei in Richtung großer Schwingtüre, wo der Patiententrakt liegt. Doch so weit kommt er dann doch nicht. Eine Schwester ist von ihrem Stuhl aufgesprungen und hat mit überraschender Schnelligkeit (man bedenke, dass es mittlerweile 4 Uhr morgens ist), sich zwischen Joe und die Tür gebracht. „Halt. Wo wollen Sie hin?“ „Ich will zu Mario. Mario Decampo. Er muss hier irgendwo liegen!“ „Und Sie sind?“ „Joe. Äh. Jonathan Korey. Sein bester Freund.“ „So leid es mir tut, Herr Korey. Aber zurzeit dürfen wir nur Familienmitgliedern von Herrn Decampo Zutritt zum Patiententrakt gewähren. Sie müssen leider hier draußen warten!“ „Aber, Aber… Ich muss zu ihm.“ Er will die Krankenschwester beiseiteschieben, doch diese ist robuster und stärker als erwartet. Resolut versperrt sie ihm weiterhin den Weg. „Hören Sie, Herr Korey. Herr Decampo braucht absolute Ruhe. Wie gesagt, Sie können hier draußen warten. Sollten Sie aber nicht kooperieren, werde ich den Sicherheitsdienst rufen und Sie bekommen Hausverbot für das ganze Gelände. Haben wir uns verstanden?“ Sie scheint Erfahrung mit solchen Dingen zu haben, ihrem souveränen Auftreten zu folgen.
Mit Joes Souveränität hingegen ist es vorbei. Er fängt an laut zu weinen. „Aber… Aber… Ich muss mich doch von ihm verabschieden…“ Jetzt schluchzt Joe hemmungslos und die Tränen stürzen in Bächen von seinen Wangen. Die Krankenschwester hat durch den Anblick des weinenden Joes ihre mütterliche Seite entdeckt und führt ihn mit sanftem Druck zu einem Wartebereich. Dort befördert sie den Wehrlosen gekonnt in einen der Stühle. Sie bringt ihm ein Glas Wasser und ein Taschentuch. „Hören Sie, Herr Korey. Ich werde Sie über alle Entwicklungen am Laufenden halten. Derweil versuchen Sie bitte, etwas Ruhe zu finden. Brauchen Sie eine Decke?“ Joe schüttelt schluchzend den Kopf.
Eine Woche ist vergangen seit Mario gestorben ist. Eine Woche, die kaum Platz in Joes Erinnerung gefunden hat. Nur wirr ineinander übergehende Bruchstücke von einigen wenigen Ereignissen, Emotionen, oder Gedanken haben sich den Weg in sein Gedächtnis gebahnt. Der große Rest der erlebten Zeit ist schon im Moment des Erlebens in einer bodenlosen Leere für immer verschwunden. Joe ist sehr dankbar für dieses Nichts, das ihn seit jener Nacht von Marios Tod umhüllt wie ein warmer Mantel in diesem kalten, endlosen Winter.
Heute ist der Tag von Marios Beerdigung. Joe steht in einem schwarzen Anzug vor dem Spiegel im Schlafzimmer und betrachtet sein Erscheinungsbild. Es ist, beschönigend ausgedrückt, einfach furchtbar. Warum Menschen, die Schicksalsschläge erlitten haben, immer so scheiße ausschauen müssen? Was sich die Natur wohl dabei gedacht hat? Andererseits, sein Erscheinungsbild ist ihm in diesem Moment auch einfach nur egal.
Das einzige was sein Gehirn seit einer Woche ein ums andere Mal in einer permanenten erdrückenden Endlosschleife durchkaut, ist die traurige Tatsache, dass er sich nicht mehr von Mario verabschieden konnte. Sein bester Freund wachte in jener Nacht nicht mehr auf. Irgendeine andere Dame vom Krankenhauspersonal (die erste Krankenschwester hatte er nach sieben Uhr morgens nie wieder gesehen) ist dann um neun Uhr zu ihm gekommen und hat ihm ihr herzliches Beileid ausgesprochen. Sie hat ihm auch den Wunsch von Marios Eltern übermittelt, nach Hause zu gehen und nicht mehr ins Krankenzimmer seines Freundes zu kommen. Anscheinend wollte die Familie den Moment seines Todes alleine verbringen.
Und so hat Joe nur noch eine Chance, seinen Freund im Hier und Jetzt zu sehen und das ist heute in der Aufbahrungshalle. Aber ehrlich gesagt hat er einfach keine Lust Mario, seinen wichtigsten Gefährten für solch lange Zeit, als leere menschliche Hülle zu sehen, die langsam ihren Weg des biologischen Zerfalls antritt.
Eine Frage zermartert sein Hirn und sorgt für pochendes Kopfweh. Warum ist er an jenem verdammten Vormittag damals nicht ans Telefon gegangen? Er hätte wissen müssen, dass es mit Mario bald zu Ende sein kann. Da muss man doch jede Gelegenheit der Interaktion nützen, oder? Und nicht, nur weil man schlecht drauf ist, den todkranken Kumpel ignorieren. Oh Mann, Joe hasst sich in diesem Moment, wie er noch nie etwas in seinem ganzen Leben gehasst hat. Ja, schon gut, es war ein scheiß Tag, er hatte seine Freundin und seinen Job verloren. Und sicher, beides am gleichen Tag, nicht mal vierundzwanzig Stunden davor, das war schon hart. Aber es ging um Mario. Es ging um den Menschen, der ihm am wichtigsten ist… war… ist… war. Und jetzt… schluchz… jetzt ist… schluchz… ist der auch weg. Jetzt hat Joe alles verloren.
Er will losweinen, aber er kann nicht. Nicht mehr. So oft hat er in den letzten Tagen geweint, dass es keine einzige Träne mehr in seinem Körper zu geben scheint. Und so entrinnt seiner Kehle nur ein heiseres, kraftloses Schluchzen, leise und kontinuierlich, schmerzlich und unangenehm, nicht unähnlich Schluckauf. Seine Mutter betritt das Schlafzimmer. Es ist Zeit zum Friedhof zu fahren. Sie hat sich extra einen Tag frei genommen, um ihm beizustehen und seine willenlose menschliche Hülle durch die Zeremonie zu manövrieren. Er ist ihr so dankbar, denn selbstständig könnte er gerade nicht mal die zehn Meter vom Schlafzimmer in die Küche schaffen.
Eine Stunde später steht Joe vor Marios geöffnetem Sarg in der Aufbahrungshalle. Der kalte Winter findet seinen Weg durch die große Eingangstüre herein in diesen schlichten, für Joes Geschmack zu klinisch eingerichteten Raum und duelliert sich mit den angestammten Kühltemperaturen des Leichenhauses, wer denn nun die eisiger Stimmung verbreiten kann. Immer wenn die Tür nach draußen aufgeht, bringt ein neuer Trauergast mit einem kalten Schwall auch das tiefe Grau des Winterhimmels mit, das nur Augenblicke später seine Aufnahme in die grauen Betonwänden der Halle erfährt. Ein perfektes Abbild des Todes. So kalt. So grau. So leblos.
Und inmitten dieser Tristesse liegt Mario in einem Eichensarg. Er hat seinen Sonntagsanzug an. Denjenigen, den er schon seit der Pubertät besaß und denn er seitdem nur angezogen hat, wenn er seiner Mutter bei irgendwelchen superwichtigen Festakten einen Gefallen tun wollte, weil er darin ja so weltmännisch ausgesehen habe. Mario selber war ja eigentlich kein besonderer Fan dieses Anzugs. Und dennoch findet Joe es klasse, dass Mario nun wieder diesen Anzug an hat. Immerhin eine winzig kleine Aufmerksamkeit für dessen Mutter. Joe blickt kurz zu seiner eigenen, die ein paar Meter hinter ihm steht und ihn mitleidig betrachtet. Es muss hart für eine Mutter sein, ihren eigenen Sohn begraben zu müssen.
Joe seufzt schwer. Dann konzentriert er sich wieder auf seine Mission – einen würdigen Abschied von Mario zu nehmen. Er betrachtet den Leichnam seines besten Freundes. Marios Gesicht ist fahl und eingefallen. Der Körper hat einen seltsamen Grauton angenommen, der sich fast schon wieder dekorativ mit dem Grauton der Betonwände und des Winterhimmels abstimmt. Das war eh ein großes Talent von Mario, immer den richtigen Stil für jede Gelegenheit zu finden. Er war ein Player und ein verdammt smoother dazu. Joe denkt an all die Abenteuer seiner Jugend, die Mario eingeleitet hat, all die schönen Frauen, die dieser angequatscht hat (er selber hätte nie den Mut dazu gehabt), all die wilden Verrücktheiten, die immer zu großer Erheiterung geführt haben. Selbst bei Joe, obwohl er eher der Introvertierte ist und normalerweise sehr ordnungsliebend. Marios ständiges Brechen von Regeln hat ihm immer erst ziemlich auf den Magen geschlagen. Doch wenn der erste Ärger verflogen war und wenn Joe Zeit bekommen hatte, sich an die Situation zu gewöhnen, hat er diese Aktivitäten seines Freundes sehr genossen. Immerhin standen sie für Lebendigkeit, für Spannung und für großes Abenteuer. All das ist jetzt einfach durch Nichts abgelöst worden. Joe wird es auf einmal schwarz vor dem Augen. Er muss würgen und es wird ihm furchtbar schlecht. Akuter Kreislaufkollaps!
„Lass uns gehen. Bitte!“ Joe signalisiert seiner Mutter, dass er genug hat. Er kann dieser Zeremonie nicht weiter beiwohnen. All das ist zu viel für ihn. Er hat einfach keine Kraft mehr zuzusehen, wie sein Freund unter die Erde gebracht wird, wie irgendein Pfarrer irgendwelche klugen Worte spricht, die mehr den Nichttrauernden als den Trauernden helfen können, wie nachher sich die Gemeinde zum Leichenschmaus versammelt, um den Tratsch der letzten Woche zu aktualisieren.
Nein, er will einfach nur noch alleine sein. Zuhause, in seinem Bett, mit der Decke über den Kopf. Gott sei Dank versteht seine Mutter ihn ohne irgendwie groß nachzufragen und wenig später sitzen die beiden im Auto auf dem Nachhauseweg. Die letzten klaren Gedanken an diesem Tag drehen sich um Joes Traumwelt. Es wird ihm auf einmal schlagartig bewusst, dass er die letzte Woche rein gar nichts geträumt hat. Keine normalen Träume. Keine verschwommenen Träume. Und vor allem keine Träume, die mit seiner „Traumgeschichte über die Fembots“ zu tun haben. Joe hat aber grad nicht mal die Energie sich zu überlegen, ob er das nun gut oder schlecht finden soll. Stattdessen sehnt er sich nur nach dem Nichts zurück, diesen warmen Mantel, den er seit einer Woche bei jeder Gelegenheit übers Gesicht zieht.