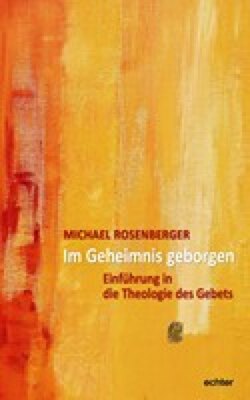Читать книгу Im Geheimnis geborgen - Michael Rosenberger - Страница 8
1.1 Die Fragestellung: Was heißt das eigentlich: Beten?
ОглавлениеWas heißt das eigentlich: Beten? Was tun Menschen, wenn sie von sich sagen, sie beteten? Dies ist letztlich die analytische Frage nach dem Begriff des Betens: Bedeutet Beten nur, sich selbst und sein Ego zu bespiegeln und die eigenen Gedanken durch die Adressierung an Gott aufzuwerten? Heißt es, die Kommunikation mit anderen Menschen einfach zu introvertieren und ins Innere der eigenen Psyche zu verlegen? Bedeutet Beten sich selbst zu beruhigen und Autosuggestion bzw. autogenes Training betreiben? Oder eher Träumen und sich nach und nach eine Traumwelt aufbauen, die einen den alltäglichen Sorgen entreißt? Ist Beten mithin das Einnehmen einer spirituellen Droge, die einen betäubt und den Alltag leichter ertragen lässt, wie das Karl Marx mit seiner These vom »Opium des Volks«1 nahelegte? Aber selbst wenn das Gebet auch all das ist – ist damit über das Gebet schon alles gesagt? Ist es nur das? Oder kommt noch ein Aspekt dazu, der jenseits all dieser Beschreibungen aus der Distanz der Perspektive des unbeteiligten Beobachters liegt?
Wenn das Gebet durch die Klärung dieser Fragen als Gegenstand klar bestimmt ist und die Mechanismen seiner Genese erhellt sind, ergibt sich eine Folgefrage: Was heißt das nun für das Wie des Betens, seine Zeiten und Orte, seine spezifische Sprache, seine Inhalte, den leiblichen Vollzug? Das ist die normative Frage nach der angemessenen Praxis des Gebets.
Beide Fragen werden in dieser Abhandlung theologisch und damit wissenschaftlich reflektiert. Es geht nicht um einen Exerzitienvortrag oder eine Predigt, auch nicht um einen erbaulichen Impuls für das persönliche geistliche Leben, sondern um eine sorgfältige und zugleich mühsame Reflexion. Die Theologie des Gebets fordert die Anstrengung des Begriffs. Sie muss sauber argumentieren, klar formulieren und präzisieren und im Widerstreit der Argumente pro und contra eine bestimmte Position plausibilisieren. Dabei steht sie im Dialog mit Glaubenden, Andersglaubenden und Nichtglaubenden. Auf der Basis vernünftigen Denkens tritt sie mit ihnen in einen Dialog. Paradoxerweise gibt es im deutschen Sprachraum eine im Curriculum des Theologiestudiums verankerte Pflichtvorlesung mit dem Thema »Theologie des Gebets«, wenn ich es richtig sehe, nur an vier theologischen Fakultäten: an der katholischen Fakultät in Linz sowie an den evangelischen Fakultäten in Bochum, Hamburg und Heidelberg. Selbst an den Päpstlichen Universitäten in Rom ist ein solcher Kurs nicht zu finden. Das gibt zu denken. Denn immerhin sind wir hier am Kern jeder Theologie. So sagt der Mönchsvater Evagrios Pontikos (346 Ibora, Pontos – 399 in den Kellia, Ägypten): »Wenn du Theologe bist, betest du wahrhaftig; wenn du wahrhaftig betest, bist du Theologe«2 (De oratione 60). Gebet ist also das Herz jeder Theologie, ihre Quelle und ihr Ziel. Eine Theologie, die sich nicht am Gebet orientiert und von ihm inspirieren lässt, bleibt seelenlos. Eine Theologie, die nicht auf ein je wahrhaftigeres, redlicheres und lebendigeres Beten zielt, dient zu nichts.