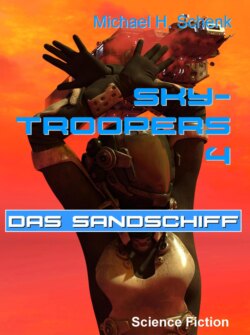Читать книгу Sky-Troopers 4 - Das Sandschiff - Michael Schenk - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
ОглавлениеSky-Troopers 4 ‒ Das Sandschiff
Science Fiction Roman
von
Michael H. Schenk
© M. Schenk 2014/2020
Saranvaal, das Sandschiff des Kapitäns Kane-Lano.
Kane-Lano liebte das Sandmeer.
Die Menschen in den Wasserstädten mochten seine unendlichen Weiten und Gefahren fürchten, doch für den Kapitän des Sandschiffes Saranvaal war das Meer des Sandes Lebensraum und Grundlage seines Lebensunterhaltes.
Das Auf und Ab der Dünen ähnelte den Wellen von Wasser, auch wenn hier die Farben Weiß, Gelb und Ocker vorherrschten. Gelegentlich waren die Konturen von Braunfelsen zu erkennen und in der Ferne ragten die schroffen Formen der Berge auf. Die Dünen wanderten und veränderten immer wieder den Anblick des Sandmeeres, und man brauchte einen fähigen Navigator, um sich in seiner Weite nicht zu verlieren.
Meist verursachte der Wind die einzige Bewegung, doch das Meer aus Sand war keineswegs leblos und die Besatzungen der Sandschiffe nicht seine einzigen Bewohner.
Am häufigsten waren die Plattensteher anzutreffen. Ihre Leiber waren extrem dünn und hoch, so dass die Tiere tatsächlich aufrecht stehenden Stahlplatten ähnelten. Die Natur hatte sie dergestalt geschaffen, damit sie ihre Körper stets so drehen konnten, dass sie der unbarmherzigen Sonne nur wenig Fläche darboten. Die Tiere standen auf sechzehn Beinen, mit denen sie einen seltsamen Tanz aufzuführen schienen. Die Hälfte der Beine war auf dem Boden, die andere leicht erhoben, damit diese auskühlen konnte. Dann folgte der Wechsel und die Plattensteher schienen beständig auf der Stelle zu tanzen. Doch diese stete Bewegung schützte sie davor, sich am heißen Sand die Füße zu verbrennen.
Für Kane-Lano und jene Menschen, die sich mit ihren Schiffen auf das Sandmeer hinauswagten, waren die Plattensteher die Grundlage ihrer Existenz. Nicht ihres Fleisches wegen. Man musste dem Hungertod schon sehr nahe sein, um eines der Tiere auf die persönliche Speisekarte zu setzen. Doch die Eigenheit der Tiere, die Füße vor der Hitze des Bodens schützen zu wollen, war ein wichtiges Kriterium für einen erfolgreichen Fang.
Tief im Sand verborgen lebten die großen Krebse. Mit ihren dick gepanzerten Leibern und Scheren gruben sie sich durch den Untergrund und schaufelten alles in sich hinein, was ihnen auf ihrem Weg begegnete. Ihr einzigartiges Verdauungssystem verarbeitete organische und mineralische Substanzen und tief unten im Sand gab es Schichten mit den Überresten der einst reichen Pflanzenwelt. Oft kamen die Krebse dabei dicht unter die Oberfläche und bewegten die obere Schicht des Sandmeeres. Sie förderten die tieferen und kühleren Schichten nach oben. Die Bewegung war mit bloßem Auge kaum zu sehen, doch die Plattensteher spürten die leichteste Bewegung im Boden, die sie veranlasste, sofort diese kühleren Sandbereiche aufzusuchen. Wer einen Krebs erlegen wollte, der hielt nach den Plattenstehern Ausschau und konzentrierte seine Aufmerksamkeit auf jene Bereiche, in denen sie ihren „Tanz“ aufführten. Mit etwas Glück und Geduld passte man jene Augenblicke ab, in denen ein Sandkrebs zum Luftholen durch die Oberfläche brach. Bei dieser Gelegenheit spuckte er auch jene unverdaulichen Dinge aus, die er bei seiner Nahrungssuche aufgenommen hatte. So gab es zwei Dinge, die einem Sandschiff-Kapitän Erfolg verhießen: die Bewegung eines Rudels von Plattenstehern und das Spucken eines Krebses.
Krebse waren in vielerlei Hinsicht wertvoll. Ihr Fleisch war schmackhaft, ihre Panzer waren in den Wasserstädten beliebt und ihre Körperflüssigkeit, das Krebsöl, war ein überragendes Gleit- und Schmiermittel. In ihren Mägen sammelten sich zudem wertvolle Mineralien und Kristalle an, die sie tief unter der Oberfläche in sich aufgenommen hatten. Die Krebse nutzten sie, um ihre Nahrung damit zu zerkleinern. Durch die stete Bewegung waren diese „Magensteine“ meist perfekt rund geschliffen.
Kane-Lano und seine Besatzung lebten von den Krebsen. Ihre Saranvaal war nicht das einzige Sandschiff, jedoch eines der erfolgreichsten.
Im Augenblick lag die Saranvaal vor Anker. Kapitän Kane-Lano hatte alle vier Pfahlanker in den Sand treiben lassen. Zwei zusätzliche Sandkrallen sollten ausschließen, dass das mächtige Sandschiff abtrieb. Die Saranvaal war beeindruckend und, auf ihre eigene Art, eine richtige Schönheit. Obwohl sie nie über eine Wasserfläche segeln würde, zeigte sie doch viel Ähnlichkeit mit einem Segelschiff. Der Rumpf ragte rund fünfzehn Meter auf und war fast fünfundsiebzig Meter lang. Unten, am Kiel, war er zehn Meter breit, am Oberdeck gute fünfzehn. Während das Heck stumpf und wie abgeschnitten wirkte, verjüngte sich der Bug oben und unten, so dass er ein wenig einer offenen Schere ähnelte. An der oberen Spitze befand sich die Plattform mit der Harpunenkanone, die untere Spitze wirkte wie ein Pflug, der den Sand zerteilte.
Der gesamte Rumpf bestand aus miteinander vernieteten Stahlplatten. Dem Stahl war ein Farbpigment beigefügt worden, so dass sich die Saranvaal kaum vom sandigen Untergrund abhob. Es gab nur wenige farbige Stellen am Schiff, denn Sand und Wind hätten jede diesbezügliche Bemühung rasch wieder zunichte gemacht.
Das Sandschiff ruhte auf den Kettengliedern einer gewaltigen Raupe, die sich über die fast gesamte Breite und Länge des Kiels erstreckte. Ihre Achsen waren mit dem seitlichen Rumpf verbunden. Die Konstruktion war zuverlässig, aber kaum gefedert, weswegen sich die Bewegung der Raupe auf das gesamte Schiff übertrug. Diese Raupe diente lediglich als Laufwerk und nicht als Antrieb. Wie alle Schiffe seiner Art verfügte die Saranvaal über zwei dampfbetriebene Schaufelräder an ihren Seiten sowie über drei hohe Masten, deren Segel den Wind einfingen und die Konstruktion zu einem schnellen Jäger machten. Im Augenblick waren die großen Segel jedoch eingeholt und an den ausladenden Rahen festgemacht.
Während der Ausguck oben im Hauptmast nach einem Krebs oder Gefahr Ausschau hielt, galt die Aufmerksamkeit der Besatzung zwei großen Braunfelsen, neben denen das Schiff ankerte. Braunfels war kostbar, denn alle Dampfmaschinen im Volk der Negaruyen wurden mit ihm oder Sonnenenergie betrieben. Für Kapitän Kane-Lano ein guter Grund, einen Teil des Braunfelsens abzubauen. Der zerkleinerte Fels würde die Brennstoffvorräte des Schiffes auffüllen und ließ sich in den Wasserstädten mit gutem Gewinn verkaufen.
Fast die gesamte Besatzung war dabei, die Felsen mit Hammer und Schlageisen zu zerkleinern. Eine mühselige Arbeit, vor allem bei der herrschenden Hitze. Das rhythmische Schlagen hatte ganze Scharen der Plattensteher angelockt, welche unsicher umhertanzten, da sie den Ursprung der Erschütterungen nicht zuordnen konnten. Hier war es das Werk der Negaruyen, welches sie anlockte, und nicht die Vibrationen eines wühlenden Krebses.
Der Kapitän war unruhig und schritt langsam auf dem Oberdeck auf und ab, während seine Blicke zwischen den Braunfelsen und dem Mastkorb des Ausgucks pendelten, der, gute vierzig Meter über dem Deck, nach möglichen Gefahren spähte.
Kane-Lano war ebenso beeindruckend wie sein Schiff. Seine Haut war von der Sonne gebräunt und, trotz seiner Jugend, von Sand und Wind gegerbt, so dass er älter wirkte. Folge eines Lebens, welches seit Kindesbeinen der Sandfahrt galt. Er trug das Haupthaar modisch lang und hatte es im Nacken zu einem Zopf geflochten. Sein besonderer Stolz waren die beiden Wangenbärte, die am Kinn in zwei handlangen Zöpfen endeten. Nur wer im Volk der Negaruyen den Doppelnamen eines Mannes vornehmer Herkunft trug, besaß das Recht zweier Bartzöpfe.
Der Kapitän trug die schlichte Kleidung eines Sandschiffers. Jacke und Hosen waren aus bunt gefärbtem Tuch, die grellroten Stiefel aus bestem Leder. Wurde das Wetter rau und der Wind stärker, würde ein lederner Übermantel vor dem Sand schützen, der einem die Haut vom Fleisch raspeln konnte.
Kane-Lano konzentrierte sich zunehmend auf das Tänzeln der Plattensteher. Gelegentlich zog er das kleine Teleskop aus der Jackentasche und setzte es an, um die Fußbewegungen der Tiere genauer sehen zu können.
Farrel-Tuso kam mit bedächtigen Schritten über das Deck heran. Der hagere Obermaat war der Stellvertreter des Kapitäns und spürte dessen Unruhe. „Was nicht in Ordnung, Käpt´n?“
Der Angesprochene leckte sich über die Lippen und schob das Teleskop wieder zusammen. „Ich weiß nicht, Farrel. Irgendetwas an den Tänzern erscheint mir ungewöhnlich.“
Farrel-Tuso war kein Adliger, gehörte als Obermaat allerdings zu den höher gestellten Persönlichkeiten in der Hierarchie des Volkes der Negaruyen. Als Zeichen seines Standes durfte er daher einen Kinnbart tragen und das geflochtene Zopfende war fast zwei Handspannen lang. Tuso starrte zu den Felsen und Tieren hinüber und strich unbewusst am Zopf des Bartes entlang. „Sie tanzen herum, Käpt´n. Ist kein Wunder. Jetzt zur Mittagssonne heizt sich der Sand besonders stark auf. Die Tiere haben nun einmal nicht unsere Stiefel“, fügte er scherzend hinzu.
Die Stiefel eines Sandschiffers waren eine Besonderheit. Ihre Sohlen waren fast zehn Zentimeter hoch und bestanden aus einer Mischung aus Stahlrippen und Lederwülsten, die eine gitterartige Struktur aufwiesen. Die Sohlen berührten den Untergrund nur mit einer recht kleinen Fläche und leiteten Hitze schnell ab.
Kane-Lano nickte zögernd. „Vielleicht hast du recht, Obermaat.“
„Ganz sicher, Käpt´n. Zudem sind die Biester es nicht gewohnt, dass unsere Leute auf die Braunfelsen einschlagen. Die glauben sicher, dass sich ein Krebs unter uns hindurch gräbt.“ Der Obermaat bemerkte den Blick seines Kapitäns und grinste breit. „Nein, Käpt´n, da ist kein Krebs in der Nähe. Du kennst Murna. Ihren Augen entgeht auch nicht das kleinste Anzeichen für einen guten Fang.“
Erneut sah Kane-Lano zum Ausguckkorb hinauf. „Du hast recht, Farrel. Kein Krebs würde ihr entgehen.“
Einem Matrosen hätte der Obermaat nun aufmunternd auf die Schulter geschlagen, doch bei einem Kapitän gebührte sich das nicht. „Glen-Tuso hat mich geschickt. Er verlangt nach dir.“
„Dann will sich dein Bruder wieder über die Maschine beschweren?“, knurrte Kane-Lano missmutig.
„Natürlich will er das.“ Der Obermaat stampfte zustimmend mit dem linken Fuß auf. „Als Obermaschinist ist das ja seine Aufgabe. Jetzt frag mich nicht nach seinem Begehr, Käpt´n. Vielleicht sind es die Ventile oder schlechter Braunstein, vielleicht ist eine Dampfleitung undicht oder ein Kolben hat sich festgefressen.“ Er lachte dröhnend. „Vielleicht ist ihm auch nur der Zwieback zu hart. Du weißt doch, ein Dampfschrauber findet immer einen Grund zur Klage.“
Der Kapitän sah zu den beiden dünnen Schornsteinen, die zwischen dem mittleren Hauptmast und dem Heckmast aus dem Oberdeck ragten. Rechts und links, an den Flanken des Rumpfes, ragten die riesigen Schaufelräder über die Reling empor. Zwischen diesen Schaufelrädern war an Deck der Ruderstand mit dem großen Steuerrad, Kompass und Sprachrohr zum Maschinenstand errichtet worden. Der Dampfantrieb war überlebenswichtig für ein Sandschiff. Die Maschinisten, nicht umsonst als Dampfschrauber bezeichnet, genossen einen besonderen Status an Bord, denn ein guter Fang gelang nur mit einem schnellen Schiff und die Saranvaal war unbestritten ein ausgezeichneter Jäger. „Also schön, Farrel, hören wir uns an, was dein Bruder zu sagen hat.“
Sie gingen gemächlich in Richtung eines der beiden Niedergänge, die unter das Deck führten und wichen dabei den wenigen Hindernissen aus. Es gab ein paar Gestelle mit ordentlich aufgeschossenen Leinen, Körbe mit Sammelnetzen und die beiden an Deck festgezurrten Beiboote. An Bug und Heck erhoben sich die einzigen Deckaufbauten: hinten das Lagerhaus, mit allen Hilfsmitteln, die man benötigte, um das Schiff für eine Sturmfahrt vorzubereiten oder Reparaturen vorzunehmen, und vorne der Verschlag mit Ersatzteilen und Projektilen für die Harpunenkanone. Diese beiden Aufbauten waren keilförmig. In Richtung auf den Bug flach, damit sie nur wenig Windwiderstand boten, und zum Heck hin breit und hoch, damit der Wind sie von hinten erfassen und der entstehende Druck als zusätzliche Antriebskraft genutzt werden konnte.
Der vordere Niedergang, wie man die Treppen an Bord eines Sandschiffes nannte, diente als Aufgang und lag zwischen den beiden Ankerwinden in der Nähe des Bugs. Diese waren massige und schwere Konstruktionen, die aus stählernen Zahnstangen, einer Kurbelübersetzung und einem Schlagkeil bestanden. Wurden die Anker eingeholt, so war es Schwerstarbeit, sie mit den Kurbeln und Zahnstangen aus dem sandigen Grund zu befreien und seitlich am Rumpf zu fixieren. Zum Herablassen reichte es hingegen aus, die Haltekeile mit ein paar kräftigen Schlägen aus dem Gewinde zu treiben. Den Rest erledigte das hohe Eigengewicht der Ankerpfähle.
Der hintere Niedergang, also die hinabführende Treppe, war im Gegensatz zum Aufgang als Rolltreppe konstruiert. Das Gewicht des Benutzers setzte die Stufen in Bewegung und drückte sie nach unten. Die daraus entstehende Kraft wurde durch eine simple Mechanik umgewandelt, welche jene Reinigungsbürsten unterstützte, mit denen man die Oberfläche der Glieder der Laufraupe provisorisch säuberte. Die Hauptarbeit musste per Hand von den Sandbürstern der Mannschaft geleistet werden. Deren Aufgabe war es, die Raupenglieder unermüdlich von Sand zu befreien, der die beweglichen Glieder sonst blockieren konnte.
Unter dem Oberdeck gab es zwei Decks. Das Mitteldeck erstreckte sich über die gesamte Länge des Schiffes und war in verschiedene Bereiche und Kammern unterteilt. Hier war der eigentliche Lebensraum der Besatzung, so eng dieser im Einzelfall auch sein mochte. Hinten im Heck lag die große Kapitänskajüte, davor die Kammern der Maate und des Obermaschinisten. Eine weitere Kammer war der Harpunierin Desara vorbehalten. Die übrigen Besatzungsangehörigen teilten sich die Mitte des Decks. Am Tag standen hier Tische und Bänke, die für die Nacht zur Seite gestellt wurden, damit es genug Raum für die Hängematten gab. Vorne im Bug befanden sich das Vorratslager und die Rüstkammer des Schiffes. Entlang des Decks zogen sich rechteckige Öffnungen, welche Luft und Licht hereinließen. Ihre Verschlussklappen waren mit einfachen Metallstreben versehen. Jetzt, da das Schiff stillstand, nutzte man die Möglichkeit, es zu durchlüften, denn es stank nach heißem Metall, Dichtungsmitteln, Schmierölen, Braunfels und Ausdünstungen der Besatzung. Nahm das Schiff hingegen Fahrt auf, musste man die Klappen meist schließen, damit der Fahrtwind nicht Unmengen von Sand hereinblies.
Sand war der Freund und zugleich Feind eines Sandschiffers. Er durchdrang nahezu jede Kleidung und jede Öffnung und setzte sich überall fest. Seine feinen Körner malträtierten die Haut, reizten die Augen und Atemwege und blockierten immer wieder bewegliche Teile des Schiffes, wenn sie nicht ausreichend mit Krebsöl geschützt waren. Ein Dutzend Männer war stets damit beschäftigt, dem eingedrungenen Sand mit Bürsten und Besen zu Leibe zu rücken.
Im Mitteldeck war leise Musik zu hören. Einer der Matrosen hatte wohl vergessen, sein Walzengerät abzustellen. Der Kasten wurde mit einem Federzug betrieben und in ihm rotierte eine mit Stiften besetzte Walze, die an einem metallenen Kamm entlangstrich. Auf diese Weise entstanden Töne, die sich zu einer Melodie zusammenfügten. Es gab viele Walzen für viele verschiedene Melodien, doch der Matrose der Saranvaal besaß bedauerlicherweise nur eine einzige und ihr Abspielen wurde kaum noch als Entspannung empfunden. Farrel-Tuso trat schweigend an den Walzenkasten und legte den Hebel um, der den Federmechanismus blockierte.
Der Weg von Kapitän und Obermaat führte weiter hinunter in das Unterdeck. Hier war der Boden in Längsrichtung offen, damit man die Glieder der Raupe säubern und schmieren konnte. Metallene Stege führten von einer Schiffsseite zur anderen. Im vorderen Drittel erhob sich die klobige Dampfmaschine mit ihrem Antriebsgestänge zu den außen liegenden Schaufelrädern. In der Mitte gab es die Bunker mit den Brennstoffvorräten. An Bug und Heck waren die Wassertanks installiert, deren Inhalt den Durst der Mannschaft und der Maschine stillte und für den richtigen Trimm des Schiffes sorgte, damit es gleichmäßig auf ebenem Kiel fuhr.
Hier unten, im Maschinendeck, war es drückend heiß. Wenn sich das Schiff bewegte, dann förderte die Bewegung der Laufraupe eine Menge Sand durch die offene Führungsrinne der Raupenglieder, daher gab es keine zusätzlichen Außenluken, durch die noch mehr Sand hätte eindringen können. Es gab nur dann einen kühlenden Luftstrom, wenn der Antrieb lief und ein Teil seiner Energie genutzt wurde, um Frischluft durch die Belüftungsrohre zu pumpen.
Obwohl Kane-Lano und Farrel-Tuso Hitze gewohnt waren, trieb ihnen die Schwüle des Maschinendecks sofort den Schweiß aus den Poren.
Der Kapitän nickte ein paar Sandbürstern zu, die unentwegt ihrer Arbeit nachgingen, und verharrte einen Moment, um zwei Maschinisten zuzusehen, welche die Raupenglieder schmierten. Es war eine ebenso erforderliche wie gefährliche Arbeit. Man konnte kein normales Öl oder Fett verwenden, um die Glieder gängig zu halten, denn diese wären mit dem Sand verklebt. Stattdessen wurde das Körperöl der Sandkrebse genutzt. Auf geheimnisvolle Weise besaß es eine abstoßende Wirkung auf den Sand. Die Bürster, die ansonsten jedes Korn von der Raupe entfernten, waren jetzt in die Führungsrinne hinabgestiegen, sicherten sich mit Leinen und pinselten das Öl auf alle beweglichen Metallteile. Die Saranvaal lag vor Anker und die Raupe war mit Keilen blockiert. Die kleinste Bewegung des Schiffes und damit der Raupenglieder hätte zu schweren Verletzungen oder dem Tod der Arbeiter führen können.
Obermaschinist Glen-Tuso erwartete sie mit einem seiner Dampfschrauber an der Dampfmaschine. Die Klappe der Feuerung war geöffnet und Glen-Tuso ließ Schlacke aus der Heizkammer entfernen. Er war ebenso hager wie sein Bruder und trug, wie alle hier unten, kaum mehr als eine lederne Schürze vor dem Bauch und die obligaten Schifferstiefel.
„Ah, Euer Ehrenwert gibt sich die Ehre“, grüßte Glen-Tuso seinen Kapitän mit der offiziellen Anrede, wie sie in den Wasserstädten üblich war. Hier an Bord grenzte dies fast an eine offene Beleidigung.
„Du vergisst dich, Bruder“, knurrte Farrel-Tuso. „Du sprichst mit dem Käpt´n.“
Der Heizer holte eine weitere Schaufel Schlacke aus der Befeuerung und wandte den Kopf zur Seite. Der Kapitän wusste, dass ihm dies signalisieren sollte, dass der Mann nichts gehört hatte. Für Kane-Lano ein untrügliches Zeichen, dass er nun erst recht reagieren musste. Er war bereit gewesen, über die Respektlosigkeit des Obermaschinisten hinwegzusehen, doch nun blieb ihm keine andere Wahl, als die Disziplin sofort wieder herzustellen.
„Dass du dem Ehrenwerten nach dem Maul redest, war mir klar“, fuhr Glen-Tuso seinen Bruder an. „Aber du bist der Obermaat und so ist das auch deine Aufgabe. Jeder hat ja seine Aufgabe, nicht wahr? Der Kapitän sorgt für uns, du treibst die Mannschaft an und ich wiederum die Maschine. So funktioniert das auf einem Sandschiff und das schon seit vielen Generationen. Aber bei dieser Fahrt hat unser ehrenwerter Kapitän bislang in leeren Sand gegriffen, nicht wahr? Unser Warenlager ist leer und unsere Vorratskammer leert sich ebenso wie mein Brennstofflager. Hätten wir die verdammten Braunfelsen nicht entdeckt, dann könnten wir in ein paar Tagen nur noch unter Segel fahren.“
„Die Brennstoffbunker sind leer?“ Im Gesicht des Obermaats zeigte sich Sorge und die beiden seitlichen Nickhäute unter den wimpernlosen Augenlidern schlossen sich kurz.
„Nun, die Braunfelsen werden sie wieder füllen“, antwortete der Obermaschinist und sah den Kapitän herausfordernd an. „Die Mannschaft wird aber kräftig auf sie einschlagen müssen, wenn wir ein paar Brocken über behalten wollen, um sie in der nächsten Wasserstadt zu verkaufen. Diese Fangfahrt ist bisher so gehaltvoll wie der Furz eines Sternenmenschen.“
Kane-Lano löste nun die kleine Neuro-Peitsche von seinem Gürtel und schaltete sie ein. Das helle Summen ließ den Obermaschinisten erstarren. „Ich rede dir nicht in deine Arbeit hinein, Dampfschrauber, halte dich also aus meiner heraus. Ein Sandschiffer braucht nicht nur Können, sondern immer auch ein wenig Jagdglück.“
„Fehlt es an Können oder Glück?“, entfuhr es Glen-Tuso und im nächsten Moment stieß er ein schmerzerfülltes Zischen aus, als die Neuro-Peitsche seine Wange streifte.
Der Heizer räusperte sich. „Ich muss mal nach den Dampfleitungen sehen. Ich glaube, da ist was undicht“, murmelte er und ließ die Schaufel fallen, um sich einen Lappen und einen Schrauber zu nehmen und zur anderen Seite der Maschine zu gehen.
Glen-Tuso starrte den Kapitän böse an. „Schön, das habe ich wohl verdient, aber das ändert nichts an den Tatsachen. Wir sind nun schon sechs Wochen auf Fahrt und haben nichts außer ein paar Brocken Braunfels vorzuweisen.“ Er rieb sich die Wange, die unter den Nachwirkungen des elektrischen Schlages zuckte, und deutete mit der anderen zum Heck. „Wir werden auch bald wieder Wasser brauchen, großer Kapitän. Der hintere Tank ist zu zwei Dritteln geleert.“
Der Mann sagte die Wahrheit, dennoch war der Kapitän versucht, die Peitsche erneut einzusetzen. Leider war Glen-Tuso ein ausgezeichneter Maschinist und kaum zu ersetzen. Es gab eine ganze Reihe von Maschinisten, doch niemand kannte die Macken der Saranvaal so gut wie Farrel-Tusos Bruder und für einen guten Fang brauchte Kane-Lano einen einwandfrei arbeitenden Antrieb.
„Du hast dich um die Maschine verdient gemacht, Glen-Tuso, daher werde ich über deine Respektlosigkeit hinwegsehen. Dieses eine Mal“, fügte der Kapitän finster hinzu. „Denn wenn wir einen guten Fang machen wollen, dann muss die Maschine ihr Bestes geben. So, wie wir alle.“ Er sah wie der Obermaschinist zu einer Entgegnung ansetzen wollte und hob mahnend die Peitsche. „Ich werde dir den gebührenden Respekt erweisen und erwarte, dass du ihn ebenso mir gegenüber erweist. Ich verlasse mich lieber auf den Wind als auf einen aufrührerischen Dampfschrauber.“
Glen-Tuso wurde ein wenig bleich. Dass ein Kapitän sich lieber auf den Wind als auf die Dampfkraft verließ, war eine furchtbare Erniedrigung für jeden Dampfschrauber. Doch der Maschinist war fair genug, sich einzugestehen, dass er sich das selbst zuzuschreiben hatte. Er knickte in der Hüfte nach vorne, legte die Fingerspitzen der linken Hand an die linke Schulter und erwies dem Kapitän so den traditionellen Ehrensalut. „Verzeih, Kapitän, ich vergaß mich.“
„Es ist vergeben“, brummte Kane-Lano und schlug mit der Hand leicht gegen die Schulter des Obermaschinisten.
Am Niedergang war Poltern zu hören. Das durch die Luke hereinfallende Licht wurde verdeckt, als ein paar Männer zwei große Körbe ins Maschinendeck herunterbrachten.
„Wir bringen den ersten Braunfels, Käpt´n“, meldete einer der Matrosen. „Wo soll er hin?“
„Ist er sorgfältig zerschlagen worden?“, fragte Glen-Tuso prompt und eilte zum ersten Korb hinüber. „Taugt er überhaupt?“ Er nahm einen der Brocken und betastete ihn. „Bei den Göttern und Vorfahren, ich will verflucht sein, wenn das nicht der beste Braunstein ist, der jemals gefunden wurde. Sehr dicht und sehr hart.“ Er grinste glücklich. „Das wird die Maschine befeuern, Käpt´n, das wird sie befeuern.“
„Freut mich, dass du zufrieden bist“, sagte Kane-Lano und schob die Neuro-Peitsche wieder hinter den Gürtel. Er sah die Matrosen an. „Füllt unsere Bunker auf und dann schafft so viel wie möglich in den hinteren Laderaum. Farrel-Tuso wird sich um die Trimmung kümmern.“
Der Obermaat nickte. Durch die richtige Gewichtsverteilung des Schiffes konnte man sein Heck beschweren und den Bug etwas leichter machen, so dass dieser sich ein wenig hob und den Sand besser teilte. Dann mussten sich die Schaufeln der Antriebsräder nicht so tief in den Sand graben. Das machte die Saranvaal schneller.
Der Kapitän stieg ins Hauptdeck hinauf und suchte seine Kabine auf. Sie war die größte an Bord und erstreckte sich über die gesamte Breite des Schiffes. In Fahrtrichtung rechts lag die kleine Schlafkammer. Kane-Lano gönnte sich den Luxus eines richtigen Bettes. Allerdings stand dies nicht auf Füßen, sondern war mit Ketten an der Decke aufgehängt, so dass diese die Bewegungen des Schiffes ausgleichen konnten. Es gab zwei Schränke und eine große Kiste. Der übrige Teil der Heckkabine war eine Mischung aus Besprechungsraum und Wohnstube. Die meisten Möbel waren aus bunt bemaltem Metall oder gefärbtem Glas, denn diese Rohstoffe waren reichlich vorhanden und Stahlgießer, Schmiede und Glasformer gehörten zu den vielbeschäftigten Handwerkern. Lediglich der Kartentisch und zwei der Stühle waren aus Holz. Sie waren mit feinen Schnitzereien versehen. Holz zu verwenden, verriet Wohlstand. Kane-Lano war ein sehr erfolgreicher Sandschiffer, doch auf dieser Fahrt war der Erfolg bislang ausgeblieben. Hinter dem Tisch stand eine große Truhe mit mehreren Schlössern. Darin bewahrte der Kapitän Münzen und besondere Wertsachen auf.
Kane-Lano trat an den Tisch und beugte sich über die dort ausgebreitete Karte. Mit Winkelmaß und Stift prüfte er die bislang zurückgelegte Strecke. Die Saranvaal war tief in das nördliche Sandmeer vorgedrungen. Tiefer als gewöhnlich und doch hatte man noch keinen einzigen Krebs gesichtet.
Er blickte auf, als er vor der Kabinentür das Stampfen eines Fußes hörte. „Willkommen!“
Obermaat Farrel-Tuso trat ein und der Kapitän winkte ihn zur Karte. „Sechs Wochen Fahrt im Sandmeer und noch immer kein Fang“, knurrte Kane-Lano mit finsterem Gesicht. „Dabei haben wir mehrfach den Kurs geändert und ein großes Gebiet nach Krebszeichen abgesucht.“
„Wir sind weit im Norden. Weit mehr Tausendschritte als jemals zuvor.“ Farrel-Tuso tippte auf die Karte und führte den Finger ein Stück weiter. „Wir sind bald in der Nähe des großen Walls, Käpt´n.“
„Ich weiß, es ist riskant“, knurrte Kane-Lano. „Dort am Gebirge beginnt das Gebiet der Sternenmenschen und dort treiben sich oft auch die Plünderer herum.“
„Mit Plünderern der Clans werden wir fertig“, meinte der Obermaat. „Jedenfalls, wenn es nicht zu viele von den Kehledurchschneidern sind. Mehr Sorge machen mir die Sternenmenschen. Sicher, wir treiben Handel mit ihnen, aber sie haben es nicht gerne, wenn man ihrem Gebiet zu nahe kommt.“
„Es ist unser Land“, erwiderte der Kapitän und sein Blick wurde noch finsterer. „Sie haben es sich einfach genommen.“
„Wir hatten keine Wahl. Die Wasserstädte haben einen Vertrag mit den Sternenmenschen und wir müssen uns dem fügen.“
Der Kapitän stieß ein leises Schnauben aus, wobei die kurzen Nasenflügel in flatternde Bewegung gerieten. „Reden wir nicht von den Sternenmenschen. Wir brauchen Gewinn, Farrel. Eine Wochenreise westlich liegt die nächste Wasserstadt. Drei Tage nördlich, dicht vor dem großen Wall, liegt die Ruinenstadt Neroya. Vielleicht sollten wir dort nach Artefakten suchen, die wir mit Gewinn verkaufen können.“
„Die alten Städte sind doch längst ausgeplündert, Käpt´n. Ich glaube nicht, dass wir da noch etwas finden. Da müsste man schon sehr tief in den Sand hinunter. Dafür sind wir nicht ausgerüstet.“
„Dennoch könnte es sich lohnen.“ Kane-Lano stieß einen langen Seufzer aus. „Früher reisten wir selbst zwischen den Sternen. Jetzt verrosten die alten Schiffe unter dem Sand.“
„Ich glaube nicht, dass wir jemals Sternenschiffe besaßen, Käpt´n. Wir befuhren schon immer den Sand.“
Der Kapitän trat an einen kleinen Metallschrank, öffnete ihn und nahm zwei Gläser und eine Karaffe heraus. „Du irrst dich. Mein Ur-Großvater sah noch eines unserer alten Schiffe und hat es selbst betreten. Damals hatte der Sand es noch nicht ganz bedeckt. Ich sage dir, die alten Legenden sind wahr. Früher beherrschten wir die Sternenfahrt, bis es zu jenem Krieg kam, der uns alles nahm. Bei dem die Strahlungswaffen eingesetzt wurden, die den hundertjährigen Winter brachten und fast alles Leben und die großen Wälder vernichteten. Als die Sonne endlich die ewige Nacht durchbrach, da hatte sich das Antlitz unserer Welt Negaruyen dramatisch verändert. Nun herrscht der Sand. Als unsere Vorfahren aus ihren Bunkern kamen, da waren sie nur noch wenige, obwohl wir einst Milliarden zählten. Die großen Wälder waren verschwunden und ebenso die großen Städte und Wassermeere. Nur an wenigen Stellen war noch Leben möglich, aber unsere Vorfahren haben es geschafft. Die Wasserstädte entstanden und auch neue Wälder. Wir lernten den Sand zu befahren. Das tun wir nun seit fast fünfhundert Jahren und wir schworen dem alten Leben ab, welches uns den Krieg brachte.“
Der Kapitän schenkte ihnen ein und reichte ein Glas an seinen Obermaat und besten Freund.
„Und vor zweihundert Jahren kamen die Sternenmenschen“, fügte Farrel-Tuso hinzu. „Der Handel mit ihnen bringt uns viele nützliche Dinge.“
„Vor allem nutzt er den Sternenmenschen. Tausende von uns gingen hinter den großen Wall, um dort für die Fremden zu arbeiten.“
„Ein paar kehrten zurück und waren reich beschenkt worden“, meinte der Obermaat.
„Mag sein“, brummte der Kapitän. „Dennoch traue ich den Sternenmenschen nicht. An ihnen ist etwas Falsches.“
„Sie handeln fair und die Preise stimmen.“
„Findest du es nicht seltsam, dass ihnen die Magensteine der Krebse so wertvoll sind?“
Farrel-Tuso lachte lauthals. „Ihnen ist ja auch Gold wertvoll, während wir es nur nutzen, da es hübsch glänzt und der Witterung widersteht. Nun, von den Sandstürmen einmal abgesehen. Käpt´n, es sind nun einmal Sternenmenschen und sie haben andere Bräuche als wir.“ Er lachte erneut. „Und sie sind hässlich. Sie haben Haare an den Augen und darüber, und furchtbare große und lange Nasen. Sie haben nicht einmal Nickhäute und müssen ständig blinzeln.“ Der Obermaat zuckte mit den Schultern. „Aber ihre Weiber sind recht ansehnlich.“
„Findest du?“
Farrel-Tuso grinste. „Ich nicht, Käpt´n, aber es gibt da gewisse Gerüchte.“
Kane-Lano interessierte sich nicht für solches Gerede. Sicher, Negaruyen und Sternenmenschen waren sich recht ähnlich und der Kapitän war immer wieder überrascht, dass Gestik und Mimik ihrer beiden Völker sich so sehr glichen. „Wie dem auch sei, Farrel, meine Sorge gilt nicht solchem Geschwätz, sondern einem guten Fang. Ich überlege, ob wir nicht nach Westen abdrehen sollten. Dort waren wir noch nicht.“
Sein Freund widmete sich wieder der Karte und ihren Markierungen. „Weiter nach Norden würde mir jedenfalls nicht gefallen. Zu dicht am großen Wall und zu dicht an den Plünderern. Die wagen sich in letzter Zeit immer öfter nach Süden. In der Stadt haben sie erzählt, dass die Kerle vor zwei Monaten ein Sandschiff aufgebracht haben. Es gab keine Überlebenden und das Schiff wurde vollkommen geplündert und ausgeschlachtet.“
„Keine Überlebenden? Und wie hat man davon erfahren?“
„Ein Flieger der Sternenmenschen fand das Schiff, hat es gefilmt und die Aufnahmen dem Oberherrn der nächsten Wasserstadt übergeben.“
„Sehr freundlich von den Sternenmenschen.“ Der Spott in der Stimme des Kapitäns war nicht zu überhören. „Uns wäre mehr geholfen, wenn sie uns rechtzeitig vor den Plünderern warnen würden.“
„Sie sagen, sie würden sich nicht einmischen.“
„Natürlich nicht. Solange Plünderer und wir aufeinander losgehen, haben die Sternenmenschen nichts zu befürchten.“
Farrel-Tuso sah seinen Kapitän überrascht an. „Würdest du etwa gegen sie kämpfen?“
„Wenn es erforderlich ist.“
„Sei kein Narr, alter Freund. Wir hätten keinerlei Chance gegen sie. Eines ihrer Sternenschiffe könnte unser gesamtes Volk auslöschen.“
Kane-Lano trat an einen Schrank, dessen Vorderseite verglast war und öffnete ihn. Er zog einen armlangen Gegenstand hervor und zeigte ihn Farrel. „Siehst du dies? Früher wäre es uns leicht gefallen, die Sternenmenschen zu vertreiben.“
„Dieser Impulsstrahler ist nichts als ein Artefakt aus vergangener Zeit“, erwiderte Farrel. „Die Macht der Vergangenheit ist erloschen und das ist auch gut so. Was hat sie uns denn gebracht, die alte Macht? Nichts als einen globalen Krieg und die Vernichtung. Und jetzt redest du plötzlich vom Kampf gegen die Sternenmenschen?“
Der Kapitän atmete tief durch und kreuzte verneinend die Arme vor der Brust. „Natürlich hast du recht. Ich sprach unbedacht.“ Er schob die funktionsunfähige Waffe wieder in ihre Halterung zurück und schloss den Schrank. „Ich kann schon nicht mehr klar denken, aus Sorge um einen guten Fang. Wir brauchen einen guten Fang, denn wir haben einige Reparaturen durchzuführen, die wir mit unseren Mitteln nicht vornehmen können. Alter Freund, wenn wir ohne Fang zurückkehren, dann wird es wohl keine neue Fangfahrt mehr geben, denn mir fehlt das Geld für die Reparaturen, für neue Vorräte und für frisches Wasser. Ich kann gerade noch die Pflichtheuer für die Mannschaft zahlen, dann bin ich bankrott.“
„Anschabb!“, fluchte der Obermaat. „So schlecht steht es?“
Kane-Lano stampfte zustimmend mit dem Fuß, schenkte ihnen nach und leerte sein Glas mit einem Zug. „Wenn wir in vier Tagen noch keinen Fang gemacht haben, und ich meine einen wirklich guten Fang, dann müssen wir umkehren.“
„Bei den Göttern und Vorfahren, ich spürte ja schon eine ganze Weile deine Unruhe, aber ich habe nicht geahnt, dass es so schlecht um uns steht.“ Auch Farrel-Tuso leerte nun sein Glas, nahm die Karaffe aus der Hand des Kapitäns und schenkte seinerseits nach. „Wie kommt das? Wir hatten doch gewinnbringende Fahrten.“ Er runzelte die Stirn. „Du hast gespielt?“
„Das Glück ist launisch“, seufzte Kane-Lano.
„Warum bist du dann dieses Risiko eingegangen?“
„Weil wir eine Welle für das rechte Schaufelrad benötigen und ein paar Schaufeln gleich dazu.“ Der Kapitän grinste kläglich. „Es sah erst sehr gut aus. Die Würfel fielen, wie ich es brauchte, aber dann gelang mir kein einziger Wurf mehr.“
„Du bist auf den ältesten Trick von ganz Negaruyen hereingefallen.“ Farrel-Tuso zupfte an seinem Kinnzopf. „Hast du nur Münzen verspielt oder musstest du Schulden machen?“
„Zwanzig Prozent der Saranvaal gehören jetzt Kell-Veso.“
„Dem Händler in Benilan? Diesem verdammten Kehlendurchschneider?“
„Ein guter Krebs und ich löse seine Anteile ab und wir können das Schiff reparieren.“
„Dann werde ich zu den Göttern und Vorvätern beten, dass …“
Der Ruf drang nur schwach durch die Decks und doch elektrisierte er die beiden Männer.
„Kreeeeebs! Kreeebs! Da spuckt er!“
„Ein Krebs“, ächzte Farrel-Tuso. „Dabei habe ich noch nicht einmal mit dem Gebet begonnen …“
Kane-Lano schlug erregt die Hände gegeneinander. „Ich wusste es. Dieses ungewöhnliche Herumgetanze der Plattensteher kam mir doch gleich seltsam vor!“
Sie stellten die Gläser auf den Tisch und eilten zur Tür, stießen kurz zusammen, da sie gleichzeitig nach draußen drängten.
„Ein Krebs!“, rief Kane-Lano dem Obermaschinisten zu. „Wann sind wir unter Dampf?“
Glen-Tuso war bereits dabei, eine Lunte anzuzünden, während ein Dampfschrauber eifrig Braunsteine in den Feuerkessel schaufelte. „Der Wasserstand ist gut. In einem Sechsundzwanzigstel haben wir genug Dampf für die Schaufelräder.“
Das Sechsundzwanzigstel eines Tages …
„Das muss schneller gehen, Glen“, forderte Farrel-Tuso seinen Bruder auf und folgte dem Kapitän zum Aufgang, der auf das Hauptdeck führte. „Der verdammte Krebs darf uns nicht entkommen!“
„Ich musste das Feuer löschen, damit wir die Maschine endlich richtig säubern konnten“, erwiderte Glen-Tuso erbost. „Ich kann nur guten Dampf liefern, wenn die Maschine auch gereinigt ist. Ja, ja, wir beeilen uns. Du kannst den Krebs ja so lange festhalten, bis du die Ventile pfeifen hörst.“
Farrel stieß ein wütendes Schnauben aus und folgte Kane-Lano, der bereits zum Hauptdeck hinaufstieg, wo ihm mehrere Matrosen mit Körben voller Braunfels begegneten.
„Ein Krebs!“, meldete einer von ihnen erregt. „Murna hat einen Krebs gesichtet!“
„Ich bin ja nicht taub. Schafft den Braunstein in den Bunker und macht euch fertig für die Jagd“, befahl der Kapitän und erreichte endlich das Oberdeck. Für einen Moment schlossen sich die Nickhäute, um die Augen vor dem grellen Sonnenlicht zu schützen. Er sah zum Mastkorb des Ausgucks hinauf, wo die Matrosin Murna Ausschau hielt. „Murna! Wo ist er?“
Murna war jung, sehr attraktiv und besaß die schärfsten Augen von allen. Sie beugte sich kurz zum Deck hinab. „Zwei Finger breit rechts vom Bug, Käpt´n, und es ist ein großer!“
Kapitän und Obermaat hasteten zum spitzen Bug hinüber.
„Allmächtige Götter und Vorfahren“, ächzte Farrel-Tuso. „Meine Gebete wurden erhört.“
„Du hast noch gar nicht gebetet“, murmelte Kane-Lano geistesabwesend. „Ich will verdammt sein. Das ist ein Prachtexemplar.“
„Die Götter wussten, dass ich zu ihnen beten würde“, versicherte der Obermaat im Brustton der Überzeugung, „sonst hätten sie uns diesen Prachtkrebs nicht geschickt.“
Es war wirklich das größte Exemplar eines Sandkrebses, welches sie jemals zu Gesicht bekommen hatten. Der rötliche Panzer verriet, dass es sich um ein Männchen handelte und der grüne Fleck am Rücken, dass es geschlechtsreif war. Große Männchen wurden bis zu zwanzig Meter lang, doch dieses maß sicherlich fast fünfunddreißig.
Das Tier war rund zwei Kilometer vor der Saranvaal aus dem Sand aufgetaucht, lag nun auf dessen Oberfläche und spuckte jene Teile aus seinem Verdauungstrakt hervor, die es auf seiner Suche im Sand aufgenommen hatte und die unverdaulich waren. Einige von ihnen blieben allerdings im Magen zurück, da der Krebs größere Steine gerne nutzte, um den Mageninhalt zu zerkleinern. Gerade diese Magensteine erwiesen sich immer wieder als sehr wertvoll.
Die Matrosen, die bis dahin an den Braunfelsen geschlagen und diese zerkleinert hatten, stellten ihre Arbeit ein und sahen fasziniert zu dem Krebs hinüber, unschlüssig, wie sie sich verhalten sollten.
Kane-Lano stieß Farrel-Tuso an. „Hol die Mannschaft an Bord. Der Braunfels läuft uns nicht davon, aber der Krebs wird bald wieder abtauchen.“ Er blickte über das Deck. „Desara! Verdammt, wo steckt das Weib?“
„Schon da“, kam die Erwiderung vom Niedergang her. Eine ältere Frau erschien auf der Treppe, mit kahlem Schädel und einem Nackenzopf, der ihr bis zu den Hüften reichte. Sie war nackt, mit Ausnahme eines langen Lederköchers, den sie sich über die Schulter geschlungen hatte und aus dem die stählernen Spitzen dreier Harpunen ragten. „Kann man denn nicht einmal in Ruhe eine Sandreinigung vornehmen?“
„Wir haben einen Krebs“, knurrte der Kapitän, „und das geht vor Reinlichkeit.“
Desara eilte zum Bug, wo sich die Plattform der Harpunenkanone befand. Obwohl die Frau einen durchaus anregenden Anblick bot und mancher männliche Matrose gerne einen Blick riskierte, achtete in diesen Momenten niemand auf ihre Blößen. Die Harpunierin trat auf die Plattform und blickte zum Krebs hinüber.
„Allmächtige Götter und Vorfahren!“, hörte man ihren Ruf. Sie langte in ihren Köcher und zog die erste Harpunenspitze hervor, wobei sie sich zu Kane-Lano umwandte. „Du erwartest doch wohl nicht, dass ich den Burschen auf diese Entfernung erlege, oder?“
„Du hast schon weiter entfernte Krebse erwischt“, erwiderte der Kapitän.
„Aber nicht so große. Sieh dir seinen Panzer an. Der ist dicker als bei den kleineren Exemplaren. Klar treffe ich ihn auf diese Entfernung, aber die Harpune wird den Panzer nicht durchdringen.“ Sie erahnte die Frage des Kapitäns und kreuzte verneinend die Arme vor der Brust. „Nein, da hilft auch der Lichtschneider nichts.“
„Anschabb!“, fluchte Kane-Lano und warf einen kurzen Blick zu seinem Freund, der an die Reling getreten war und den Matrosen an den Braunfelsen gestikulierte. „Wie nahe müssen wir heran, Desara?“
Sie schätzte die Dicke des Panzers ein. „Fünfhundert Schritte, Käpt´n. Ansonsten kann ich für nichts garantieren.“
Farrel-Tuso kam an die Seite des Kapitäns. „Die Leute kommen zurück, so schnell es nur geht.“
„Desara meint, wir müssten auf fünfhundert Schritte heran“, berichtete Kane-Lano.
„Das ist nicht gut. Kein Wind für die Segel und bis wir unter Dampf sind, wird der Bursche wieder unter den Sand gehen.“
Desara hantierte an ihrer Kanone. Sie öffnete die Segmente der Abdeckung des großen Speicherkristalls und richtete die verspiegelten Innenseiten der Abdeckung so aus, dass sie das Sonnenlicht in den Kristall lenkten. Dort würde das Licht gespeichert, bis es in einem konzentrierten Impuls abgegeben werden konnte. Dieser zerschnitt selbst dicken Stahl und würde auch den Panzer des Krebses durchdringen und damit eine Öffnung schaffen, die das Ziel für die Harpune darstellte. Doch während der Lichtschneider nur die Kraft der Sonne benötigte, brauchte die Harpune die Kraft des Dampfes. Bislang verkündete kein Pfeifen der Ventile, dass genügend Druck vorhanden war.
Männer und Frauen hasteten von den Braunfelsen heran, beladen mit Werkzeug und Körben. Die wenigen Matrosen, die an Bord verblieben waren, halfen ihnen nach Kräften, über die Strickleitern wieder auf die Saranvaal zu gelangen.
Farrel-Tuso spähte zum Großmast mit dem Ausguckskorb hinauf, wo Murna weiter nach dem Krebs spähte und zugleich auf andere Gefahren achten musste. Über Murna hing ein grellroter Tuchstreifen von der obersten Mastspitze, der sich nicht bewegte. „Kein Wind, Käpt´n. Nicht einmal ein Hauch davon. Soll ich dennoch die Segel setzen lassen?“
„Nein. Wenn wir unter Dampfdruck kommen und noch immer kein Wind geht, dann würden die Segel nur als Bremse wirken“, entschied Kane-Lano. „Aber lass die Anker einholen.“
„Macht euch bereit und holt die Anker ein!“, brüllte der Obermaat über das Deck. „Und bewegt euch, ihr lahmen Sandflöhe, denn wir bekommen bald Dampf, und dann beginnt die Jagd!“
Matrosen eilten an die vier Winden der Pfahlanker. Lautes Klicken der Zahnstangen war zu hören, als die massigen Stahlpfähle langsam aus dem Sand gezogen wurden. Es war Schwerstarbeit, denn jeder einzelne Anker war schwer genug, sich sofort durch das Eigengewicht in den Sand zu graben, wenn die Sperre der Zahnstangen gelöst wurden.
„Er taucht ab!“, rief Murna vom Ausguckskorb herunter.
„Verfluchtes Pech“, brummte Kane-Lano, „aber noch ist nichts verloren.“ Er hob die Stimme. „Behalte ihn im Auge! Er darf uns nicht entwischen!“
Noch war ihnen der stattliche Krebs nicht entkommen. Krebse waren riesige Tiere, doch ihr Gehirn war winzig. Niemand wusste, warum das so war, aber Sandkrebse bewegten sich stets in einer schnurgeraden Linie durch den Sand. Sie wichen erst von dieser ab, wenn sie auf ein Hindernis stießen, durch welches sie sich nicht hindurchgraben konnten. Auch dieser Krebs würde nicht aus seiner Bahn abweichen, es sei denn, ein großer Braunfels oder ein vergleichbares Hindernis geriet ihm in die Quere.
Kane-Lano warf einen langen Blick auf die Stelle, an welcher der Krebs verschwunden war. Dort schimmerte der Sand dunkel, da er mit etwas Feuchtigkeit aus der Tiefe durchsetzt war. Die Plattensteher, die ihren Tanz zuvor bei den Braunfelsen aufgeführt hatten, versammelten sich nun an der neuen und erfrischend kühlen Stelle.
„Na schön“, meinte der Kapitän. „Sehen wir uns die Karte an und stecken wir den Kurs ab. Josch-Ugo!“, rief er den Maat der Saranvaal heran. „Beobachte weiter den Sand und die Plattensteher. Wir haben gleich Dampf und dann folgen wir der Beute!“
„Deinem Wunsch entsprechend.“ Der Maat legte die Fingerspitzen salutierend an die Schulter und brüllte dann seine Befehle über das Oberdeck.
Kane-Lano und Farrel-Tuso suchten wieder die Kabine des Kapitäns auf und beugten sich bereits über die Karte, als ihnen die Harpunierin Desara folgte.
„Er ging soeben hinunter und wird sich jetzt in gerader Linie durch den Sand wühlen“, berichtete Desara.
„Zeig mir seinen genauen Weg“, forderte Kane-Lano und fuhr anschließend mit dem Finger die Karte entlang. „Den Eintragungen nach hat er freie Bahn bis zu diesem Punkt hier.“
Desara stampfte bestätigend mit dem Fuß. „Die Steinfelsen von Eabol. Dort kommt er nicht durch. Das ist ein Ausläufer des großen Walls, der weit in das Sandmeer hineinreicht. Dort wird er die Richtung nach Westen oder Osten ändern.“
„Wir müssen ihn in jedem Fall vorher erwischen. Farrel, was meinst du, wie viel Zeit bleibt uns und wie oft muss er zum Spucken und Luftholen auftauchen?“
„Schwer zu sagen, Käpt´n. Das ist ein großer Bursche, und wer weiß, wie lange er unten bleiben kann, bevor er seine Lungen neu befüllen muss. Die sind sicher auch mächtig groß.“
„Ein großer Leib verbraucht auch viel Luft“, wandte Desara ein. „Er wird ebenso oft heraufkommen wie die kleineren Krebse. Alle drei oder vier Sechsundzwanzigstel.“
„Das ist immer noch eine ziemliche Spanne“, gab Farrel-Tuso zu bedenken.
„Wir kennen seinen Weg. Wenn wir die Zeichen im Sand beachten, dann werden wir ihn auch erwischen.“ Kane-Lano lächelte zuversichtlich. „Wir sind schneller als er und wissen, wohin sein Instinkt ihn treibt.“
„Wir müssen auf fünfhundert Schritte heran“, erinnerte Desara. „Sonst kann ich für nichts garantieren.“
Aus dem Unterdeck war das Schrillen einer Dampfpfeife zu hören. Kane-Lano grinste vergnügt. „Wir sind unter Dampf! Jetzt packen wir ihn. Also los, auf eine gute und schnelle Jagd.“
Sie eilten wieder an Deck und traten an den Steuerstand, der sich zwischen den beiden mächtigen Schaufelrädern befand. Farrel-Tuso nahm mit Rudergänger Agenscho die Position am Steuer ein.
„Alle Anker sind frei und wir stehen unter Dampf, Käpt´n“, meldete Maat Josch-Ugo. „Bereit zur Fahrt.“
Kane-Lano nickte und beugte sich über das Sprachrohr, welches den Steuerstand mit der Maschine verband. „Maschine: Auf langsame Fahrt gehen!“
„Maschine geht auf langsame Fahrt“, kam die blechern klingende Antwort von Glen-Tuso.
Dampf strömte in die großen Kolben und alle im Schiff spürten das Beben des Rumpfes, als die Kraft der Maschine gegen die des Sandes ankämpfte. Die Schaufelräder durchmaßen immerhin fünfzehn Meter und hatten sich fast drei Meter tief in den Sand gegraben. Für eine Weile wirkte es, als sei die Dampfmaschine unterlegen, doch dann schien sich der Rumpf des Sandschiffes zu schütteln, ein Ächzen ging durch den Stahl und die Schaufelräder begannen, sich ganz langsam zu drehen. Wie in Zeitlupe senkten sich stählerne Schaufeln in den Sand, während andere, scheinbar zögernd, frei kamen. Zentimeterweise ruckte die Saranvaal nach vorne.
„Mehr Dampf!“, rief Kane-Lano in den Sprachtrichter.
„Wenn ich zu schnell Druck gebe, dann reißt es uns die Schaufeln heraus oder die Kolben brechen!“, kam die gebrüllte Erwiderung.
Erneut ging ein Ruck durch das Schiff und der scherenförmige Bug begann den Sand zu teilen. Der Bugwelle von Wasser sehr ähnlich, wurde er nach rechts und links geschaufelt. Die ersten Glieder der Laufraupe verschoben sich.
„Wir kommen in Fahrt“, stellte Farrel-Tuso zufrieden fest.
„Setz den Kurs zwei Fingerbreit rechtsweisend und folge dem Krebs!“
Der Obermaat stieß ein leises Schnauben aus. „Darauf kannst du dich verlassen. Der entkommt uns nicht.“
Die ersten Meter bewegte sich das Schiff in ruckenden Bewegungen, denn die Fahrt war noch zu gering, als dass der Bug den Sand leicht teilen konnte. Doch je mehr Geschwindigkeit die Saranvaal aufnahm, desto gleichmäßiger wurden ihre Bewegungen. Die Rotation der Schaufelräder erhöhte sich. Sand wirbelte von den Schaufeln empor, spritzte am Bug zu den Seiten, während der Rumpf weiter beschleunigte. Das gleichmäßige Rumoren der Laufraupe begleitete das Stampfen der Maschine und das Mahlen der Schaufeln.
„Kurs liegt an“, meldete Farrel-Tuso. „Wenn es keine Felsen gibt, die auf der Karte nicht verzeichnet sind, dann kann er uns nicht mehr entkommen.“
Diese Bemerkung beruhigte den Kapitän keineswegs. Die Oberfläche des Sandes war in Bewegung und diese ähnelte der Dünung eines Wassermeeres. Tief unter der Oberfläche war es ruhig, doch nur wenige Meter über dem festen Untergrund gab es Strömungen, die durch tektonische Bewegungen ausgelöst wurden. Gebirge und Felsklippen blieben davon unberührt, aber es gab beachtliche Felsbrocken, die nicht fest mit dem Boden verwachsen waren und sich unter der Oberfläche bewegten. Wenn der Krebs zufällig gegen einen von ihnen prallte, dann würde er die Richtung unerkannt ändern und den Jägern entkommen.
Farrel-Tuso achtete auf den großen Kompass, der neben den Speichen des Steuerrades in einer erschütterungsfreien Aufhängung befestigt war. „Drei oder vier Sechsundzwanzigstel, bis er wieder auftaucht und spuckt“, wandte er sich an den Kapitän. „Das ist später Nachmittag. Wenn wir Pech haben, taucht er erst am frühen Abend aus dem Sand auf.“
„Du hast recht.“ Kane-Lano warf einen Blick zum Ausguck empor. Auf Murna war Verlass. Das Windtuch bewegte sich nun, aber es war nur der Wind der schnellen Sandfahrt. Doch der Kapitän hätte ohnehin keine Segel setzen lassen. Die Saranvaal wäre zu schnell geworden und hätte die Beute hinter sich gelassen und damit verloren. „Josch-Ugo, lass die Scheinwerfer überprüfen.“
Der Maat nickte und rief ein paar Befehle. Matrosen gingen zu den großen Scheinwerfern, die am Bug und Heck installiert waren. Es waren klobige Konstruktionen, die gute zwei Meter durchmaßen. Ihre Glühlampen besaßen die Größe eines Kopfes.
„Strom für die Scheinwerfer“, sprach Kane-Lano in den Schalltrichter.
„Jetzt?“, kam die verwunderte Erwiderung.
„Jetzt, Anschabb!“, brüllte der Kapitän ins Unterdeck hinunter. Die Widerspenstigkeit des Obermaschinisten begann ihn zunehmend zu nerven. „Wir wollen prüfen, ob sie in Ordnung sind.“
Unten leitete Glen-Tuso einen Teil des Dampfdrucks auf den Dynamo. Strom floss durch die Kabel und die Matrosen schalteten die Scheinwerfer ein. Vom rechten Bugscheinwerfer war ein scharfer Knall zu hören, als die Lampe durchbrannte.
„Auswechseln“, befahl Josch-Ugo.
Während man sich daran machte, den Scheinwerfer zu reparieren, bereiteten die anderen Mannschaftsmitglieder das Finale der Jagd vor. Entlang der Reling waren Kisten aufgestellt, die man jetzt öffnete, um die darin enthaltenen Wurflanzen mit dünnen Drahtseilen zu verbinden. Andere setzten sich an die Schleifsteine und schärften Haumesser und Sägen, mit denen man die Beute zerlegen wollte.
Kane-Lano kannte die Geschwindigkeit, mit der sich ein Krebs normalerweise bewegte. Er versuchte die Fahrt des Schiffes anzugleichen und konnte nur hoffen, dass seine Einschätzung auch zutraf. Wenigstens hatten die Krebse keine natürlichen Feinde. Selbst wenn das Tier die Bewegung der Saranvaal über sich spürte, würde ihm dies keine Gefahr signalisieren. Doch sobald die Harpune in seinen Panzer schlug, dann würde die Beute zur wilden Bestie werden und entschlossen um ihr Leben kämpfen.
„Wir müssen den Kerl schnell erledigen“, meinte Kane-Lano. „Er ist groß genug, um sogar unser Schiff zu gefährden.“
„Desara ist der beste Harpunier, den es gibt“, erwiderte Farrel-Tuso im Brustton der Überzeugung. Der Rudergänger neben ihm stampfte zustimmend mit dem Fuß.
Kane-Lano beschattete die Augen und schätzte den Stand der Sonne ein. „Der Kerl ist schon viel zu lange unten.“
Die Saranvaal glitt nun scheinbar mühelos auf dem Sand. Die breite Laufraupe verhinderte, dass sie in den Untergrund einsank. Erreichte sie eine Düne, dann schnitt ihr Bug hinein, teilte die Oberfläche des Hindernisses, während die Schaufelräder das Schiff hinübertrieben. Es schien, als reite das Schiff auf den Wellen des Sandmeeres und im Prinzip verhielt es sich auch so.
Stunde um Stunde fuhr das Sandschiff. Kane-Lano konnte weiterhin nur hoffen, dass er die Geschwindigkeit des Krebses richtig einschätzte und dieser die Richtung beibehielt. Je länger die Jagd andauerte, desto unsicherer fühlte er sich, doch er ließ sich das nicht anmerken und stand, scheinbar zuversichtlich lächelnd, neben dem Ruder. Nur die Blicke, die immer häufiger zwischen Bug und Mastkorb wechselten, verrieten seine Empfindungen.
Die Dünen schienen zu wandern, als die Sonne allmählich sank und die Schatten länger wurden.
„Nichts zu sehen“, brummte Farrel-Tuso. „Nicht einmal ein paar Plattensteher.“
„Du verstehst es wirklich, mir Zuversicht einzuflößen“, raunte der Kapitän.
„Kreeeeebs!“, kam Murnas Schrei aus dem Mastkorb. „Er kommt nach oben!“
„Endlich. Den Göttern und Vorfahren sei Dank!“ Kane-Lano eilte nach vorne zum Bug.
Desara deutete in Fahrtrichtung. „Der Sand wölbt sich und wird dunkel. Er muss schon dicht unter der Oberfläche sein. Ich wette, gleich bricht er durch.“
„Kreeebs! Da spuckt er!“, rief Murna prompt, als der Rumpf des Sandkrebses erschien.
Der Leib des mächtigen Tieres schnellte förmlich empor, schien wie ein kleines Gebirge aus dem Sandmeer zu wachsen.
„Dreihundert Schritte!“ Desara entsicherte die Harpune und richtete sie nochmals aus. „Ich habe ihn!“
Sie zog den Abzug halb durch und der Lichtschneider flammte auf. Der fingerstarke Impuls traf den Rücken des Tieres, unmittelbar hinter der Kopfwulst mit den Schaufeln. Rauch stieg auf, als die Energie ein Loch in den dicken Panzer brannte. Noch bevor der Krebs den Schmerz registrierte, zog Desara den Abzug nun ganz durch. Mit einem peitschenden Knall löste sich die Harpune.
Es war ein ausgezeichneter Schuss. Die vierkantige Stahlspitze traf exakt das Loch, welches der Lichtschneider gebrannt hatte, vergrößerte es, indem sie den Panzer durchdrang.
Erst jetzt reagierte der Krebs auf den Schmerz. Er richtete sich steil auf und warf sich zugleich nach vorne, um dem Ding zu entgehen, welches ihn von hinten getroffen hatte. Diese Bewegung spannte das Drahtseil zwischen Kanone und Harpune. Durch den Zug des Seiles klappte die vierkantige Spitze auseinander, zerschnitt Gewebe und wurde zu einem breiten Anker, der sich innerhalb des Panzers verkeilte.
„Wir haben ihn!“, brüllte Kane-Lano erregt. „Ruder Hartlage rechts! Maschine stopp! Und jetzt macht den Kerl fest!“
„Hartlage rechts und stopp!“, bestätigte Farrel-Tuso, der mit dem Rudergänger am Rand drehte und seine Anweisung in das Sprachrohr schrie.
Das Schiff reagierte auf die Bewegung, als die Ruderzüge die beiden Steuerkufen am Heck drehten. Es schwenkte nach rechts und der scharfe Bug verfehlte den Krebs nur knapp.
Das Tier war in Bewegung. Das gespannte Drahtseil der Harpune riss die Kanone herum. Desara und Kane-Lano konnten gerade noch verhindern, dass sie geköpft wurden.
„Fallen Anker!“, befahl der Kapitän. „Und legt ihn endlich fest! Fixiert den Kerl, sonst reißt er uns das Schiff auseinander!“
Normalerweise hatte ein Krebs kaum eine Chance gegen die Masse des Schiffes, doch dies war ein besonders großes Exemplar und es bewegte sich im instinktiven Bemühen, die Quelle des Schmerzes loszuwerden. Es stemmte sich gegen den Zug der Harpunenleine und seine beiden großen Sandschaufeln schlugen ungezielt um sich.
Haltekeile wurden aus den Zahnstangen geschlagen und die vier Pfahlanker klatschten in den Sand, gruben sich durch ihr Eigengewicht ein. Matrosen rannten mit ihren Wurflanzen zur rechten Schiffsseite, um die Waffen auf den Krebs zu schleudern.
Die Halterung der Harpunenkanone ächzte. Knallend löste sich ein Niet, der sie am Deck fixierte. Die Lafette drehte sich ein wenig und begann sich zu neigen.
Eine Sandschaufel des Krebses fuhr an der Reling entlang. Holz und Stahl gaben nach und zwei Matrosen wurden erfasst und über das Oberdeck geschleudert. Einer von ihnen verschwand über die Reling der anderen Seite. Blut spritzte über das Deck.
Wurflanzen wurden mit aller Kraft geschleudert. Einige prallten ab, andere drangen in den Panzer. Matrosen versuchten die Drahtseile zu spannen, aber gegen die Kraft des Krebses kamen sie noch nicht an.
„Anschabb!“, fluchte der Kapitän erregt. „Legt ihn endlich an die Seile!“ Er duckte sich, als erneut eine Sandschaufel des Krebses über den Bug strich. Zwei weitere Nieten lösten sich an der Lafette der Kanone.
Desara bewies ihren außergewöhnlichen Mut, als sie die Verschraubung des Lichtschneiders löste, um diesen von der Kanone zu trennen. Waffe und Drahtseil waren in konstanter Bewegung und unter hoher Spannung. Eine winzige Unachtsamkeit oder das Reißen des Seils würde der Harpunierin das Leben kosten.
Doch Desara war nicht bereit, die Beute entkommen zu lassen. Es gelang ihr, den Lichtschneider zu lösen. Sie warf einen Blick auf das klobige Gerät. „Geladen“, ächzte sie erleichtert und richtete es auf den Schädelwulst des Krebses.
Der Impuls brannte ein Loch in den dicken Schädelpanzer.
Es war ein glücklicher, wenn auch nicht tödlicher Treffer, denn die Bewegungen des Krebses wurden deutlich langsamer und weniger kraftvoll.
„Legt ihn fest!“ Der Kapitän wusste nicht, wie oft er dies nun schon geschrien hatte.
Matrosen ließen sich über Strickleitern auf den Boden des Sandmeeres hinunter, begannen die Beute zu umkreisen. Andere folgten den Lanzenwerfern mit großen Hämmern und Stahlstangen, die sie nun tief in den Sand trieben, um daran die Seile der Lanzen einzuklinken. Die Seile jener Lanzen, die inzwischen festen Halt gefunden hatten, wurden nun zunehmend gespannt und nahmen dem verwundeten Tier immer mehr Bewegungsfreiheit.
Eine der Verankerungen wurde aus dem Boden gerissen und vier Matrosen wirbelten über den Sand.
Desara setzte alles auf einen glücklichen Wurf. Sie klinkte das Harpunenseil der Kanone aus und ließ dem Tier mehr Freiheit, während sie hastig eine neue Harpune lud. Von den Matrosen ertönten erbitterte Flüche, da sie das verwundete Tier kaum halten konnten, obwohl inzwischen ein Dutzend Ankerseile gespannt wurden.
Desara visierte jene Stelle an, an welcher der Lichtschneider den Schädelwulst des Krebses perforiert hatte und schoss.
Als sich die Harpunenspitze spreizte, war es vorbei.
Der Krebs erstarrte für einen Moment, dann fiel er haltlos vornüber. Der Ruck riss die Lafette der Harpunenkanone endgültig aus dem Deck und der Sand erbebte, als der mächtige Leib des Tieres aufschlug. Dann herrschte einen Moment Stille, nur vom Stöhnen einiger Verletzter unterbrochen, bevor Jubel aufbrandete.
„Bei den Göttern und den Vorfahren, was für ein prachtvoller Krebs!“, rief Kane-Lano erleichtert und blickte auf die Beute hinunter. „Erweisen wir ihm den gebührenden Respekt.“
„Gedenkt der Beute!“, dröhnte Farrel-Tusos Stimme über das Deck.
Kane-Lano legte die Fingerspitzen an die Schulter. „Möge dein Dasein seinen Frieden im ewigen Meer des Sandes finden“, wünschte er dem besiegten Gegner. „So, wie es dir gebührt.“
Die Männer und Frauen erwiderten die Geste. „So, wie es dir gebührt“, wiederholten sie.
Der Kapitän klatschte in die Hände. „Versorgt die Verwundeten und dann weidet unsere Beute aus! Beeilt euch, es wird nun rasch dunkel!“
Die Scheinwerfer erwachten zum Leben, während sich die Besatzung über den Kadaver des Krebses hermachte. Trotz des ungewohnt dicken Panzers zerteilten sie den Körper in überraschender Schnelligkeit. Fässer wurden vom Oberdeck des Sandschiffes herabgelassen, mehrere Feuerstellen mit Braunstein entfacht, über denen große Kessel in ihren Dreibeinen hingen. Kostbares Wasser begann zu brodeln.
Mit Beilen, Hämmern und Metallkeilen wurde der Panzer weiter geöffnet. Einige seiner Stücke würde man herausbrechen und mit Gewinn verkaufen. Scharfe Klingen zerteilten das Gewebe. Das schmackhafte Fleisch wanderte in bereitstehende Fässer. Was nicht genießbar war, warf man in die Kessel, kochte es aus, um daraus Fett zu gewinnen. Dies galt ebenso für die bereits öligen Körperflüssigkeiten des Kadavers, die auf diese Weise noch verfeinert werden konnten. Öl und Fett wurden abgeschöpft und ebenfalls in Fässer umgefüllt. Einige Gelehrte behaupteten, ein Krebs sondere seine organische Flüssigkeit auch durch Poren im Panzer ab, was es ihm ermögliche, so leicht durch das ewige Sandmeer zu gleiten.
Maat Josch-Ugo hackte mit zwei anderen Matrosen die Innereien aus der mächtigen Höhle, die der zunehmend leere Panzer bildete. Ihnen ging es nicht alleine darum, das Gewebe vom Panzer zu lösen, sondern vor allem um den großen Magensack, der sich im hinteren Ende des Leibes befand. Unter den dortigen Magensteinen fanden sich immer wieder kostbare Funde.
Josch-Ugo durchtrennte die Außenhaut und sprang zur Seite, damit ihn die Magensäfte des Kadavers nicht trafen. Eine breiartige Mischung gelangte ins Freie. Der Maat nahm eine Metallstange und stocherte darin herum, ignorierte den bestialischen Gestank, bis er auf feste Gegenstände stieß. Geschickt förderte er sie aus dem Brei heraus. Ein paar große Felsbrocken aus Gebirgsgestein und Braunfels, rund geschliffen von den Bewegungen des Magens. Dann ein paar wertvolle Edelsteine. Schließlich stieß Josch-Ugo auf den kopfgroßen Klumpen eines blau schimmernden Kristalls. „Ruft den Käpt´n, Jungs. Wir können uns ein neues Schiff kaufen.“
Kane-Lano eilte herbei und betrachtete den Fund des Maats. „Bei den Göttern und Vorfahren, das ist der größte Fund, den man je gemacht hat. Du hast Recht, Josch-Ugo, für diesen Brocken werden uns die Sternenmenschen den Preis eines ganzen Sandschiffes zahlen.“
„Er ist recht hübsch“, meinte einer der Matrosen. „Aber ich weiß nicht recht, was daran so wertvoll sein soll.“
„Die Sternenmenschen jenseits des großen Walls nennen diese Kristalle Hiromata. Ich weiß auch nicht, warum er ihnen so kostbar ist. Wichtig ist nur, dass unsere Sorgen nun ein Ende haben. Morgen nehmen wir Kurs auf die Wasserstadt Benilan. Ich sage euch, der Brennwein wird in Strömen fließen, denn wir haben Grund zum Feiern.“