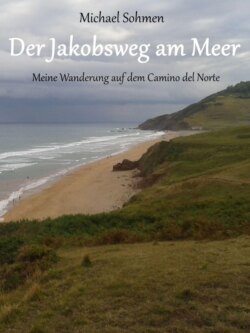Читать книгу Der Jakobsweg am Meer - Michael Sohmen - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Betrug
Оглавление5. August, Deba → Markina-Xemein / Bolibar
Morgens sitze ich mit Gabriel im Café und wir schweigen uns an. Ich bin noch nicht richtig wach und spüre Muskelkater. Bisher gab es nur Bekanntschaften, die sich nach kurzer Zeit wieder verloren haben und nicht einmal der Blick durch die Panoramafensterscheibe versetzt mich in Pilgerstimmung. Nieselregen fällt, es ist grau und trüb. Der Wind, der zur Tür hereinweht, macht mir klar, dass es stark abgekühlt hat. Am Tresen sitzen einige Ortsbewohner und trinken ihr morgendliches Glas Rotwein. Oder zwei. Es scheint hier ein typisches Morgenritual zu sein.
Irgendwann überwinden wir unsere Trägheit und begeben uns auf dem Weg. Dieser entfernt sich vom Meer und wir wandern durch eine alpine Landschaft.
»Dies sind eigentlich Kampfstiefel für den Einsatz in der Wüste«, bricht der Belgier sein Schweigen und zeigt auf seine sandfarbenen Schuhe. »Sie sind extra hochgeschlossen, damit der Sand nicht hereinrieselt. Solches Schuhwerk tragen die Marine-Soldaten im Irak auch. Ich habe gleich zwei Paar gekauft.«
»Ich habe schlechte Erfahrungen mit Stiefeln. Meine sind beim Wandern auseinandergefallen. Seitdem setze ich auf Turnschuhe«, erwidere ich in Erinnerung an meine Bergstiefel, die ich kaum benutzt hatte und deren Sohle sich unterwegs gelöst hatte. Sie waren mit einem Kunststoff zusammengeklebt, der nach wenigen Jahren zerfiel. Auch ein zweites Paar Stiefel hat sich in der gleichen Weise verabschiedet. Teure Markenstiefel waren es. Gabriel lässt sich jedoch nicht beirren und erzählt weiter.
»Ich habe vor kurzem meinen Wehrdienst in Belgien abgeleistet. Als Soldat konnte man die Stiefel für 50 Euro kaufen. Normalerweise kosten sie ein Vielfaches.«
Inzwischen wird die Gegend bestimmt durch Wald, Wiesen und endloses Gebirge. Eine Herde Rinder, die an einem steilen Hang weiden, ziehen mich magisch an. Sie sind außergewöhnlich. Eines trägt besonders auffällige Hörner. Während das linke nach unten gebogen ist, weist das rechte Horn in die Höhe. Ungemein spannend. Als ich das Naturwunder betrachte und mein belgischer Kollege weitermarschiert, höre ich ein schrilles Pfeifen. Verärgert blicke ich mich um, wer diese Naturidylle stört. Ein Bartträger mit Strohhut. Schon auf den ersten Blick wirkt er unsympathisch. Ich entscheide mich, ihn zu ignorieren und betrachte die Kuh.
»Sieht komisch aus«, höre ich den Friedensstörer ausrufen, der nach einem kurzen Stopp seinen Weg wieder fortsetzt.
Es ist Mittagszeit, als sich mitten in der Einsamkeit eine grüne Ebene öffnet. In der Ferne blitzt ein größeres Haus auf, wir halten darauf zu. Mit Freude treten wir ein, denn dieses Gebäude beherbergt ein Café. Auf einer Terrasse haben sich Pilger bei Kaffee und spanischen Tortillas niedergelassen, diesen Leckerbissen will ich mir jetzt auch gönnen.
Gabriel ist der Gesprächigere von uns. Als ich mein Mittagsmahl auf die Terrasse trage, plaudert er schon mit zwei Rucksackträgerinnen. Zwei Französinnen. Als Belgier ist er sprachlich im Vorteil, während ich danebensitze und zuhöre.
Nach der entspannten Pause von fast einer Stunde habe ich meinen zweiten Kaffee und die dritte Tortilla beendet und wir setzen unseren Weg jetzt zu viert fort. Obwohl Gabriel in seiner Muttersprache kommunizieren kann, besitze ich einen anderen Vorteil. Die Französinnen sind etwa in meinem Alter, während er mit zwanzig Jahren halb so alt ist wie ich und die beiden Pilgerinnen. Hin und wieder kann ich auch ein paar Worte mit ihnen wechseln. Sie tragen die schönen Namen Juli und Ann-Claire.
Am frühen Nachmittag erreichen wir die Stadt mit dem unaussprechlichen Namen Markina-Xemein. Nicht nur ihr Name ist baskisch. Wer in dieser Region noch nie gewandert ist, dem sagt ›typisch baskisch‹ sicher wenig. Herausgeputzte kleinbürgerliche Häuser, saubere Parks und schmucke Vorgärten scheinen hohe Priorität zu haben. Alles wirkt sehr gepflegt und wird nicht von moderner Stahl- und Glasarchitektur gestört. Von Übungen moderner Architekten ist das Ortsbild vollkommen verschont geblieben und der Protz nur innerhalb der Kirchen erlaubt. Allerorts sind Transparente aufgehängt, die für die Unabhängigkeit werben, als Union aus baskischen Gebieten in Spanien und Frankreich.
Wenn die Einwohner dieser augenscheinlich wohlhabenden Region davon überzeugt sind, dass sie wesentlich anders wären als der Rest der Spanier, warum sollten sie nicht einen eigenen Staat bekommen und unabhängig leben? Unter der Franco-Diktatur haben die Basken am meisten gelitten und dabei wurde versucht, ihre Kultur und Sprache vollkommen auszulöschen. Wenn man sich in einer Volksabstimmung mehrheitlich für eine vollkommene Autonomie entscheiden sollte, warum sollte man ihnen die nicht gewähren?
In dieser altehrwürdigen Stadt begeben wir uns sogleich auf die Suche nach einer Herberge. Laut Plan gibt es einige. Die erste am Weg ist ein ehemaliges Kloster und hat die größte Zahl an Betten. In der Halle werden wir von einer langen Schlange Pilgern gestoppt und sehen uns im Kreuzgang um, wo unzählige Rucksäcke herumstehen und einige Dutzend Leute warten. Nach einer Viertelstunde trottet ein Mann in schwarzer Kutte an uns vorbei und verkündet eine unheilvolle Botschaft.
»Wir sind komplett! Alle Plätze sind vergeben!«
Enttäuschung in allen Gesichtern. Schnell löst sich die Schlange auf, Rucksäcke werden geschultert und alle eilen davon, als hätte es soeben eine Bombendrohung gegeben. Die zwei Französinnen greifen die Gelegenheit am Schopf, gehen ins Empfangszimmer und diskutieren mit dem Mönch. Dieser schüttelt beharrlich mit dem Kopf. Der Belgier und ich warten, bis die beiden zurückkehren und uns die Situation erklären.
»Soweit ich verstanden habe, ist es so: es gibt drei Herbergen in dieser Stadt«, beginnt Juli, worauf ich erleichtert aufatme. Und setzt fort: »und alle sind komplett belegt. Heute gab es offensichtlich einen riesigen Pilgeransturm.« Mein Atem stockt. Sie schlägt vor: »Wir fragen uns durch alle Bars und Restaurants durch, ob jemand privat etwas anbietet.« Sie geht voran, betritt eine Gaststätte nach der anderen und kehrt stets ohne gute Nachrichten zurück.
Mir wäre auch nichts Besseres eingefallen. Aber ich bin immer froh, wenn ich warten darf, während ein anderer die Dinge regelt. So langsam komme ich nun doch in Pilgerstimmung. Genau das ist es, was mich an dieser Art Urlaub begeistert. Die Gemeinschaft. Das Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit, wenn sich jemand anderes darum bemüht, jegliche Schwierigkeiten und Komplikationen für die Gruppe aus dem Weg zu räumen.
»Sie kennt jemanden, der eine Herberge außerhalb des Ortes betreibt.« Juli kommt endlich freudestrahlend und in Begleitung einer älteren Dame aus einem Restaurant. »Er wird uns gleich abholen«
»Es wird eine Weile dauern, bis euch mein Schwiegersohn kommt«, erklärt die Dame. »Ihr könnt euch solange auf die Terrasse setzen. Darf ich euch etwas bringen?«
Das Angebot nehmen wir gerne an und verkürzen die Wartezeit mit Bier, das uns die freundliche Dame postwendend serviert und stoßen auf den Camino an. Auf das Glück, noch eine Unterkunft bekommen zu haben, stoßen wir mit dem zweiten Bier an. Ein Auto kommt heran und hält direkt neben der Terrasse. Als der Fahrer aussteigt und winkt, leeren wir hastig unsere Gläser. Sogleich nimmt er unsere Rucksäcke entgegen, verstaut sie im hinteren Teil seines Kombis und wenig später rasen wir in einer selbst für Nichtpilger unangemessenen Geschwindigkeit über die Landstraße.
Als wir in eine Hofeinfahrt einbiegen, erkenne ich anhand meiner losen Zettel, wo wir uns befinden. Eine private Herberge in Bolibar. Somit haben wir drei Kilometer des Caminos abgekürzt. Ein Betrug am Pilgergedanken. Das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Nachdem ich wenige Tage zuvor den Weg durch hässliches, eintöniges Industriehafengebiet einer kurzen Überfahrt über die Bucht vorgezogen hatte, wäre dieses kurze Stück nicht die geringste Zumutung gewesen. Wir hätten durch eine grüne Berglandschaft wandern können …
»Wir sind da!« Der Fahrer zurrt die Handbremse fest und eilt zum Kofferraum. Er wirkt gehetzt und ich kann meinen Rucksack gerade noch auffangen, bevor er schon vorauseilt und uns zum Eingang führt. Dies passt weder zum Pilgern, noch zur spanischen Gelassenheit. Vielleicht zur baskischen Art. Vom Taxifahrer wandelt der Mann sich zum Fremdenführer und nimmt zwischendurch einen Anruf auf seinem Handy entgegen. Nach den Schlussworten ›ich komme gleich‹ kümmert er sich wieder um unsere Gruppe und weist uns die Schlafplätze zu. Auf die Frage, was diese Fahrt kosten würde, schüttelt er den Kopf.
»Ich bin der Geschäftsführer der Herberge. Ich habe das baufällige Gebäude erworben, renoviere es derzeit und freue mich über jeden Gast.« Er fragt sogleich: »Habt ihr schon eine Unterkunft für den nächsten Tag? Ich würde vier Plätze für euch in der Herberge von Guernika reservieren. Es wäre besser so, denn im Moment ist die ganze Welt auf dem Pilgerweg und eine Reservierung ist sinnvoll.«
Spontan stimmen wir zu. Er telefoniert kurz und lächelt uns an. »Alles geregelt. Vier Plätze sind reserviert und jetzt entschuldigt mich, ich muss die nächsten Pilger abholen.« Sofort ist er wieder verschwunden.
Der Mann ist ein Vollblut-Unternehmer. Möglicherweise wie die Pioniere der Aufbruchszeit unter Ludwig Erhardt, die ihre Chance ergriffen und sich wie besessen für ihren Erfolg eingesetzt haben. Die Renaissance des Jakobsweges scheint eine ähnliche Wirkung zu haben, wenn sich manche dermaßen verausgaben, um eine große Vision zu verwirklichen.
Als ich mich nach einer Waschmöglichkeit für meine Klamotten umsehe, betrete ich halbfertige Zimmer, bis ich den richtigen Raum finde. Säcke mit Wandputz und Maurerkellen liegen umher, Rohbauflair und nackte Backsteine bestätigen abermals, dass der Inhaber unglaublich fleißig sein muss. Hoffentlich übertreibt er es nicht und nimmt auf seine Gesundheit Rücksicht.
Nachdem ich meine Wäsche auf die Leine im Vorgarten gehängt habe, geselle ich mich zu den Pilgern auf die Terrasse.
»Ist das nicht ein großes Glück? Wir haben nicht nur auf den letzten Drücker einen Platz in einer supermodernen Herberge bekommen, sondern auch schon eine Unterkunft für morgen.« Die französische Pilgerin namens Juli strahlt mich an. »Außerdem sind uns einige Kilometer erspart geblieben.«
Ich überlege, wie ich ihr mein Problem erklären soll. So läuft nicht das wahre Pilgern, sondern Tourismus. Eine Rundumversorgung für den lieben Gast statt eines Überlebenskampfes, bei dem man sich Abend für Abend um das letzte Bett streitet. Die Zeit außerhalb der Zivilisation zu verbringen, das soll eine Herausforderung sein und eine Konfrontation mit nicht alltäglichen Schwierigkeiten mit sich bringen. Zuoberst steht eine Heilige Regel: niemals nimmt man eine Abkürzung mit dem Automobil. Ich habe sie gebrochen und das macht meinen ursprünglichen Plan zunichte, den Weg ausschließlich im Pilgerstil zurückzulegen. Ich erkläre es ihr in Kürze: »Mir fehlen drei Kilometer vom Camino del Norte.«
Juli schweigt und sieht mich nachdenklich an. Ein Pilger beginnt auf einer Ukulele zu spielen. Der Herbergsunternehmer hatte in der Zwischenzeit weitere Pilger mit seinem Auto herangekarrt und diese stimmen in Französisch ein, während der musikalische Wanderer auf der kleinen Gitarre zupft. Es ist immer interessant, mit Franzosen, Spaniern oder Italienern unterwegs zu sein. Sie kennen viele Musikstücke, die sie auswendig mitsingen können. In Deutsch würde mir nichts Geeignetes einfallen. Außer Alle meine Entchen, Fuchs, du hast die Gans gestohlen oder Hänschen klein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jemand in meinen Alter solche Texte mitsingen würde, wenn er noch halbwegs nüchtern ist.
Abends versammeln wir uns zum Pilgermenü im Gemeinschaftsraum. Der Inhaber ist gleichzeitig der Koch und berät uns bei der Auswahl. Seine Ehefrau serviert die Mahlzeiten. Zum Schluss empfiehlt er uns, ein Kloster in der Nähe zu besichtigen. Da er verspricht, dass dieses Bauwerk absolut sehenswert sei, verabredet sich unsere neue Pilgergemeinde zu einer Abendwanderung.
»Wie wirst du das Problem mit den verlorenen drei Kilometern lösen?«, fragt mich Juli, als wir die Straße hinaufwandern und das spirituelle Gebäude in Sichtweite kommt. »Du könntest beispielsweise einige Male um das Kloster herumlaufen.«
Ich vertiefe mich in Berechnungen, bis ich eine Lösung aus dem Dilemma finde.
»Ein paar Tage zuvor habe ich einen Wegweiser verpasst und bin einen Umweg gelaufen. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind die fehlenden Kilometer wohl ausgeglichen.«
»Dann sind ja alle Probleme gelöst.« Sie lächelt verschmitzt.
Als wir die Kirche besichtigen und uns alte Männer mit gebeugtem Rücken entgegenkommen, überlege ich, ob dieses Gebäude als Altenheim genutzt wird. Die schwarze Robe der Männer weist jedoch darauf hin, dass es sich bei den betagten Herren um Mönche handelt. Offensichtlich fehlt es diesem Kloster an Nachwuchs. Das Zölibat wurde zu streng eingehalten.