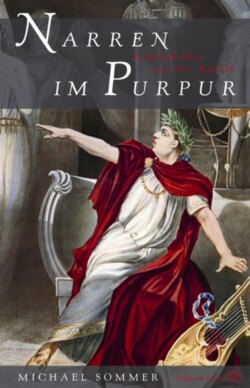Читать книгу Narren im Purpur - Michael Sommer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Phönix aus der Asche
ОглавлениеAls sich im 9. oder vielleicht schon 10. Jahrhundert v. Chr. die ersten Händler aufmachten, um mit kleinen Schiffen weit entfernte Küsten zu bereisen, brauchten sie im Grunde genommen nur die vorhandenen kleinen Handelskreisläufe zu einem großen mediterranen System zusammenschweißen. Diese Rolle fiel den Phöniziern zu, deren Städte wie Perlen einer Kette an der levantinischen Küste aufgereiht waren: Arados, Byblos, Sidon und Tyros – so lauteten, von Nord nach Süd, die Namen der großen Städte, zu denen sich noch ein Dutzend kleinerer Siedlungen gesellte. Typischerweise lagen sie auf dem Festland vorgelagerten Inseln oder Halbinseln: Der Blick ihrer Bewohner richtete sich nach Westen, übers Meer.
Wie Phönix aus der Asche, so erhoben sich diese Städte auf den Trümmern der bronzezeitlichen Welt. Jahrhundertelang waren sie großen Imperien tributpflichtig gewesen, die ihrer politischen und wirtschaftlichen Entwicklung enge Grenzen gesetzt hatten. Mit dem Kollaps der großen Reiche am Ende der Bronzezeit hatten ihre Bewohner Handlungsspielräume, die eine Dynamik ganz neuer Art entfachten. Erstmals schickten sich ganze Gesellschaften an, nicht von der Landwirtschaft, sondern in großem Stil von Handel und Gewerbe zu leben.
Als Erste bekamen den Wandel die Ägypter zu spüren. Um 1075 v. Chr. spielt eine Episode, die in der uns vorliegenden Form Fiktion ist, sich aber durchaus so oder ähnlich hätte zutragen können: Der Gesandte Wenamun schifft sich vom Nildelta aus nach Byblos ein, um von dort Holz zu beschaffen, aus dem ein neues Kultschiff für den Gott Amun gebaut werden soll – die Hölzer des Libanon, vor allem die Zeder, die noch heute die Fahne des modernen Staates ziert, waren in den baumlosen Flusstälern Mesopotamiens und Ägyptens besonders begehrt. Wenamun verschlägt es fast die Sprache, als der König von Byblos, Sekerbaal, als Gegenleistung die Lieferung ägyptischer Waren fordert. „Ich bin nicht dein Diener und nicht der Diener desjenigen, der dich schickte“, stellt Sekerbaal lakonisch fest, woraufhin Wenamun nichts übrig bleibt, als nach Ägypten zurückzusegeln und die Tauschgüter zu beschaffen.3
Hatten sich die Herrscher von Byblos zuvor damit begnügt, wenn Pharao, die „Sonne“, über ihnen sein Licht leuchten ließ und Holz mit Gnade bezahlte, so forderten sie nun ein materielles Quid pro quo. Der asymmetrische Tausch zwischen Zentrum und Peripherie eines Großreichs war zu einem symmetrischen Handel unter Partnern geworden, die einander auf Augenhöhe begegneten. Und bald hatten die Phönizier die besseren Karten, wenn sie mit ihren Nachbarn am Verhandlungstisch saßen: Die Bücher Könige und Chronik des Alten Testaments berichten, wie König Salomo, als er seinem Gott den Tempel in Jerusalem errichtete, Hilfe von seinem „Bruder“, dem König Hiram von Tyros erhielt. Hiram lieferte Material, stellte Arbeitskräfte zur Verfügung und vor allem Know-how. Als Gegenleistung erhielt Tyros von Salomo Lebensmittel, die in der rapide wachsenden Inselstadt dringend benötigt wurden. Wichtiger noch: Salomo trat Land an Tyros ab, den Grundstock für den Territorialstaat, den die phönizische Stadt auf dem Festland errichtete. Dafür durften sich die Hebräer an Handelsmissionen der Tyrer beteiligen, die sie bis nach Spanien (Tarschisch) und Ophir (Arabien, vielleicht sogar Afrika) führten.
Immer wieder sind es phönizische Herrscher, die geschickt die Reichtümer ihres Landes zu vermarkten wissen. Ähnlich wie in der Bronzezeit schildern uns die Texte den Königspalast als Mittelpunkt aller wirtschaftlichen Aktivitäten. Doch werfen Quellen wie das Alte Testament und der Wenamun-Bericht womöglich mehr Fragen auf, als sie beantworten: Die Chronologie ist verworren, und über die Frage, ob es überhaupt einen König Salomo gab, streiten sich bis heute die Gelehrten. Die Dokumente referieren keinen phönizischen Standpunkt, sondern die Position der Nachbarn. Immerhin dürfte außer Zweifel stehen, dass die phönizischen Städte sich um 1000 v. Chr. von den Großmächten emanzipiert hatten und bereits zum Sprung nach Übersee ansetzten.
Dieser Befund lässt sich gut mit den archäologischen Zeugnissen aus der frühen Eisenzeit in Einklang bringen. Die materielle Kultur Zyperns, bis dato eine der Drehscheiben zwischen Ägäis und Vorderasien, verrät wachsenden phönizischen Einfluss. Levantiner scheinen sich sukzessive in den Güteraustausch mit der Ägäis eingeschaltet zu haben, wie die Funde von Salbgefäßen auf Rhodos nahelegen, die erst aus zyprischer, dann aus lokaler und schließlich aus phönizischer Herstellung stammten. Schließlich bezeugen Funde aus Elitengräbern auf Zypern (Salamis) und Euboia (Lefkandi), dass griechische Aristokraten Kontakte zur Levante pflegten. Umgekehrt tauchte griechische Importkeramik aus Euboia in Al Mina auf.
Dass es Handelsherren aus Phönizien und nicht aus Griechenland waren, die den lokalen Handel erneut zu einem großflächigen System vernetzten und somit den aktiven Part spielten, lassen die beiden homerischen Epen, Ilias und Odyssee, erahnen, in denen Phönizier eine prominente, wenngleich etwas zwielichtige Rolle spielen. Zwar gelten sie als geübte Fabrikanten von Luxusartikeln, die ihren immensen Wert allein schon aus ihrer „sidonischen“ Herkunft beziehen, andererseits aber auch als ausgebuffte Krämerseelen mit zweifelhafter Moral und ausgeprägtem Hang zur Profitgier. Die Helden der Ilias wissen die von „sidonischen Frauen“ hergestellten Gewänder aus edlen Stoffen ebenso zu schätzen wie das silberne Mischgefäß, das Achill bei den Leichenspielen für seinen Freund Patroklos als Kampfpreis aussetzte: „an Schönheit trug’s den Sieg davon auf der gesamten Erde, denn Sidoner voller Kunstsinn hatten’s schön gefertigt“ (XXIII. 742f.).
Doch erfahren wir auch, wie die Phönizier ihren Handel organisierten und welche Geschäftspraktiken zur Anwendung kamen. Der Schweinehirt Eumaios, der für Laertes, den Vater des Odysseus arbeitet, erzählt dem Helden der Odyssee seine tragische Lebensgeschichte: Einst kamen Phönizier zu Schiff auf die Insel Syria, auf der Eumaios’ Vater König war. Eine phönizische Sklavin lebte am Hof, die mit ihren Landsleuten einen raffinierten Fluchtplan ausheckte: Nachdem die Phönizier ein ganzes Jahr auf der Insel verbracht hatten und feilschend die von ihnen mitgeführten Waren abgesetzt sowie andere erhandelt hatten, raffte die Phönizierin im Haus des Königs einige Wertgegenstände zusammen und entführte den jungen Prinzen Eumaios; dann machten sich alle davon. Schließlich verkauften die Händler Eumaios an Laertes.4
In einer anderen Episode – Odysseus hält seine Identität vor Eumaios geheim – erfindet sich der Listenreiche eine abenteuerliche Lebensgeschichte, die ihn bis an den Hof des ägyptischen Pharao führte. Auch hier spielt ein Mann aus Phönizien Schicksal. Er überredet den fiktiven Odysseus, mit ihm nach „Phoinike“ zu kommen, wo er Ländereien besitze. Nachdem sie einige Zeit dort verbracht haben, lädt der Phönizier den Helden ein, ihn als Kompagnon auf eine Handelsexpedition nach Libyen zu begleiten. Beide erleiden Schiffbruch, und Odysseus rettet sich an die Küste von Epirus, im heutigen Nordwestgriechenland.5
Das Bild vom phönizischen Fernhandel gewinnt damit etwas schärfere Konturen. Die Kaufleute waren zugleich Seeleute; sie bildeten Gesellschaften, die gemeinschaftlich ein Schiff nutzten und sich um einen Anführer scharten, der Initiator und Organisator des Projekts war; vor allem kamen sie ohne die großen Organisationen von Tempel und Palast aus, die in der Bronzezeit das Handelsgeschehen, wenn nicht monopolisiert, so doch dominiert hatten. Die Händler hielten sich relativ lange an den einzelnen Zwischenstationen auf, aber wohl kaum ein ganzes Jahr, wie es in der Odyssee heißt. Während ihres Besuchs betrieben sie geldlosen Tauschhandel mit den Einheimischen, wobei sie sich wie alle Zwischenhändler, ohne es zu kennen, Ricardos Prinzip der komparativen Kostenvorteile – fluktuierende Preise bei unterschiedlicher Verfügbarkeit verschiedener Waren – zunutze machten. Die Grenzen zwischen Seehandel, Gabentausch, Piraterie und Abenteurertum waren durchaus noch fließend.
Vor allem aber spielten ethnische Gesichtspunkte bei der Zusammensetzung der Mannschaften offenbar kaum eine Rolle. Wir dürfen uns die Crews der kleinen Handelsschiffe, die im 9. und 8. Jahrhundert v. Chr. – der Zeit, als die homerischen Epen allmählich zu ihrer um 700 v. Chr. verschriftlichten Form fanden – auf dem Mittelmeer segelten, getrost als bunt zusammengewürfelte Haufen vorstellen, anders als die Kaufmannshansen des europäischen Mittelalters, bei denen landsmannschaftliche Prinzipien im Vordergrund standen.