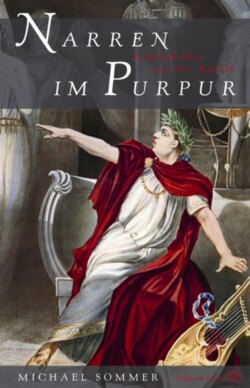Читать книгу Narren im Purpur - Michael Sommer - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Homo mercator
ОглавлениеFernhandel war ohne Frage ein gewichtiger Faktor beim Zustandekommen jener Mittelmeerwelt, die wir als „klassische“ Antike zu sehen gewohnt sind. Zeit also, einen Moment innezuhalten, um zu versuchen, die Bedeutung, die Güteraustausch für die Menschen des Altertums hatte, zu ermessen und ansatzweise zu quantifizieren. Wir gehen heute selbstverständlich davon aus, dass Menschen sich in ihren Entscheidungen von wirtschaftlichen Zielsetzungen leiten lassen: Ein hoher Lebensstandard und materielle Sicherheit gehören zu den Dingen, die allgemein als erstrebenswert gelten. Um all das zu erreichen, handeln Menschen ökonomisch „zweckrational“ – wir arbeiten hart, um uns unseren Wohlstand leisten zu können. Arbeitskraft, Wohnraum, Güter, Dienstleistungen – für alles gibt es einen Markt, auf dem Angebot und Nachfrage über den Preis entscheiden. Das reine Marktprinzip wird, wenigstens in westlichen Wohlfahrtsstaaten, durch Institutionen – den Staat, Steuern, Gesetze, Ethik und Moral – abgeschwächt und in seinen Auswirkungen abgemildert, im Großen und Ganzen aber gilt, dass sie unseren Lebensalltag zu einem Gutteil bestimmen: Der moderne Mensch ist, nicht nur, aber auch, ein homo oeconomicus, der sich marktkonform verhält.
Wir neigen dazu, unsere eigenen Lebenserfahrungen auf Menschen vergangener Epochen zu projizieren. Dabei gehen wir von falschen Voraussetzungen aus: Erstens waren die Bedingungen, unter denen Phönizier, Griechen oder Römer lebten, eben nicht die gleichen wie in einer modernen Gesellschaft; zweitens ist die Frage, ob Menschen sich in gleichen Situationen auch ähnlich verhalten, ob Geschichte also von anthropologischen Konstanten oder Variablen beherrscht wird, zumindest offen. Seit der Nationalökonom Karl Bücher vor gut 100 Jahren behauptete, die komplexe Volkswirtschaft sei eine Errungenschaft der Neuzeit, während antike und mittelalterliche Gesellschaften auf den primitiveren Stufen der Haus- und Stadtwirtschaft verharrt hätten, schwelt der Streit um die „Modernität“ des antiken Wirtschaftens.
„Modernisten“ (in der Tradition des deutschen Althistorikers Eduard Meyer) sind seither nicht müde geworden, auf Quellen zu weisen, die allesamt die Bedeutung von Märkten, Güteraustausch, Angebot und Nachfrage als Preisregulierungsmechanismen zu belegen scheinen. Sie zeichnen das Bild vom Mittelmeerbecken als eines integrierten Wirtschaftsraums, in dem reger Güteraustausch herrschte und in dem das Gewinnstreben zahlloser Individuen nie versiegende Warenströme in Gang hielt – die wirtschaftliche Entsprechung zu Platons Froschteich sozusagen. Mit Recht verweisen sie darauf, dass nicht nur leicht zu transportierende, hochwertige „Luxusartikel“ die Runde machten, sondern in großem Stil auch das Massengut Getreide, mit dem namentlich die Metropolen Athen und Rom, aber auch zahlreiche andere Städte, zu ihrer Blütezeit über beträchtliche Distanzen hinweg versorgt wurden.
Natürlich konnten sich die Einwohner einer Großstadt, wie es Athen im 6. und erst recht im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. war, nicht selbst mit Lebensmitteln versorgen. Die Stadt bevölkerten unzählige Menschen, die agrarisch nicht selbst produktiv waren. Aber auch die Bauern Attikas, das politisch zu Athen gehörte, produzierten nicht genügend Überschüsse, um die Stadt zu ernähren. Deshalb importierte Athen bereits seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. Getreide, vorwiegend aus dem Schwarzmeergebiet. Dessen Städte und deren Eliten wurden von Athen mit Ehrungen überhäuft, um günstige Konditionen für den Import herauszuholen. Außerdem richtete die Polis ein Gutteil ihrer diplomatischen und militärischen Initiative darauf, den Seehandelsweg durch die Dardanellen zu sichern. Vom Nachschub aus dem Schwarzen Meer abgeschnitten zu werden, bedeutete für Athen zweimal den politischen Bankrott: am Ende des Peloponnesischen Kriegs (431–404 v. Chr.) und in der Frühphase der makedonischen Expansion, als Philipp II. Thrakien und die Meerengen unter seine Kontrolle brachte (ab 342 v. Chr.). Die Getreideversorgung war für die Stadt eine vitale Frage.
Entsprechend setzte man die politischen Prioritäten: Gesetze stellten den Export von Lebensmitteln unter Strafe und schufen Anreize für Importeure; in Athen ansässige Kaufleute durften Getreide nur im Piräus anlanden und mussten es dort auch weiterverkaufen; Aufseher überwachten den lokalen Handel und hatten die Aufgabe, Spekulation zu unterbinden; die Polis schließlich streckte ihre Fühler aus zu den getreidereichen Gefilden Zyperns, Ägyptens und Siziliens. Umgekehrt bot der Getreidehandel der Profitgier von Importeuren wie Produzenten ein schier grenzenloses Betätigungsfeld. Sie kauften den Markt leer, horteten Getreide und trieben so den Preis nach oben. Sie versuchten, dasselbe zu erreichen, indem sie Kartelle bildeten. Als gewiefter Geschäftsmann unterhielt Kleomenes von Naukratis, den Alexander zu seinem Statthalter in Ägypten bestellte, ein Netz von Informanten im Ägäisraum, um so Engpässe in der Getreideversorgung zum eigenen Vorteil ausnutzen zu können. Im geeigneten Moment kaufte er große Mengen der ägyptischen Ernte auf und verkaufte sie wenig später zu Wucherpreisen weiter.
Außerordentliche Gewinnmargen konnten auch Fernhändler erzielen, die als Spediteure ägyptischen Getreides nach Rom tätig waren. Augustus hatte Ägypten zur Provinz gemacht und der neuen Kornkammer des Reiches schon dadurch einen besonderen Status verliehen, dass er sie einem Präfekten aus dem Ritterstand unterstellt und Senatoren untersagt hatte, das Nilland zu betreten. Auch andere Güter des täglichen Bedarfs strömten – ebenso wie Luxuswaren – über den Hafen Ostia in die Hauptstadt. Die Logistik des Transports übernahmen Privatleute. Der reiche Lebemann Trimalchio, einer der Protagonisten aus Petrons Roman Satyricon, ist literarische Fiktion. Modell dürften aber die Massen von Emporkömmlingen gestanden haben, die der wirtschaftliche Boom der Gründerjahre des Imperiums nach oben gespült hatte. Als Freigelassener hatte sich Trimalchio durch Handelstätigkeit zu einem sagenhaften Vermögen emporgearbeitet, das er später in Grundbesitz investierte. Den Gästen seines Gastmahls gegenüber prahlte er in ungeschliffener Rede:
„Ich habe zu Handelsgeschäften Lust bekommen. Um euch nicht lange aufzuhalten: fünf Schiffe habe ich gebaut, Wein geladen – und damals wog er Gold auf –, nach Rom geschickt. Es war, als hätte ich’s bestellt: alle Schiffe sind gekentert, Tatsache, kein Theater. An einem Tag hat Neptun dreißig Millionen geschluckt: Denkt ihr, ich hätte schlapp gemacht? Weiß Gott, mir ist dieser Schaden egal gewesen, so wie gar nicht geschehen. Ich habe andere machen lassen, größer und besser und einträglicher, so dass keiner da war, der mich nicht einen Leistungsmenschen nannte. Ihr wisst, ein großes Schiff kann Großes leisten. Ich habe wieder Wein geladen, Speck, Bohnen, Parfüm, Sklavenware. An diesem Punkt hat Fortuna [Trimalchios Gattin] ein gutes Werk getan; nämlich ihren ganzen Schmuck, die ganze Garderobe hat sie verkauft und mir hundert Goldstücke in die Hand gedrückt. Schnell kommt, was der Himmel will. Mit einer einzigen Fahrt habe ich zehn Millionen zusammengehamstert. Sofort habe ich alle Grundstücke eingelöst, die meinem früheren Herrn gehört hatten. Ich baue ein Haus, kaufe Knechte ein, Packtiere; was ich anfasste, setzte alles an wie eine Wabe.“8
Obwohl hier ohne Frage dick aufgetragen wird, macht der Text doch deutlich, was für Profite im Fernhandel lockten. Die Versorgung der Hauptstadt Rom war ein Bombengeschäft und wer daran Anteil hatte, trug ein hohes Risiko, das sich aber auszahlen konnte. Hinter den Fernhändlern und Spediteuren vom Schlage Trimalchios stand eine gewaltige Infrastruktur, die von Geldgebern über Häfen und Speicher bis hin zur cura annonae reichte, jener den kurulischen Ädilen unterstehenden Behörde, die für adäquate Bevorratung der Hauptstadt mit Getreide und die Versorgung des städtischen Proletariats Sorge zu tragen hatte. In puncto Spekulantentum standen die Kreditgeber, die in Rom wie bereits in Athen Fernhandel treibenden Kaufleuten „Seedarlehen“ zu exorbitanten Zinssätzen gewährten, den Händlern in nichts nach. Verschiedene Berufsgruppen verdienten sich am unersättlichen Hunger der Hauptstadtbevölkerung eine goldene Nase.
Dennoch wäre es übereilt, der attischen oder römischen Wirtschaft deshalb das Etikett „modern“ anhängen, gar einen antiken „Kapitalismus“ am Werk sehen zu wollen. Ein Freigelassener wie Trimalchio war zwar arbeit- und genügsam (immerhin ließ er seine Frau Fortuna ihren Schmuck versetzen), zielstrebig und risikofreudig, sobald er aber am Ziel war und ein hübsches Sümmchen eingefahren hatte, ließ er Sekundärtugenden, wie sie den ehernen Kern von Max Webers „protestantischer Ethik“ ausmachten, mit Freuden hinter sich. Gerade kein Bruder im Geiste des frühneuzeitlichen Unternehmers im europäischen Nordwesten, vermehrte er nicht sein Vermögen, um es zu investieren. Stattdessen setzte er sich als Großgrundbesitzer zur Ruhe, gab rauschende Feste und münzte so reales in symbolisches Kapital um: Prestige und Status statt Betriebskapital und Rücklagen. Die „ursprüngliche Akkumulation“ großer Kapitalmengen, die Marx zur historischen Voraussetzung kapitalistischer Produktionsverhältnisse erklärte, konnte mit saturierten Unternehmern vom Typus Trimalchio in der Antike nicht stattfinden.
Hier setzen „Primitivisten“ (wie Bücher und nach ihm Weber, der Wirtschaftswissenschaftler Karl Polanyi und der Althistoriker Moses Finley) mit ihrer Kritik an der „modernistischen“ Deutung antiken Wirtschaftens an. Individuen trieb nicht in erster Linie der Hunger nach immer mehr Kapital, sondern das Streben nach gesellschaftlichem Ansehen um. Für Trimalchio war sein Engagement im Fernhandel nichts weiter als ein Vehikel, um Status zu erlangen, so parvenühaft sich dieser Versuch aus der Perspektive eines Aristokraten wie Petronius ausnehmen mag. Gesellschaften trieben Fernhandel, um ihren Bedarf an Gütern zu decken, die sie nicht selbst produzieren konnten. Dass etwas anderes als die Landwirtschaft die materielle Grundlage eines Volkes sein konnte, wäre weder Griechen noch Römern vermittelbar gewesen.
So überrascht nicht, dass Kaufleute im antiken Hellas und Rom, ganz im Gegensatz etwa zum mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa, kein übermäßig hohes Ansehen genossen. In Athen waren die in Attika ansässigen Fremden, die Metöken, der wirtschaftlich bei Weitem aktivste Teil der Bevölkerung. Im Imperium Romanum spielten dieselbe Rolle oft Freigelassene wie Trimalchio. Von ihren Elfenbeintürmen sahen die Philosophen der griechischen Klassik und ihre hellenistischen und römischen Epigonen geflissentlich auf all jene herab, die sich für ihren Lebensunterhalt um Lohn verdingten, darunter auch die Händler. Über Geldgier und Besitzstreben mokierten sich schon im 6. Jahrhundert v. Chr. der attische Gesetzgeber Solon und der aristokratische Dichter Theognis von Megara. „Die Landwirtschaft ist am besten, weil sie gerecht ist. Denn sie geht nicht auf Kosten der Menschen, ob die es nun wollen, wie im Handel und bei Lohnarbeit, oder ob sie es nicht wollen, wie im Krieg.“ – so etwa heißt es im 1. Buch des fälschlich Aristoteles zugeschriebenen Oikonomikos.9 Vom wirklichen Aristoteles stammt zwar eine rudimentäre Theorie der Preisbildung, Fernhandel ließ der Lehrer Alexanders des Großen aber nur gelten, wenn er dem politischen Imperativ, die Selbstversorgung der Polis wiederherzustellen, untergeordnet ist. Und in römischer Zeit hieß Cicero lediglich den Großhandel (mercatura magna et copiosa10) gut, während der Detailhandel wie das Gewerbe „als schmutzig zu gelten hat“. Von hier führt eine gerade Linie zu einem berühmten Satz des Kanonischen Rechts, der aus der Spätantike stammen dürfte, aber im europäischen Mittelalter noch beträchtliche Wirkung entfalten sollte: homo mercator vix, aut nunquam potest DEO placere.11
Ganz anders über die Bedeutung des Fernhandels dachten offensichtlich die Phönizier und ihre Erben im mediterranen Westen, die Karthager. Bereits Max Weber nannte sie das „erste Handelsvolk“ der Weltgeschichte. Tatsächlich war ja im Fall von Tyros die Existenz einer ganzen Stadt auf den Fernhandel abgestellt. Während in Athen, Sparta und Rom jeweils Grundbesitzerklassen das Regiment führten, gab in den phönizischen Stadtstaaten eine Fernhändler-Oligarchie auch politisch den Ton an. In Karthago ging das vermutlich so weit, dass nur Kaufleute überhaupt Vollbürger waren. Sie machten die Stadt zum Sachwalter ihrer kommerziellen Interessen. Das „Reich“, das Karthago Zug um Zug im westlichen Mittelmeer errichtete, war darauf zugeschnitten, Rohstoffquellen mit Absatzmärkten zu verknüpften – und stand damit dem British Empire der Moderne gewiss näher als etwa dem römischen oder osmanischen Imperium. Roms Sieg über Karthago nach drei blutigen Kriegen war, zugespitzt formuliert, auch ein Sieg des aristotelischen zoon politikon über den homo oeconomicus, der das phönizisch-punische Mittelmeer bevölkerte.