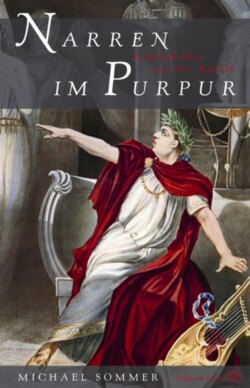Читать книгу Narren im Purpur - Michael Sommer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEinleitung
„Lebensbilder aus der Antike“ – hinter diesem Untertitel verbergen sich 15 kleine Essays, die seit 2004 nach und nach für das Geschichts-Magazin DAMALS entstanden sind und hier, in gesammelter Form und überarbeitet, einem interessierten Publikum zugänglich gemacht werden.1 Fern von dem Anspruch, eine systematische Einführung in die Antike sein zu wollen, möchte diese Sammlung vor allem neugierig machen: auf eine Epoche, die uns fern und doch so seltsam vertraut ist und die der Klassische Philologe Uvo Hölscher deshalb „das nächste Fremde“ genannt hat; neugierig gerade auch auf die Episoden antiker Geschichte, die nicht im Schulunterricht und selten in populären Medien auftauchen, weil sie abseits des noch immer erstaunlich mächtigen Kanon dessen liegen, was wir als klassisch zu sehen gewohnt sind.
Aufmerksamen Lesern wird ohnehin beim Überfliegen des Inhaltsverzeichnisses kaum entgangen sein, dass die Protagonisten der folgenden Kapitel nicht die großen Gestalten der griechischen und römischen Antike sind: Perikles und Alexander, Caesar und Augustus tauchen, wenn überhaupt, dann nur als Randfiguren auf. Doch sind, bei näherer Betrachtung, der exzentrische Kaiser Elagabal oder die attalidischen Könige von Pergamon kaum weniger interessant als der große Makedone oder der Begründer des Prinzipats. Wir mögen weniger über sie wissen, weniger instruktiv für das Verständnis einer fernen Epoche sind sie darum nicht.
Oikumene: Die Globalisierung der antiken Mittelmeerwelt
Die Essays dieses Buches behandeln eine Zeitspanne von fast 1500 Jahren: von der um 1200 v. Chr. in der Levante beginnenden Eisenzeit bis zur anbrechenden Spätantike um 300 n. Chr. In diesen Jahrhunderten veränderte sich das Mittelmeer, das nicht nur geographisch im Mittelpunkt stehen wird, von Grund auf: Aus einem Meer, dessen Anrainer noch in der Zeit Homers, um 700 v. Chr., nur lose miteinander vernetzt waren, wurde in mehreren Etappen ein dichter Interaktionsraum, in dem Menschen aus entfernten Regionen miteinander kommunizierten und Handel trieben. Katalysatoren der Mobilität waren das sprunghaft anwachsende geographische Wissen, die Herausbildung großer imperialer Machtzentren und – unter römischer Ägide – die allmähliche Schaffung eines einheitlichen Rechtssystems, das geschäftlichen Transaktionen einen verbindlichen Rahmen und allen Menschen ein Mindestmaß an Rechtssicherheit gab – auch dann, wenn sie fern ihrer Heimat waren.
Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr., auf dem Höhepunkt römischer Macht, zollte der griechische Redner Aelius Aristides in seiner Rede Eis Rhomen („Auf Rom“) den Herren des Imperiums größten Respekt: Sie hätten mit der von ihnen geschaffenen Infrastruktur – Straßen, Brücken, Poststationen –, mit dem römischen Recht und dadurch, dass sie die gesamte Oikumene, die bekannte Welt jener Zeit, geodätisch vermessen hätten, eben diese Oikumene „in einen einzigen Haushalt“ verwandelt. Die logistischen Leistungen der römischen Armee illustrieren, welche Hindernisse die Truppen des Imperiums auf diesem Weg zu meistern hatten (13. Kapitel). Ein konzertierter Kraftakt römischer Legionäre, Adminstratoren, Juristen, Ingenieure und Baumeister vollendete gleichsam die „Globalisierung“ der antiken Welt, von den Ufern des Clyde bis zu den Katarakten des Nil, von Gibraltar bis zum Euphrat. Es ist dies die Welt, von der in den folgenden Kapiteln die Rede sein wird.
Freilich: Die von Aristides beschriebene Oikumene unter römischer Vorherrschaft war nur der Schlussstein einer Entwicklung, die bereits um 1200 v. Chr. eingesetzt hatte und deren Etappen für das Verständnis der Antike so fundamentale Prozesse markieren wie die „große“ griechische Kolonisation vom 8. bis zum 6. Jahrhundert v. Chr. und die Entstehung der „hellenistischen Weltkultur“ (Hermann Bengtson) seit Alexander dem Großen. Den Anfang hatten ohnehin weder Griechen noch Römer gemacht, sondern die Phönizier, die, von der Levante kommend, erst die lokalen Handelssysteme im Mittelmeer zu einem großen Netzwerk verknüpft hatten und dann selbst in Übersee sesshaft geworden waren (1. und 2. Kapitel).
Die Phönizier und in ihren Fußstapfen die Karthager exerzierten den Griechen vor, wie man eine rückständige Peripherie entwickelt und aus Disparitäten Nutzen zieht. Als Erste schufen sie, gleichsam als Nebenprodukt ihres Kommerzes, eine kulturell und sprachlich integrierte Sphäre, die zur Glanzzeit Karthagos neben dem Mutterland fast den gesamten Südrand des Mittelmeers, die großen Inseln Sardinien, Sizilien und Korsika sowie Teile der Iberischen Halbinsel umfasste. Nordafrika bewahrte bis in die Spätantike noch so viel von seinem phönizisch-punischen Charakter, dass selbst ein römischer Kaiser wie der aus Lepcis Magna stammende Septimius Severus (Kaiser von 193–211 n. Chr.) Punisch zur Muttersprache hatte.
Dass die Oikumene keineswegs so einheitlich war, wie Aristides wahrhaben wollte, und dass vielfach unter der Oberfläche tief eingewurzelte lokale Traditionen schlummerten, die nicht der „Hellenisierung“ oder „Romanisierung“ zum Opfer fielen, sondern sich unter griechischem und römischem Einfluss zu etwas völlig Neuem wandelten, offenbart ein genauer Blick auf den römischen Nahen Osten (12. Kapitel). Hier waren es vor allem die Juden, die sich heftig gegen die zwangsweise Einverleibung in Aristides’ „Haushalt“ sträubten (9. Kapitel). Welch explosives Potenzial in der Synthese aus „westlichen“ und „orientalischen“ Elementen steckte, lehrte schließlich in der Krise nach der für Rom verlorenen Schlacht von Karrhai (260 n. Chr.) die Oasenstadt Palmyra mit ihrem Cameo-Auftritt auf der weltpolitischen Bühne (14. Kapitel).
Gefallene Helden
Zu Opfern einer Geschichtstradition, die ins Horn der Sieger bläst und Verlierer unter sich begräbt, wurden nicht nur die zu „Randkulturen“ herabgedrängten Zivilisationen an der östlichen (Phönizier, Aramäer), südlichen (Karthager) oder westlichen (Kelten) Peripherie der Mittelmeerwelt. Treffen konnte es selbst jene Männer, die im Zentrum der Macht saßen: im römischen Kaiserpalast. Ob ein römischer Herrscher als „guter“ oder „schlechter“ Kaiser in die Geschichte einging, darüber entschied ein komplexes Geflecht aus Einflussgrößen und Akteuren. Es half, wenn der Imperator vor dem eigenen Ableben die Macht geordnet an einen Nachfolger weitergeben konnte, der sich dann, wie Antoninus Pius im Fall Hadrians, für die zügige Vergöttlichung des Toten per Senatsbeschluss starkzumachen hatte.
Wer, wie Nero, Domitian oder Commodus, hingegen der Letzte seiner Dynastie und gewaltsam vom Leben zum Tode befördert worden war, hatte nur geringe Chancen, dass einst kommende Generationen hymnisch seine Taten besingen würden. Statt diese Männer zu vergöttlichen, verhängte der Senat, froh, einen Tyrannen los zu sein, Gedächtnissanktionen gegen sie: Statuen wurden gestürzt, Inschriften getilgt, Gesetze für ungültig erklärt. Senatoren waren meist auch die Geschichtsschreiber – unsere Gewährsleute für die Ereignisgeschichte der Kaiserzeit, deren Berichte mit entsprechender Vorsicht zu genießen sind.
Die Porträts aus der beeindruckend langen Galerie „schlechter“ Kaiser, unter denen Rom und sein Reich ächzten, gleichen sich frappierend. Ob Caligula, Nero oder Domitian: Immer wieder lichteten sie die Reihen der Senatoren durch Gewaltexzesse; stets schwelgten sie in Luxus und widernatürlichen Ausschweifungen aller Art; oft war ihr Regierungshandeln von Wahnsinn oder wenigstens politischer Unvernunft geleitet (8. Kapitel): Narren im Purpur allesamt, waren sie der Aufgabe, ein Weltreich zu beherrschen, nicht im Mindesten gewachsen. Oder ist dieses düstere Bild nur die Version der Wahrheit, die uns die antiken Historiographen, Männer vom Rang eines Tacitus oder Cassius Dio, glauben machen wollen? Waren Kaiser wie Domitian (10. Kapitel) oder der in eine syrische Priesterdynastie hineingeborene Elagabal (11. Kapitel) womöglich einfach nur ihrer Zeit voraus?
Eine Schlüsselrolle bei vielen blutigen Machtwechseln im kaiserzeitlichen Rom spielten die Prätorianer, von Augustus als kaiserliche Leibgarde aufgestellt, deren Soldaten sich aber immer wieder in der Rolle von Kaisermachern – und oft auch Kaisermördern – wiederfanden (7. Kapitel). Den Zenit ihrer Macht erreichten die Gardesoldaten unter Tiberius, als ihr Präfekt Seianus für den im wonnigen Capri weilenden Kaiser über Jahre die Geschäfte führte. Doch wurde den Prätorianern ihr Einfluss, der immer wieder auch mit den Interessen der kämpfenden Truppe kollidierte, schließlich zum Verhängnis: Septimius Severus stellte die Garde, die in der römischen Geschichtsschreibung keine gute Presse hatte, kalt, indem er eine reguläre Legion vor den Toren Roms stationierte.
Dass selbst über Roms engste Verbündete die Geschichte hinweggehen konnte, mussten die attalidischen Herrscher Pergamons leidvoll erfahren. Dem Imperium in grenzenloser Loyalität verbunden, hatten sie als Alliierte ausgespielt, sobald die einst mächtigen Gegner im hellenistischen Osten – Makedonien und das Seleukidenreich – in einer Serie blutiger Kriege niedergerungen waren. 133 v. Chr. sah sich der letzte Attalidenherrscher genötigt, sein Reich den Römern zu vermachen, die aus Pergamon ihre Provinz Asia machten (3. und 4. Kapitel).
Historische Verlierer waren, jeder auf seine Art, schließlich auch die beiden Antagonisten des großen Sklavenkriegs, unter dem von 73 bis 71 v. Chr. Italien erbebte (5. und 6. Kapitel). Crassus konnte über die Sklaven triumphieren, doch in die Geschichtsbücher ging er ein als der Mann, der, im Schatten seiner Mittriumvirn Caesar und Pompeius stehend, einen ebenso sinnlosen wie desaströsen Krieg gegen das Partherreich entfesselte und bei Karrhai (53 v. Chr.) die Quittung dafür erhielt. Spartacus, der Führer der Sklaven, besaß militärische Begabung im Übermaß und erschien seinen Gefolgsleuten wie ein Messias. Eine Vision, wie sich die Sklaven auf Dauer dem römischen Unterdrückungssystem entziehen konnten, besaß er hingegen nicht. Deshalb war sein Scheitern nur eine Frage der Zeit.
Was ist Macht?
Spartacus band seine Gefolgsleute an sich, weil sie fest an seine Sendung glaubten und daran, dass er mit seinen exzeptionellen Fähigkeiten jede noch so verfahrene Situation meistern könne. Spartacus verhieß Erfolg und, mehr noch, Rettung und Heil. Max Weber, der Gründervater der Soziologie, hat die außeralltäglichen Führungsqualitäten eines Menschen und den Glauben der Geführten daran als „Charisma“ bezeichnet. Der charismatische Führer ist, laut Webers Herrschaftssoziologie, der Prophet oder Befehlshaber, der die Massen in seinen Bann zieht, weil er ihnen glaubhaft Sieg und Erlösung verspricht.
Vereinfacht gesagt ist Charisma eine Quelle von Macht, die Weber versteht als „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“. Immer wieder wird es in den folgenden Kapiteln um Macht gehen, die – ob wir wollen oder nicht – das elementare Movens jeder Geschichte ist, auch der alten. Die institutionalisierte Form von Macht, Herrschaft, kann sich auch durch Tradition oder Gesetz legitimieren. Damit sind im Kern die Mechanismen umrissen, die einen Herrscher an der Macht halten und seinem Willen zur Durchsetzung verhelfen. Der Vorzug der Weberschen Kategorien liegt darin, dass sie auch für ein politisches System Gültigkeit haben, das keine oder nur schwach ausgeprägte Formen klassischer Legitimität – wie etwa Investitur, Salbung, Herrscherinsignien oder ein wie auch immer geartetes dynastisches Prinzip – kennt und in dem die Herrscher weitgehend von der Akzeptanz der Beherrschten abhängen.
Viele der folgenden Kapitel, gerade zur römischen Kaiserzeit, aber auch zu Pergamon und zu Spartacus, lassen sich förmlich als Fallstudien zur Weberschen Herrschaftssoziologie lesen. Max Weber hat aber auch nützliche Kategorien zur Bewertung der antiken Wirtschaftsgeschichte beigesteuert, die in diesem Buch ebenfalls eine Rolle spielt, wenn auch nur am Rande. Eine explizite Bezugnahme auf Weber findet dennoch nur ausnahmsweise statt. Sie wäre dem episodisch-erzählenden Charakter der Darstellung unangemessen und würde den Rahmen dieses Büchleins wohl auch sprengen. Zur Vertiefung sei daher die Bibliographie im Anhang empfohlen.
1 Für die Genehmigung, die Aufsätze für diese Sammlung zu verwenden, vor allem aber für unzählige anregende Gespräche und stets konstruktive Kritik dankt der Verfasser der Chefredakteurin von DAMALS, Dr. Marlene P. Hiller.