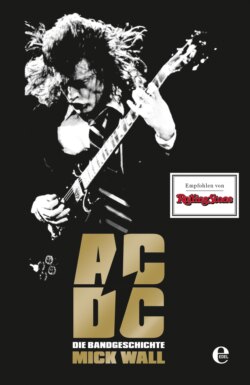Читать книгу AC/DC - Mick Wall - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 4 GROOVY OLD MAN
ОглавлениеDer Zug mit Bon Scott und den Valentines fuhr am frühen Morgen des 13. Oktober 1967 in den Bahnhof Flinders Street Station in Melbourne ein. Es war Frühling in Australien, und Melbourne – in kultureller Hinsicht die wohl europäischste aller australischen Städte – hieß die Neuankömmlinge in all seiner aufblühenden Pracht willkommen. Plötzlich sah die Zukunft für die Band nicht mehr ganz so düster aus, obschon sie gegenwärtig durchaus einige Probleme zu lösen hatten.
Ein positives Zeichen war in jedem Fall, dass der inzwischen als Manager tätige Ex-Loved-Ones-Sänger Gerry Humphries und sein Partner Don Pryor, der früher als Drummer in der Begleitband von Johnny Young gespielt hatte, die Valentines auf der Stelle unter ihre Fittiche nahmen und auch gleich etliche Gigs für sie in petto hatten. Weniger erfreulich war, dass es sich dabei um eine ganz andere Art von Gigs handelte, als Vince Lovegrove und Bon Scott im Sinn gehabt hatten, als sie den Rest der Band überredeten, ihre Familien und Freunde in Perth zurückzulassen und nach Melbourne zu ziehen.
Melbourne war damals das Zentrum der aufkeimenden australischen Musikszene. Hier befand sich nicht nur der Redaktionssitz der Go-Set, Australiens beliebtestes Jugendmagazin – und das erste, das eine nationale Hitliste veröffentlichte –, auch Fernsehsendungen wie Commotion wurden hier produziert. Die Valentines dachten sich, wenn sie es in Melbourne bis an die Spitze schaffen sollten, würde ihnen das auch überall sonst gelingen. Und beinahe wäre es auch so gekommen. Mit ihrer florierenden Club- und Pub-Szene, den vielen günstigen Proberäumen und den professionellen Aufnahmestudios – ganz zu schweigen von der jungen Film- und Modeindustrie, die sich damals in Melbourne etablierte – hatte die Stadt alles, woran es Perth mangelte. Der Umzug nach Melbourne hatte die Karriere der Valentines vorantreiben sollen. Doch anstatt einen entscheidenden Schritt weiterzukommen, mussten sie noch einmal ganz von vorne anfangen, oft genug mit Auftritten bei Kinderveranstaltungen in Kaufhäusern am Samstagmorgen.
Um ihr neues, viel jüngeres Publikum zu begeistern, strichen die Valentines alle American-Soul- und Motown-Stücke aus ihrem Set und konzentrierten sich auf Coverversionen aktueller Hits beliebter britischer Rockstars wie den Rolling Stones und The Who. Bon kam ganz gut damit klar, doch Lovegrove und die anderen fragten sich, wohin das führen sollte. Würden sie irgendwann auch wieder in richtigen Clubs auftreten? Diese Sorgen waren allerdings unbegründet. Ende 67 standen sie allabendlich schon wieder bis zu vier Mal auf der Bühne und zogen von einer Bar zur anderen, wobei es in der einen noch überfüllt und verraucht sein konnte, während in der nächsten möglicherweise überhaupt nichts los war. Besonders frustrierend war, zu wissen, dass niemand aus dem Publikum nur ihretwegen gekommen war, weil er sie unbedingt sehen wollte. Ihre finanzielle Situation war überdies mehr als angespannt. Das Geld reichte vorne und hinten nicht. Sie schnorrten Drinks, wo sie nur konnten, und lebten davon, dass ihnen Leute, die es gut mit ihnen meinten, hin und wieder eine Cola und einen Burger spendierten. Sie mieteten in dem ärmlichen östlichen Stadtteil Burwood ein winziges Reihenhaus mit zwei Zimmern im Erdgeschoss und zwei auf der ersten Etage und lungerten ansonsten in Supermärkten herum, in denen sie Kekse stahlen. Wenn sie früh morgens von einem ihrer Gigs nach Hause fuhren, hielten sie zwischendurch an und schickten Bon los, das Milchgeld zu klauen, das andere Leute vor ihren Haustüren deponiert hatten.
Der Einzige, dem dieses ganze Elend nichts auszumachen schien, war Bon. Für ihn war das alles ein großer Spaß – zumindest wirkte es so. Aber er hatte ja auch seine Freundin Maria aus Fremantle, bei der er hin und wieder übernachten konnte. Maria wohnte in dem gediegenen Melbourner Vorort South Yarra und freute sich riesig, als Bon eines Tages völlig unerwartet bei ihr klingelte. Ihre Euphorie verflog jedoch schon bald wieder, als sie feststellte, dass Bon inzwischen weder häuslicher geworden war noch über nennenswerte Einkünfte verfügte, im Gegenteil: Er hatte noch größere Probleme als früher, sich über Wasser zu halten. Einer von Bons besten neuen Freunden aus jener Zeit, der Singer-Songwriter Brian Cadd, der damals bei The Groop spielte, meint: »Er war einfach nur ultragesellig. Wenn man mit ihm zusammen war, wurde immer was getrunken und alle hatten Spaß.«
Maria wusste, dass die Valentines viele weibliche Fans zu sich in ihre Bruchbude in Burwood einluden – nicht zuletzt auch, weil die Jungs hofften, so regelmäßig beköstigt zu werden, weil die Damen oft etwas zu essen und zu trinken mitbrachten und gelegentlich auch für die Band kochten. Außerdem wusste sie, dass diese sogenannten Fans es neben Vince in der Hauptsache auf Bon abgesehen hatten. Und damit hatte sie ein großes Problem. Immer wenn Bon bei Maria übernachtete, endete es damit, dass sie ihn rauswarf. Doch obwohl er einfach nicht die Finger von den Groupies lassen konnte – und auch von jeder anderen Frau, die ihm damals über den Weg lief –, seiner Liebe zu Maria tat das keinen Abbruch. Jedes Mal, wenn er unterwegs war und nicht einfach mal bei ihr vorbeifahren konnte, schrieb er ihr mehrseitige Briefe, in denen er ihr alles Mögliche versprach. Im Interview mit Clinton Walker erzählte Maria, wie Bon sich die Zukunft für sie beide vorgestellt hatte, dass sie, wenn die Vallies einmal berühmt sein würden und einen Tourbus hätten, an diesen einen »kleinen Wohnwagen« für sie beide anhängen würden. Trotzdem, sagt Maria, »haben wir mehrfach unsere Beziehung beendet, als wir in Melbourne lebten«. Zu einer dieser Trennungen kam es kurz vor Weihnachten. Als Maria an Heiligabend spätabends in ihre Wohnung kam, stellte sie fest, dass Bon sich irgendwie Zugang verschafft und ihr ein Geschenk unter den Baum gelegt hatte. »Ein tolles Bild von einem Mädchen mit langen blonden Haaren. Das sollte ich sein. Bon war bei mir eingebrochen, hatte ein Geschenk dagelassen und war dann einfach wieder verschwunden.«
Die wirklich schwere Arbeit blieb wie immer an Lovegrove hängen. Weil er sehr gut aussehend und charmant war, kam er mit Leuten in Kontakt, die Bon niemals kennengelernt hätte, Leuten aus dem Musikgeschäft, die ihre Karriere voranbringen und ihnen viele Tipps geben konnten. Über diese Leute stolperte man nicht einfach, wenn man sich allabendlich in irgendeiner Melbourner Bar die Kante gab. Und für Bon war das ohnehin eine ganz andere Welt. Bon war Lovegrove zufolge »ein ziemlicher Draufgänger«, aber niemand, mit dem man ein ernstes Gespräch unter vier Augen führen konnte, wenn es mal erforderlich war. Bon verstand es, die Leute mitzureißen und ihnen immer zu geben, was sie haben wollten, eine ideale Eigenschaft für einen Frontman, aber wenig hilfreich in Momenten, in denen man versuchte, Außenstehende auf einer rein geschäftlichen Ebene für die Band zu interessieren. Während Bon also damit beschäftigt war, um die Häuser zu ziehen, sich mit Maria zu streiten und mit den Vallies aufzutreten, sorgte Lovegrove dafür, dass sie ihre aktuellen Konzertagenten loswurden und bei Ivan Dayman unterkamen, einem Promoter aus Brisbane, der an dem Indie-Label Sunshine Records beteiligt war, wo u. a. Normie Rowe, der größte australische Popstar der späten 60er, unter Vertrag stand. Dayman verfügte über Vorzugsrechte für eine ganze Reihe von Veranstaltungsstätten in ganz Australien, darunter insbesondere der Cloudland Ballroom in Brisbane, die Bowl Soundlounge in Sydney und die Diskothekenkette Op Pop. Die Zusammenarbeit mit ihm brachte die Band einen entscheidenden Schritt weiter.
Mit frischem Mut veröffentlichten die Valentines im Februar 68 ihre erste Eigenkomposition: eine nette kleine psychedelische Nummer im Walzertempo mit dem Titel »Why Me?«; auf der B-Seite der Single war mit »I Can Hear The Raindrops« ein ähnlich belangloser Song. Da die Valentines zu Hause immer noch sehr populär waren, schaffte es »Why Me?« in Perth in die Top 30, andernorts riss die Band mit der Nummer jedoch niemanden vom Hocker, dummerweise auch nicht in ihrer Wahlheimat Melbourne. Trotzdem spielten sie weiterhin jeden Gig, den Dayman für sie an Land ziehen konnte. Im Juni nahmen sie als Nachfolger in Sydney eine ziemlich temperamentvolle Version der Soft-Machine-Nummer »Love Makes Sweet Music« auf. Sie entschieden sich dafür, auf die B-Seite einen Song zu packen, den das Gespann Vanda/Young seinerzeit noch für die Easybeats geschrieben hatte: »Peculiar Hole In The Sky«. Mit der neuen Single war die Band allerdings nur geringfügig erfolgreicher als mit dem Vorgänger. In Perth und Adelaide landete sie in den Top 20, aber in Melbourne oder gar landesweit konnte die Band damit nicht punkten. Mehr als drei Jahrzehnte später schrieb Lovegrove auf seiner MySpace-Seite: »Wir hungerten, nur um eine Stunde lang auf der Bühne zu stehen, um unsere Sucht nach Adrenalin und dem Feedback des Publikums wieder und wieder mit einer Dosis live gespielten Rock’n’Roll zu stillen. Uns ging es nicht in erster Linie darum, musikalisch besser zu werden, was an sich schon traurig genug ist, sondern das Leben eines Rockstars zu führen. Also machten wir auch die entsprechenden Erfahrungen: Wir wurden aus mehreren Städten gejagt und kamen einige Male mit dem Gesetz in Konflikt. Wir wollten Sex, Drugs and Rock’n’Roll. Ich erzähle das, weil es genau so war, und nicht, weil ich stolz darauf bin.«
Wieder einmal stand die Band vor einer musikalischen Neuorientierung und einem Imagewandel: weg von der Hardrockschiene, auf der sie seit ihrer Ankunft in Melbourne unterwegs waren, hin zu einem poppigeren Sound. Rein äußerlich standen jetzt knallbunte Outfits mit transparenten Puffärmeln auf dem Programm; Bon wurde eine adrette Prinz-Eisenherz-Frisur verpasst. Viel mehr als sein neuer Haarschnitt bereiteten ihm allerdings die durchsichtigen Ärmel Unbehagen, denn sie ließen seine Tattoos durchscheinen – was zu jener Zeit nicht gerade hilfreich war für einen Frontman, der vor allem dem weiblichen Publikum gefallen wollte. Bon versuchte, die Tattoos mit Camouflage abzudecken, doch dieses professionelle, extrem deckende Make-up haftete nur schlecht, wenn er zu schwitzen begann, und rann dann seine Arme hinab. Brian Cadd erinnert sich: »Sie [die Valentines] kamen in knallgelben Outfits auf die Bühne. Sie sahen aus wie ein paar fluffige Entlein.«
Im März 69 hatten die Valentines endlich ihren ersten landesweiten Hit. Sie hatten sich wieder für einen Vanda/Young-Song entschieden, diesmal allerdings für einen, den die beiden extra für sie geschrieben hatten: »My Old Man’s A Groovy Old Man«. Eigentlich sollte die Platte am Valentinstag auf den Markt kommen, doch sie stand so weit unten auf der Prioritätenliste des Presswerks, dass sie erst drei Wochen später fertig wurde. Nichtsdestotrotz änderte sich mit »My Old Man« – auf dessen B-Seite mit dem fast schon folkig anmutenden »Ebeneezer« übrigens einer der wenigen Valentines-Songs verewigt ist, bei dem Bon allein die Hauptstimme singt – alles für die Band. Das Interesse an ihren Liveauftritten wurde zunehmend größer, sodass sie sich daran gewöhnen mussten, jeden Abend zwei Sets zu spielen: Eine frühe Show für die noch minderjährigen Fans und eine später am Abend für die Volljährigen. Es fing damals schon an, dass die Fans ihretwegen durchdrehten und hinter ihnen her waren. Aber das Beste war, dass sie endlich Geld verdienten; nicht so viel, dass sich jeder eine eigene Villa leisten konnte, aber immerhin so viel, dass sie aus ihrer Bruchbuden-WG ausziehen und sich jeder ein eigenes Haus mieten konnte – vorerst zumindest.
In einem Interview mit Go-Set zeigte sich Lovegrove überzeugt, dass das Geheimnis für den Erfolg der Valentines in der Interaktion zwischen ihm und Bon auf der Bühne läge. »Ich bin beliebter als Bon«, sagte er ohne mit der Wimper zu zucken, »aber er ist ein erheblich besserer Sänger, als ich es je sein werde. Ich glaube sogar, dass er der am meisten unterschätzte Sänger in ganz Australien ist.« Analog zur Doppelbesetzung des Frontman-Postens entwickelte die Band eine janusköpfige Identität. Ihre Auftritte am frühen Abend, mit denen sie ihre stetig wachsende Fangemeinde aus dem Popbereich zufriedenstellen wollten, glichen einer Varieténummer. Nicht ohne Ironie ergänzten sie ihre eigenen seichten Hits dabei mit ähnlich belanglosen Popnummern wie »Build Me Up Buttercup«. Oft noch am selben Abend traf man die Band dann in einem der weniger vornehmen Rock-clubs von Melbourne an. Ganz ohne ihren puffärmeligen Aufzug begeisterten sie das Publikum hier mit Coverversionen von Led-Zeppelin-und Stones-Songs. Etwa zu dieser Zeit lief Bon einem alten Kumpel aus Perth über den Weg, der inzwischen ebenfalls in Melbourne gelandet war: Billy Thorpe. Thorpe hatte eine eigene Rockband gegründet, die Aztecs, und Bon verbrachte viel Zeit mit ihnen. Die Band kam seiner Vorstellung von dem, wie er sich musikalisch entwickeln wollte, wesentlich näher als die Valentines. Thorpe bezeichnet den Bon von damals als »verdammten Irren«. Im Gespräch mit Clinton Walker beschreibt er ihn als jungen Rüpel auf Speed, Dope oder was sonst er gerade in die Finger bekam, der zusätzlich reichlich Whisky soff und sich mit jedem anlegte, der ihm in die Quere kam. Auf der einen Seite gab es »Bon, den Varietésänger, … der sein Geld im Smoking und mit Fliege verdiente«. Auf der anderen Seite gab es den Bon, der mit Billy und seinen Jungs backstage hockte, »Dope rauchte, soff [und] dann auf die Bühne sprang und losröhrte, wann immer sich ihm die Gelegenheit dazu bot.« Eines Abends, erinnert sich Thorpe, erklärte ihm Bon, der wieder einmal high war: »Weißt du, ich werde es schaffen. Ich werde es verdammt noch mal schaffen.«
Ein deutliches Zeugnis dieses inneren und stilistischen Zwiespalts, der nicht nur Bon, sondern allen Valentines zu schaffen machte, sowie der Probleme, die er mit sich brachte, war die nächste Single der Band. Mit »Nick Nack Paddy Whack« ist auf der A-Seite ein abgedroschenes, zugleich aber unbestreitbar einprägsames englisches Kinderlied. Auf der B-Seite wiederum findet sich das von Gitarrist Wyn Milson komponierte und von Bon getextete »Getting Better«; der bei Weitem beste Song, den die Valentines je aufgenommen haben, überzeugt mit einem starken Riff und einer sehr souligen Gesangsperformance von Bon. Im Repertoire einer erfolgreichen Band wie der Spencer Davis Group hätte sich das Stück wahrscheinlich bestens gemacht. Für die Valentines war es einfach ein B-Seiten-Song. Doch ein Hit bleibt ein Hit, und auch wenn der Kinderreim ziemlich abgedroschen war, so brachte er die Valentines doch für den Rest des Winters auf die Titelseite der Go-Set und ins Radio.
Mit dem Saubermannimage, das die Valentines lange Zeit in der Öffentlichkeit pflegten, war es im September vorbei, als bei der Band Marihuana gefunden wurde und deshalb alle Musiker angeklagt wurden. Die Polizei hatte einen Tipp bekommen – von, so vermutete man, ohne es je beweisen zu können, einer rivalisierenden Band, die den Valentines ihren Erfolg nicht gönnte. Eines Tages tauchten die Cops überraschend im Proberaum der Valentines, einem ehemaligen Surfhaus am Strand von Melbourne, auf und nahmen die ganze Truppe fest, obschon eigentlich nur Vince und Bon regelmäßig Gras rauchten. Die anderen missbilligten deren Vorliebe für das gute alte »wacky baccy«, wie Bon das Zeug nannte, sogar sehr. Als die Band mitbekam, dass die beiden bekifft waren, drohten sie ihnen sogar mit dem Rausschmiss. Die Valentines hatten gerade einen Auftritt im Crest Hotel in Sydney hinter sich. »Es war für uns beide das erste Mal, dass wir einen Joint rauchten«, erinnerte sich Lovegrove später. »Wir kannten da so eine Band, und der Keyboarder lud uns ein, mit zu ihm aufs Zimmer zu kommen und ein bisschen Dope zu rauchen.« Das Ganze endete damit, dass sie »völlig überdreht und blöde kichernd in einer Zimmerecke rumhingen«. Um die Wirkung abzumildern, ließen sie sich in einer nahe gelegenen Bar volllaufen. »Aber am nächsten Morgen waren wir immer noch stoned.« Die anderen Bandmitglieder regten sich mächtig darüber auf, was den beiden Kiffern allerdings nur ein albernes Kichern entlockte.
Nach der Festnahme saßen allerdings alle im selben Boot, ob sie nun kifften oder nicht. Bei der Gerichtsverhandlung in Geelong bekannten sich alle gemeinsam des Besitzes und Konsums von Marihuana schuldig. Dank dieses einsichtigen Verhaltens kamen sie mit einer vergleichsweise glimpflichen Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe von hundertfünfzig Dollar pro Kopf davon. Viel gravierender war das Sendeverbot, das die Macher der TV-Sendung GTK über sie verhängten. Allen Problemen zum Trotz versuchte die Band, das Beste aus ihrer Situation zu machen, und initiierte in aller Eile eine Kampagne zur Legalisierung von Marihuana.
Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnten die Schlagzeilen im Zusammenhang mit dem Marihuana-Skandal sogar imagefördernd sein und der Glaubwürdigkeit der Band zugutekommen. Denn endlich legten die Valentines ihre knallbunten Bühnenoutfits ab und tauschten sie gegen die einfache Jeans- und T-Shirt-Kluft ein, die sie bei ihren spätabendlichen Auftritten ohnehin schon trugen. Außerdem kehrten sie Melbourne und damit – sinnbildlich – auch der Vergangenheit den Rücken und zogen nach Sydney. Als ihnen ein Gastauftritt in einem TV-Special zu Ehren der Easybeats angeboten wurde – mit dem die Rückkehr des australischen Exportschlagers in die Heimat gefeiert wurde –, war Bon regelrecht aus dem Häuschen. Er und Vince gaben an diesem Abend im renommierten Cesar’s Palace alles. Gedankt wurde es der Band mit frenetischem Jubel, als sie von der Bühne ging. Ähnlich verheißungsvoll schien das Lob, das sie von Stevie Wright für ihre Darbietung von Led Zeppelins »Whole Lotta Love« bei einem ihrer spätabendlichen Konzerte erhielten.
Obschon der größte Teil der Musikfans von der Marihuana-Kampagne weitgehend unbeeindruckt blieb – sie waren ja keineswegs die einzige Band, die sich in den späten 60ern für die Legalisierung weicher Drogen einsetzte –, erwischte die Band ihre ganz jungen Fans damit auf dem falschen Fuß. Dennoch blickten sie optimistisch ins neue Jahr. Es gab immer ein nächstes Mal, und die nächste Valentines-Single sollte wieder eine Eigenkomposition werden. Der Titel lautete »Juliette«; komponiert und gesungen hatte ihn Bon fast allein. Anders als die Songs, die die Valentines bisher für ihre A-Seiten ausgewählt hatten, war »Juliette« eine langsame, groovige Akustikpopballade, untermalt von einem Streicherarrangement, das auch einem Bee-Gees-Album zur Ehre gereicht hätte. Wäre alles anders gekommen, hätten die Valentines mit diesem Song vermutlich alle anderen australischen Bands – inklusive der Easybeats – ausgestochen, als er im Februar 1970 veröffentlicht wurde. Aufgrund einer eigentlich unbedeutenden arbeitsrechtlichen Debatte wurde dieser Song jedoch zu einer Art Schwanengesang für die Valentines. Im Zuge dieser Diskussion über Lizenzzahlungen an australische Musiker strichen die nationalen Radioanstalten nämlich von einem Tag auf den anderen die Titel aller einheimischen Künstler von ihren Playlists. »Juliette« kam infolgedessen unter die Räder und schaffte es daher weder in irgendwelche regionalen noch in die nationalen Charts. Für eine Band wie die Valentines, die von ihrem Image wie von ihrer musikalischen Ausrichtung her weder Fisch noch Fleisch war, bedeutete das fast unweigerlich das Aus. Für Bon war es die größte Enttäuschung seiner bisherigen Karriere. Er war wütend und verbittert und entfremdete sich zunehmend von der Band. Wozu sollte man noch weitermachen, wenn die besten Songs der Band gar nicht erst im Radio gespielt wurden, fragte er sich. Er hatte die Nase gestrichen voll. Und auch Lovegrove begann, über ein Leben ohne die Band nachzudenken: »Wir waren nur noch wegen dieser ganzen Dope-Sache im Gespräch. Niemand sprach über unsere Musik … Im Prinzip steckten wir in einer Sackgasse.«
Dass man sie durchaus schätzte, erfuhren die Valentines anlässlich ihres letzten Konzerts im Bertie’s in Melbourne im Juli 1970: Die Go-Set-Leser hatten die Band gerade zur sechstbesten australischen Popband gekürt – nachdem sie im Vorjahr noch Platz 9 belegt hatten. Doch da hatten Vince und Bon den anderen schon mitgeteilt, dass die Band für sie gestorben war. Am 1. August 1970 lösten sich die Valentines offiziell auf. Ted Holloway mutmaßt: »Wir haben es nicht bis an die Spitze in Australien geschafft, aber wir waren nah dran. Wir haben ein paar große Konzertreisen gemacht und ein paar tolle Songs aufgenommen. Ich war immer der Meinung, dass wir uns damals eigentlich ganz gut geschlagen haben.« Für Bon war »ganz gut« jedoch bei Weitem nicht gut genug. Er war vierundzwanzig Jahre alt und hatte Angst, dass ihm die Zeit davonlief. Und er hatte es satt, eine Lüge zu leben – so zumindest sah er es. Er wollte weiterhin singen, das stand für ihn fest, allerdings in einer Band, die den aktuellen Strömungen gegenüber genauso aufgeschlossen war wie es ihre einzelnen Mitglieder waren. Kurz gesagt hatte er es satt, einen auf Popstar zu machen. Er wollte Rock’n’Roller sein. Etwas anderes hatte ihn nie wirklich interessiert.
Auf dem Weg zurück nach Perth legte Lovegrove einen Zwischenstopp in Adelaide ein. Jenseits der Musik, die in den Charts erfolgreich war und die Szene sowohl in Melbourne als auch in Sydney beherrschte, hatte sich hier eine ganz eigene Musiklandschaft entwickelt. Viele Gruppen, die hierhergekommen waren, wie die später in die australische Hall of Fame aufgenommenen The Masters Apprentices oder The Twilights (mit dem zukünftigen Little-River-Band-Sänger Glenn Shorrock) und The Vibrants (die landesweit zwei Hits hatten), schienen ebenso vielversprechend wie so manche Band aus Melbourne. Neben diesen waren hier aber auch noch andere Musiker zu Hause, die das stetig wachsende Publikum, das sich mehr für ganze Alben als nur für einzelne Singles interessierte, bediente. Zu diesen zählte etwa der Folksänger Doug Ashdown, der Singer-Songwriter Peter Tilbrook und James Taylor Move, der so einen intelligenten Poprock machte, dass die Valentines davon nur träumen konnten. Als Phillip Frazer, der junge Go-Set-Gründer, mit dem sich Lovegrove angefreundet hatte, den Vorschlag machte, Lovegrove solle in Adelaide eine Redaktionszweigstelle des Magazins eröffnen und leiten, ließ sich der ehemalige Valentines-Frontman das nicht zweimal sagen. Der Erfolg rechtfertigte seinen Schritt: Schon 1971 moderierte er jeden Samstagmorgen eine eigene TV-Musiksendung namens Move, und allwöchentlich erschien unter seinem Namen eine Musikkolumne in der South Australian News.
Bon blieb zunächst in Sydney und schloss sich den Levi Smith’s Clefs an, dem Ableger einer anderen regional erfolgreichen Band. Die Clefs hatten sich bereits Mitte der 60er gegründet. Sie spielten Soul und R&B und waren live ein echter Knaller. Die Besetzung wechselte häufig, und so hatten bereits etliche Sänger und Instrumentalisten ihr Talent bei den mehrjährigen Engagements der Clefs in so angesagten Sydneyer Clubs wie dem Whisky Au Go Go, dem King’s Cross und dem Chequers unter Beweis gestellt. Bon hatte sich irgendwann mit dem Clefs-Bassisten Bruce Howe angefreundet, als die Band in Melbourne spielte. Jetzt stand bei der Gruppe erneut eine Veränderung an. Ähnlich wie bei den Valentines war die Kernbesetzung der Clefs unzufrieden damit, dass sich die Band nicht weiterentwickelte. Sie hatte hin und wieder ein paar Singles veröffentlicht und auf regionaler Ebene auch den ein oder anderen Hit gelandet, aber in der Hauptsache konzentrierte man sich bei den Clefs auf Liveauftritte, überzeugende Platten zu produzieren war für diese Band eher zweitrangig. Ein bisschen neidisch verfolgte Bon jetzt, wie Bruce Howe zusammen mit dem Gitarristen Mick Jurd, dem Keyboarder John Bisset und dem Drummer Tony Buettel (der wenig später durch John Freeman ersetzt wurde) eine neue Gruppe namens Fraternity gründete.
Unter diesem Namen hatte die Band mit dem temporeichen »Why Did It Have To Be Me?« auch schon ihre erste Single veröffentlicht, als Howe Bon eines Tages fragte, ob er Lust habe, bei ihnen als Frontman einzusteigen. Bon war zunächst ein wenig verunsichert, weil er wusste, dass einige Bandmitglieder anfangs so ihre Zweifel hatten, ob er sich tatsächlich für diesen Posten eignete. Daher wollte Bon sie gleich beim allerersten Gig überzeugen, dass er genau der Richtige war. Das tat er dann auf ziemlich denkwürdige Weise: Er sang so laut, dass er beinahe die Gitarren übertönte. Sichtlich beeindruckt von diesem Auftritt, schlug Howe vor, dass Bon noch am selben Abend als neuer Sänger zum Rest der Band in deren Reihenhaus-WG in der Jersey Road im Osten von Sydney zog. Bon war völlig hin und weg, wie er Vince später erzählte. Anfangs orientierten sich Fraternity musikalisch noch an Bands wie Vanilla Fudge und Deep Purple, die ausgehend vom Blues einen fast schon sakralen Sound entwickelt hatten. Ähnlich wie einige der wirklich großen Bands, zu denen beispielsweise Led Zeppelin gehörten, kehrten sie diesem Stil jedoch bald wieder den Rücken, um sich der neuesten, aus Amerika zu ihnen herüberschwappenden Welle ursprünglicher Rock- und Bluesmusik zuzuwenden, deren Vorreiter Dylans ehemalige Begleitgruppe The Band war, die sich jetzt unter eigenem Namen etablierte und Maßstäbe setzte.
Bons Ansicht nach arrangierten sich Fraternity weitaus besser mit dem sich radikal wandelnden Zeitgeist, als es die Valentines je getan hatten. Sie waren ein paar bärtige, extravagante, langhaarige Posthippies, denen es im Leben neben Musik ausschließlich um freie Liebe und Drogen ging. Um Drogen ganz besonders. John Bisset, den die anderen einfach nur »JB« nannten, erklärte knapp fünfunddreißig Jahre später, dass man nicht über Fraternity reden kann, »ohne Themen wie Alkoholkonsum, Kiffen und Drogen wie LSD und Meskalin anzusprechen«. Bon, der damals versuchte, sich seiner neuen und, wie er meinte, intellektuelleren Umgebung anzupassen, wirkte auf JB seinerzeit »wie ein kleiner Pan, da er oft in seinem Zimmer saß und auf seiner Blockflöte spielte.« Aber es gab durchaus auch Momente, in denen er ganz der Alte war. »Bon konnte prima mit Vorurteilen über die Hippie-Kultur aufräumen. Etwa mit dem, dass alle Hippies Vegetarier sind. Ich erinnere mich noch, wie er bei einer Party in der Jersey Road, bei der extrem viel LSD im Spiel war, grinsend umherschlenderte und an einer riesigen gebratenen Lammkeule herumnagte.«
JB, der dem Alkohol und den Drogen später entsagte und im christlichen Glauben seinen Frieden fand, stellte fest, dass viele, darunter auch er selbst, zu einer Art Jekyll und Hyde werden, wenn sie trinken, dass Bon jedoch »immer Bon war – der nüchterne Bon, der bekiffte Bon, der torkelnde Bon, der total besoffene Bon«. Und er fügte hinzu: »Einige Journalisten sahen in uns mustergültige, lupenreine Hippies. Aber damit lagen sie voll daneben.« Er erinnert sich, wie Bon einmal während einer Show im Whisky ein paar Mandrax-Pillen, sogenannte Mandys, verteilte. »Ich schlief mitten im Set ein und sackte auf der Hammondorgel zusammen; mein Fuß stand direkt auf dem Lautstärkeregler. Die anderen dachten zuerst, ich würde einfach nur wild improvisieren. Später knackte Bon dann in irgendeinem Sessel im Club weg. Sie machten den Laden dicht und wir bekamen ihn einfach nicht wach. Also legte ich mir irgendwie einen seiner Arme um die Schulter, schleppte ihn raus und wir fuhren ihn im Taxi nach Hause.«
Ein anderes Mal schmiss die ganze Band sogenanntes Windowpane oder Clearlight ein: kleine dünne Gelatinekapseln, die flüssiges LSD enthalten. Sie waren mit dem Zug auf dem Weg zu einem Auftritt nach Perth, und dank der Drogen konnte sich Bon im Nachhinein an rein gar nichts mehr von dem triumphalen Homecoming-Gig, den er dort ablieferte, erinnern. Zu ihrem nächsten Auftritt in Perth reisten Fraternity mit dem Flugzeug an. Weniger Drogen wurden deshalb nicht konsumiert. »Uncle« John Eyers, ihr Mundharmonika-Spieler, reichte ganz ungeniert ein paar Joints herum und machte damit natürlich das Bordpersonal auf sich aufmerksam. Glücklicherweise ließ sich das mit der Erklärung abspeisen, schuld an dem komischen süßlichen Geruch sei aus einem Flakon ausgelaufenes Patschuli-Öl. Nach der Landung war die Band schließlich dermaßen betrunken und stoned, dass ein geplantes Interview mit einem regionalen Radiosender abgesagt werden musste.
Selbst Bon, der normalerweise eine Konstitution wie ein Pferd hatte, kam einmal fast an seine Grenzen. Es war an dem Tag, an dem Fraternity das Vorprogramm für Jerry Lee Lewis im White City Stadion in Sydney bestritten. Bon berichtete später voller Stolz, dass Jerry Lee – eines seiner Jugendidole, dessen zweideutige Lyrics ihn bei seiner Arbeit für AC/DC später stark beeinflussten – in ihm einen »Zechkumpan« gesehen habe. Er erzählte, dass Jerry Lees Manager zwar versucht hatte, die Schnapsflaschen vor ihnen zu verstecken, Jerry Lee ihn jedoch geschickt austrickste, indem er ein paar Flaschen Bourbon in seinen Cowboystiefeln versteckte. Immer wieder erinnerte er seinen Assistenten: »Vergiss bloß meine Stiefel nicht!« Später, im Backstagebereich des Stadions, lockte er Bon mit den Worten »Hier rein! Hier rein« in seine Garderobe und zog aus den Stiefeln die beiden Flaschen heraus, die er sich mit Bon vor der Show teilte.
Auch Groupies hatten Fraternity damals schon. Wenngleich das Interesse der aufgeschlossenen weiblichen Fans etwas war, das Bon – der auf der Bühne regelmäßig sein neues T-Shirt mit der Aufschrift »Super Screw« [dt.: Super-Stecher] trug – bereits vor seiner Zeit mit der Band weidlich ausgekostet hatte. Eine der Damen, die Bon bereits kannte, war »ausgesprochen hübsch, dunkelhaarig und sehr schwanger«. Bon stellte sie JB eines Tages in Melbourne vor. Sie gehörte zu einer Gruppe von Frauen, die die Band die »Baby-Brigade« nannten, weil sie alle Babys von Rockstars oder Möchtegern-Rockstars hatten. Diese spezielle Frau, an deren Namen JB sich nicht mehr erinnern kann, stellte Bon dem Keyboarder mit den Worten »ein wunderhübsches Bienchen – etwa im achten Monat schwanger« vor. Völlig verblüfft, dass Bon Vater wurde, fragte er: »Oh, ihr werdet heiraten?«, woraufhin Bon und die Schwangere sich nur kaputtlachten.
Nach ihrem Gig im Vorprogramm von Jerry Lee Lewis hegte die Band kurzzeitig Hoffnungen, in die USA überzusiedeln. MCA Records hatten Interesse an ihnen bekundet und wollten sie unter Vertrag nehmen und eine Platte mit ihnen aufnehmen. Begeistert, aber ohne genau zu wissen, wie sie reagieren sollten, spielten Fraternity im Dezember in Sydney in einer vierzehnstündigen Marathonsession genug Songs für ein komplettes Album ein. Etwa zur selben Zeit verdiente sich Bon ein paar Dollar hinzu, indem er bei den Sessions für das Blackfeather-Debütalbum At The Mountains Of Madness mitwirkte. Auf »Seasons of Change« spielte er Blockflöte, auf »The Rat (Suit)« Timbales und Tamburin. Damals schien das keine große Sache zu sein, doch wie problematisch es tatsächlich war, dass Bon etwas für die mit ihnen konkurrierende Band beigesteuert hatte, stellte sich erst später heraus.
Nachdem aus dem Deal mit MCA Records letztlich doch nichts wurde, zeigte das kleine Independentlabel Sweet Peach aus Adelaide Interesse daran, das im Grunde fertige Album zu veröffentlichen. Das führte dazu, dass die Band im Januar 71 nach Adelaide zog, wo Bon seinen alten Bandkollegen Vince Lovegrove wieder traf. »Die Jungs von Fraternity waren exzellente Musiker«, erinnerte sich Lovegrove 2008. Bruce Howe, den er als »strengen, dogmatischen Zuchtmeister« bezeichnete, war seiner Ansicht nach derjenige, der Bon »als Mentor mit seiner ganzen Überzeugungskraft« dazu brachte, bei »dem Versuch, sich als Sänger zu behaupten, bis an seine Grenzen zu gehen«.
Unterstützung erfuhr die Band von dem in Adelaide ansässigen Unternehmer Hamish Henry, der den Jungs eine sieben Hektar große Farm – die sie »Hemming’s Farm« tauften – dreizehn Meilen südöstlich von Adelaide, nahe der kleinen Ortschaft Aldgate, zur Verfügung stellte. Henry, der aus einer wohlhabenden Familie aus dem Norden von Adelaide stammte, war ein millionenschwerer Unternehmer, der unbedingt im Musikgeschäft mitmischen wollte. Als er Fraternity unter seine Fittiche nahm, managte er bereits einige andere regionale Bands, wie W. G. Berg (alias War Machine) und Headband, mit dessen Frontman, dem Pianisten und Singer-Songwriter Peter Head, sich Bon damals ebenfalls anfreundete. Henry gab Fraternity nicht nur ein Dach über dem Kopf und ermöglichte ihnen einen Neuanfang in den Adelaide Hills, er besorgte ihnen auch einen Auftritt beim Myponga Festival, das sein neu gegründetes Unternehmen Music Power veranstaltete. Das dreitägige Rockevent, das im brennend heißen australischen Sommer 1971 fünfunddreißig Meilen südlich von Adelaide in einem durch seine Käserei bekannten verschlafenen Örtchen namens Myponga stattfand, war das erste große Open-Air-Festival in Australien. Neben einigen nationalen Acts, darunter Daddy Cool, Bons Kumpel von Billy Thorpe & The Aztecs und natürlich Fraternity, waren bei dem als »australisches Woodstock« vermarkteten Event Cat Stevens und Black Sabbath als Headliner angekündigt. Zwar sagte Stevens im letzten Moment ab, doch das änderte nichts daran, dass die gut fünfzehntausend Zuschauer, die pro Kopf sechs Dollar für ihre Tickets bezahlt hatten, sowie Tausende weitere Fans, die hinter den provisorischen Absperrungen mitfeierten, Spaß hatten und voll auf ihre Kosten kamen.
Die Medien stürzten sich allerdings vorrangig auf die pikanten Details am Rande des Festivals: nackte junge Männer und Frauen, die zur Musik tanzten und sich mit Alkohol und Drogen zudröhnten. Eine typische Schlagzeile lautete »Bye Bye BH« und im dazugehörigen Artikel erfuhr man, wie »Myponga zur derzeit größten BH-freien-Zone in Südaustralien« geworden war. Die Sunday Mail kritisierte, dass auf dem Festivalgelände Unmengen Alkohol ohne Lizenz ausgeschenkt wurden. »Zehntausende Heavy-Rock-Fans hockten letzte Nacht unbekümmert in ihrem zugemüllten Musiklager und feierten das Fest von Love, Peace, Banshee-Rock und Schnaps, Schnaps, Schnaps«, hieß es dort. Und weiter: »Auf dem Festivalgelände befinden sich etwa zweitausendfünfhundert junge Frauen, und nicht eine davon scheint einen BH zu tragen.«
Nackte Frauen, Gratisdrinks und Drogen in Hülle und Fülle sowie die Aussicht, als letzte Band vor den großen Black Sabbath auf die Bühne zu gehen – für Bon sah so das Paradies auf Erden aus. »Ich hatte es satt, mit den Valentines ständig vor diesen Teenyboppern zu spielen. Ich wollte endlich als Musiker ernst genommen werden und in der australischen Rockszene mehr sein, als einer, der auf der Bühne nur mit seinem Arsch wackelt«, erklärte er später. Daher machte es ihm auch nichts aus, dass Howe, nachdem es Henry gelungen war, Fraternity ins Vorprogramm von Deep Purple und Free zu buchen, die Band sechs Stunden täglich proben ließ und Henry ihn manchmal bat, seinen Rasen zu mähen oder sein Auto zu waschen.
Henry war ein Freund und Mäzen des preisgekrönten Künstlers und Fotografen Vytas Serelis, einem jungen, attraktiven Hippie, dessen zweite Leidenschaft neben Kunst und Fotografie das Sitarspielen war. Henry machte Bon und Serelis miteinander bekannt, woraufhin Bon ihm oft zusammen mit Lovegrove und seinem neuen Freund Peter Head einen Besuch auf seinem siebzehn Hektar großen Grundstück im nahegelegenen Carey Gully abstattete. An jeder Ecke stolperte man dort über Gemälde, Skulpturen und andere Werke des Künstlers sowie über diverse Exemplare einer allem Anschein nach riesigen Fahrzeugsammlung, zu der sogar Busse gehörten. Head erinnerte sich Jahre später an die sonntäglichen Lagerfeuer, die sie dort veranstalteten. Sie sangen, spielten Gitarre und Serelis begleitete sie auf seiner Sitar. Alle »knallten sich irgendwie zu mit Marihuana, Magic Mushrooms, LSD oder Alk«.
Zusammen mit den beiden Neuzugängen »Uncle« Eyers an der Mundharmonika und Sam See an der Gitarre und an den Tasten gelang Fraternity, was die Valentines nie geschafft hatten: Sie gewannen das Hoadley Battle Of The Sounds. Ihr Preis: ein All-inclusive-Trip nach Los Angeles, zweitausend Dollar in bar und die Übernahme von bis zu dreihundert Dollar Mietkosten für ein Studio in Melbourne. Da sie nicht nach Amerika fliegen wollten, bevor sie dort nicht zumindest eine Platte veröffentlicht hatten, ergriffen sie zunächst die Chance, in einem professionellen Studio in Melbourne zehn Songs für ihr zweites Album Flaming Galah einzuspielen, das im Jahr darauf auf den Markt kommen sollte.
Das Leben war einfach schön, nicht nur auf der Bühne, auch abseits davon. JB erinnert sich, wie sich der außerordentlich gut gelaunte Bon, »ein geborener Draufgänger«, in sein neues Umfeld einfügte. »Er bespaßte die Kids in einem Küstenort, indem er von der höchsten Stelle eines Piers aus mitten in einen Schwarm Quallen hineinsprang. Auf dem Grundstück an den Adelaide Hills raste er in einem Einkaufswagen eine Böschung hinab, an deren Fuß ein kleiner See war; als er unten ankam, katapultierte ihn der Wagen kopfüber in das Wasser.« Er legte sich auch immer wieder mit seiner Enduro hin, aber »er hat nie seine gute Laune verloren«. Obschon Bon sich am besten mit Uncle verstand – der wie er für die anderen immer noch der Neue in der Band war –, übte Bisset eine seltsame Anziehungskraft auf ihn aus. Bedingt durch seine starken Stimmungsschwankungen, die durch den kontinuierlichen LSD- und Marihuana-Konsum sowie seinen selbst an den lockeren Maßstäben von Fraternity gemessen exzessiven Alkoholgenuss noch gefördert wurden, zog er sich manchmal tagelang in sein Schneckenhaus zurück. Bon war davon fasziniert. Denn hinter seiner eigenen Strahlemannfassade, für deren Aufrechterhaltung er Tag für Tag den gutgelaunten Kumpel mimen musste, kämpfte er selbst gegen düstere Stimmungen und das stetig wachsende Gefühl der Unsicherheit an. Wie alle Menschen, die es jedem recht machen wollen, hatte er kein sonderlich hohes Selbstwertgefühl, weil er davon überzeugt war, dass er sich ständig nur durchs Leben mogelte, selbst wenn die Dinge für ihn gut liefen. Immer, wenn er bemerkte, dass JB wieder einmal in seinen Depressionen versank, überlegte er, ob er ihm nicht folgen solle, um ihm aus seinem Sumpf herauszuhelfen – und auf diese Weise vielleicht auch einen Ausweg für sich selbst zu finden.
Einmal, so erzählt Bisset, saß er auf einer Bank, warf ein bisschen LSD ein und hoffte auf eine »spirituelle Erleuchtung«, die ihm aus seiner Depression heraushelfen sollte. Doch der Stoff war von minderwertiger Qualität und machte JB nur »elend und paranoid«. Da kreuzte ganz unerwartet sein neuer Freund Bon auf. »Bon war mit seiner Enduro zum Strand runtergefahren und auf dem Rückweg sagte er mir, ich solle mich hinter ihn auf die Maschine setzen. Ich wandte ein, dass ich mich um den Hund kümmern müsse, aber er sagte nur: ›Mach dir um den Hund keine Gedanken‹, und bestand darauf, mich mitzunehmen. Also stieg ich auf. Wie ein Wilder raste er den langen, menschenleeren Strand entlang. Im Osten wurde er von riesigen Dünen begrenzt, davor floss ein breiter Wasserlauf vom Landesinneren quer über den Strand ins Meer hinein. Ich hatte erwartet, dass Bon das Tempo drosselt, doch er tat nichts dergleichen. Er legte sogar noch einen Zahn zu. Wir schossen geradewegs durch den Wasserlauf hindurch, und ich wurde patschnass bis auf die Knochen, als wäre ich gerade in eine Feuerwehrübung geraten. Die Enduro knallte mit Vollgas in die Düne rein, und Bon und ich flogen gut zehn Meter durch die Luft. Als ich wieder zu mir kam, bestand ich nur noch aus Sand und Wasser, aber verletzt war ich offenbar nicht. Ich blickte zur Düne rauf, und da stand Bon, feixend und lachend. Das hat mich an diesem Tag wieder zu Verstand gebracht. Ich habe sofort nur das Lustige an der ganzen Sache gesehen und musste selbst anfangen zu lachen.« Bon meinte zu ihm: »Ich wusste, du würdest entweder lachen oder mir eine reinhauen.« Und später sagte er noch: »Mir war klar, dass irgendwo da drin ein ganz normaler, glücklicher Kerl steckt.«
Auch Gordon »Buzz« Bidstrup lernte Bon etwa um diese Zeit kennen. »Ich war etwas jünger als er, aber ich hatte die Valentines schon im Fernsehen in einer Sendung namens Uptight gesehen«, erzählt er heute. »In Adelaide hatte ich, seit ich vierzehn war, selbst in Bands gespielt, daher war mir Fraternity auch ein Begriff.« Der Bon Scott, den Bidstrup 1972 kennenlernte, war noch nicht der tätowierte harte Kerl, als der er wenige Jahre später berühmt werden sollte. Er war »ein Blockflöte spielender Hippie, der in den Bergen lebte, kiffte und sich Magic Mushrooms reinzog«. Und Bidstrup fügt hinzu: »Ich habe ihn nicht als Hellraiser oder Raufbold in Erinnerung. Damals waren fast alle ziemlich friedfertig. Ich glaube, Bon und John Lennon hatten einiges gemeinsam. Im Grunde genommen waren sie beide wohl eher härtere Kerle, aber als ich Bon kennenlernte, war er einfach ein Hippie wie wir anderen auch. Er trug lange wallende Klamotten und all solche Sachen …«
Dieses Idyll sollte bald schon empfindlich gestört werden. Um Livestock, das Debütalbum der Band – eine von gerade mal zehn Platten, die das kurzlebige Label Sweet Peach herausbrachte – angemessen zu promoten, entschloss man sich, auch eine Single zu veröffentlichen, Bons erste mit Fraternity. Der Song, der sich dazu anbot, war »Seasons of Change«, dasselbe Stück, das Bon im Dezember des vergangenen Jahres zusammen mit Blackfeather aufgenommen hatte. Als Fraternity mit Henry als Produzenten im März 71 ihre – von Bon gesungene – Version der Nummer einspielten, waren alle überzeugt, dass das ein Hit wird. Der Song wurde auch ein Hit, allerdings nur in Südaustralien, wo er bis auf Platz eins kletterte. Möglicherweise hätte er sich auch landesweit behauptet, wenn im April nicht plötzlich noch das Original von Blackfeather herausgekommen wäre. Bon war völlig konsterniert, hatte man ihm doch, wie er sagte, mündlich versichert, dass die Blackfeather-Version nicht einzeln veröffentlicht werden sollte und somit nicht in Konkurrenz zu der Single von Fraternity treten würde. Allerdings hatte wohl niemand erwartet, dass deren Single so einschlagen würde. So wie die Dinge standen, kann man es dem Blackfeather-Label Infinity/Festival kaum verdenken, dass sie von dem zu erwartenden Gewinn einen ordentlichen Anteil abhaben wollten. Das Ende vom Lied war, dass Fraternitys Coverversion von »Seasons of Change« landesweit gerade mal Platz 51 belegte, während es das Original der Blackfeathers bis in die Top 20 schaffte.
Bon war dermaßen empört – nicht zuletzt, weil er sich im Nachhinein über sich selbst ärgerte, bei den Blackfeather-Sessions überhaupt mitgemacht zu haben –, dass er seine ehemaligen Freunde im australischen Fernsehen vor laufender Kamera beschuldigte, seinen Song geklaut zu haben. Dabei vergaß er offenbar völlig, dass das Stück eigentlich aus der Feder der Blackfeather-Musiker John Robinson und Neale Johns stammte. Die bizarre Szene, die sich im TV-Studio abspielte, verfolgte der junge Angus Young in Sydney vor der Mattscheibe sitzend. Dreißig Jahre später erinnerte er sich in einem Interview: »Zum allerersten Mal habe ich Bon Scott im australischen Fernsehen gesehen, als er in einer Talkshow zu Gast war. Es ging um irgendeinen Kerl, der einen seiner Songs geklaut hatte. Der Interviewer verhielt sich ihm gegenüber total herablassend, der dachte wohl, er habe es nur mit irgendeinem unterbelichteten Rock’n’Roller zu tun. Und dann brüllte Bon plötzlich ›Verdammter Wichser!‹, stürmte quer durchs Studio und stürzte sich auf den vermeintlichen Dieb seines Song. Ich dachte nur, hmm, der geht ja gleich richtig zur Sache …«
Obschon sie mit »If You Got It« im September 71 einen weiteren regionalen Hit landeten – in den südaustralischen Charts kletterte er bis auf Platz 2 –, war das Ende 71 veröffentlichte Livestock längst nicht so erfolgreich wie erwartet. Auf regionaler Ebene konnte das Album mehr schlecht als recht Chartplatzierungen ergattern, landesweit überhaupt nicht. Zum Teil lag das sicher an dem geringen Einfluss, den ein kleines Indielabel wie Sweet Peach in der sich rasant entwickelnden australischen Musikbranche hatte, zum Teil aber auch an dem Imageproblem, mit dem sich die Band letztendlich – zumindest in kommerzieller Hinsicht – ihr Grab schaufelte. Denn obschon auf Livestock einige wirklich mitreißende Rock’n’Blues-Nummern waren, stand Fraternity das Wort »Freak« so übergroß ins Gesicht geschrieben, dass Außenstehende sie für ausgemachte Hippies oder sogar Folkies hielten. Hört man sich die wenigen Aufnahmen, die die Band hinterlassen hat, heute an, erkennt man jedoch schnell, dass sie alles andere waren als das. Auf so gradlinigen Stücken wie »The Race Pt 1« klingen sie wie einige andere erfolgreiche Bands ihrer Zeit, zum Beispiel die Faces oder Free. »Raglan’s Folly« und das Achtminutenstück »It« erinnern klanglich an den Progressive Rock, der sich damals in Großbritannien entwickelte. Und auf »Cool Spot« bewegt sich die Band irgendwo zwischen Santana und Led Zeppelin. Bärte, Sonnenbrillen und wallende Stoffe waren zu jener Zeit sehr angesagt, und mit seinen langen, lockigen Haaren erinnerte Bon tatsächlich ein wenig an Robert Plant. Gesanglich konnte er es mit dem Led-Zeppelin-Frontman zwar zu keiner Zeit wirklich aufnehmen, doch sein Stimmumfang war damals definitiv um einiges größer – und beeindruckender – als später bei AC/DC. Was die Aufnahmen auch belegen, ist Bons perfektes Blockflötenspiel – allerdings hätten er mit diesem Talent von den Youngs wohl nur Spott geerntet.
Das breite Publikum interessierte sich einfach nicht für Fraternity, und so war die Stimmung Weihnachten 71 bei den Jungs auf der Farm eher trostlos. Allerdings berappelten sie sich schnell wieder und starteten mit frischem Mut und einer Überheblichkeit, zu der nur Rock-bands mit einem einzigen erfolglosen Album in der Lage sind, ins neue Jahr. Sie sagten sich, dass sie für das australische Publikum, das ständig allen Trends hinterherhinkte, einfach zu gut waren. Mit Bands, die über ihr Talent und ihre Ambitionen verfügten, ging man in den USA und in Großbritannien, wo man Musiker ihres Kalibers wirklich zu würdigen wusste, ganz anders um. Hamish Henry, der auf diesem Gebiet zwar nicht viel Erfahrung besaß, dafür aber genug Geld, ihre Ideen umzusetzen, erklärte sich bereit, sie zu unterstützen. Und so brachen Fraternity im März 72, als sich der australische Sommer dem Ende zuneigte und der Frühling in Großbritannien erste Knospen trieb, zu einer Reise auf, die entweder ihren Aufstieg oder ihren Untergang einleiten sollte.
Sie warteten nicht einmal die Veröffentlichung ihrer nächsten Single »Welfare Boogie« (ein Song, an dem Bon mitgeschrieben hatte) ab oder auch die ihres zweiten Albums Flaming Galah – dessen Titel übrigens nichts mit dem gleichnamigen Cocktail zu tun hat, sondern ein australischer Slangausdruck für »Idiot« ist, wobei die Band bei der Titelgebung den Typus des Idiot savant, also einen Inselbegabten, im Sinn hatte. Besonders Aufsehenerregendes hatte das zweite Fraternity-Album allerdings nicht zu bieten. Neben einer Handvoll bereits bekannter Songs – darunter, als wolle man irgendetwas damit beweisen, auch »Seasons of Change« –, gab es darauf auch neue Nummern wie »Annabelle« und »Hemming’s Farm«. Bon hatte an allen Songs mitgeschrieben, die den manchmal doch recht einschläfernd wirkenden Liveauftritten der Band etwas mehr Schwung verleihen sollten. »Mehr Status Quo, weniger Pink Floyd« war das Motto.
Einen letzten großen Auftritt auf heimatlichem Boden hatte die Band bei dem von Peter Sculthorpe anlässlich der Zweihundertjahrfeier zur Entdeckung Australiens durch James Cook in Adelaide inszenierten Musical Love 200, bei dem auch die Jazzsängerin Jeanie Lewis und das Melbourner Sinfonieorchester mitwirkten. Dieses Musical hatte mit dem Sound von »Welfare Boogie« nicht das Geringste gemein.
Dank Henrys großzügiger Unterstützung und weil sie ihrer Meinung nach nichts in Australien hielt, brachen Fraternity mit großem Geleit – samt Ehefrauen, Freundinnen, zwei Roadies (Rob und Bob), Tourmanager Bruce King, JBs kleinem Sohn und einem Hund – nach London auf. Bon, der sich nie über ein unausgefülltes Sexualleben hatte beklagen können, aber nur wenig Glück mit langfristigen Beziehungen gehabt hatte, war in Adelaide kurz vor seiner Abreise mit einer hübschen Blondine namens Irene Thornton zusammengekommen. Die Reise nach London bot ihm einen idealen Vorwand, ihre Beziehung zu festigen – und zwar durch den Bund der Ehe. Am 24. Januar 1972 heirateten die beiden in Adelaide. Den Trip nach London betrachteten sie als ihre Flitterwochen. Doch das neue Leben, das sie gemeinsam begannen, währte nur knapp achtzehn Monate.
Da sie vom australischen Herbst in den britischen Frühling reisten, hatten Fraternity bei ihrer Ankunft in England zumindest warmes Wetter erwartet. Doch nicht nur diesbezüglich wurden sie gewaltig enttäuscht, auch alle anderen Vorstellungen, die sie vom »Leben in der alten Welt« gehabt hatten, stimmten mit der Wirklichkeit kaum überein. England war kalt und es regnete unaufhörlich. Fraternity zogen in ein großes dreistöckiges Haus in Finchley, das wie die meisten Londoner Häuser damals nicht über eine Zentralheizung verfügte und daher, wenn man es warm haben wollte, enorme Summen an Heizkosten verschlang. JB erinnert sich: »Es war eine typische WG, alles war sehr eng und wir zankten uns ziemlich oft.« Um der Band das Touren vor Ort zu erleichtern, hatte Henry auch ihren Tourbus nach England einschiffen lassen, sodass die Nachbarn, denen die Horde neu hinzugezogener Australier ohnehin ein Dorn im Auge war, sich auch noch über einen riesigen Greyhound-Bus ärgern mussten, der einige der sowieso schon knappen Parkplätze in ihrer schmalen Straße dauerhaft blockierte. Am schlimmsten aber war der ohrenbetäubende Lärm, den sie machten, wenn sie jeden Nachmittag bis in den Abend hinein probten. Dabei gab es nur sehr wenig Auftrittsmöglichkeiten für die Band, und bezahlte Gigs waren ohnehin kaum zu kriegen. Und ohne in der Öffentlichkeit präsent zu sein, wurden die Chancen, bei einem renommierten Londoner Plattenlabel unter Vertrag genommen zu werden, für die Band von Tag zu Tag geringer.
Bald war das Geld so knapp, das Bon sich in einem nahe gelegenen Pub hinter der Theke ein paar Pfund dazuverdienen musste. Weit schlimmer noch sah es mit der Versorgung mit Drogen aus. Gutes Dope, das es in den Adelaide Hills in Hülle und Fülle gegeben hatte, war in England kaum zu bekommen. Mit dem harzigen Hasch, das dort damals die Runde machte, konnten sich die Jungs von Fraternity, die an allerbestes, frisches Gras gewöhnt waren, nur schwer anfreunden. Nicht, dass sie besonders wählerisch gewesen wären. Bon erhielt sogar den Spitznamen Road Test Ronnie, weil er sich immer freiwillig als Versuchskaninchen für jede neue Droge, die sie in Finchley in die Finger bekamen, zur Verfügung stellte. »Er schien alles zu vertragen, was die Natur oder irgendwelche Wissenschaftler zusammenbrauten«, erinnerte sich JB. Den einzigen ernsthaften Absturz hatte er, nachdem er sich ein pflanzliches Halluzinogen namens Datura oder Engelstrompete reingepfiffen hatte. »Ein paar Tage lang war er ziemlich mies drauf, daher ließen wir anderen die Finger von dem Zeug.«
Fraternitys erster Gig in Großbritannien war ein Auftritt im Vorprogramm von Status Quo. JB zufolge war das Publikum »wohlwollend und freundlich«, doch als Status Quo, die eine weitaus bessere und größere PA hatten, auf die Bühne kamen, wurde Fraternity klar, dass sie noch einen weiten Weg vor sich hatten, und so sank schlagartig ihr Mut und schwand ihre Hoffnung. »Die Stimmung in der Band war in London plötzlich im Keller, die raue, harte Wirklichkeit hatte sie auch hier eingeholt. Die Party war vorbei.« Allerdings gab es in dieser Zeit trotz allem auch einen kleinen Lichtblick: eine kurze, einwöchige Deutschland-Tournee Ende 72, bei der Fraternity in kleinen Clubs in Westberlin, Frankfurt und Wiesbaden auftraten. Bon gewöhnte sich an, Songs auf Deutsch anzukündigen, und die Band peppte ihr Set mit schnelleren Rocknummern auf und verzichtete dafür auf eher langatmige Stücke wie das ermüdende, sich endlos hinziehende »It«. In London hatte sich indes nichts geändert. Die Stimmung wurde bei dem Gedanken an den bevorstehenden Winter in dem zugigen Haus, in das sie sich einquartiert hatten, sogar noch mieser. Immer öfter fragten sich die Jungs von Fraternity, worauf sie sich da nur eingelassen hatten.
Anfang 73 verließen Sam See und John Bisset die Band und kehrten nach Australien zurück. In einem letzten verzweifelten Versuch, die Band am Leben zu erhalten, änderten die verbliebenen Musiker ihren Namen in Fang. Damit hatten sie zumindest jetzt auch so einen kurzen, knackigen Namen, genau wie Slade oder Free oder die Newcomer Geordie, die mit »All Because Of You« gerade ihren ersten Hit gelandet hatten. Mit dem Namen versuchten sie auch ihr Image zu ändern. Die Zeiten waren vorbei, in denen Geheimratsecken und zauselige Bärte mit guter Musik gleichgesetzt wurden. Der Glamrock mit all seinem Glitter- und Flitterkram war auf dem Vormarsch. Selbst Geordie und Slade, deren Bandmitglieder von der Statur her auch gute Bauarbeiter abgegeben hätten, hatten das verstanden. Kurzzeitig sah es sogar so aus, als wäre genau dieser Imagewandel die Rettung für die Band gewesen. Als sie am 23. April in der Town Hall in Torquay und am darauffolgenden Tag in Plymouth im Vorprogramm von Geordie auftraten, hatte Bon die Gelegenheit, deren raubeinigen Sänger Brian Johnson aus der Nähe zu beobachten. Und er war auf Anhieb fasziniert von ihm. Besonders gut gefiel ihm sein Abgang bei ihrem zweiten Tourdate: Johnson warf sich auf den Boden und schrie sich die Seele aus dem Leib. Bon, der nicht wissen konnte, dass der Sänger tatsächlich Höllenqualen litt – noch am selben Abend wurde er mit einem Blinddarmdurchbruch ins Krankenhaus eingeliefert –, war hellauf begeistert davon, wie man Johnson wie tot von der Bühne trug und es der Band überlassen blieb, das Konzert vorzeitig ohne Sänger zu Ende zu bringen.
Rückblickend hat Johnson Bon, dem er damals zum ersten und einzigen Mal begegnete, als jemanden in Erinnerung, der »völlig anders« war als der Sänger, den er Jahre später bei AC/DC ersetzen musste. »Kurze Haare, Zahnlücke. Er war unglaublich witzig und wir hatten eine schöne Zeit. Aber es war natürlich viel zu kurz. So nach dem Motto: ›Irgendwann sehen wir uns bestimmt mal wieder.‹« Fraternity waren einfach eine »ganz andere Band« und Bon ein ganz anderer Sänger. »Er war damals noch nicht halb so gut wie später bei AC/DC. Sie haben aus ihm irgendwas rausgekitzelt, wie auch bei mir.«
Mit ihren neuen Glam-Outfits zogen Fang im Sommer 73 noch eine Reihe guter Support-Gigs an Land – im Mai war die Band mit Amon Düül II unterwegs, im Juni mit den Pink Fairies –, aber nach einem letzten Auftritt vor einem desinteressierten Pubpublikum im August war die Luft raus. Bon, der sich massiv darüber ärgerte, dass man ihn immer noch als Juniormitglied betrachtete, weil er als vorletzter Neuzugang zur Band gestoßen war, obschon er sich seit der Umbenennung wie kein anderer für die Gruppe einsetzte, hatte sich schon zur Rückreise entschlossen. Allerdings behielt er diese Entscheidung für sich, bis er sich die Flugtickets nach Australien leisten konnte. Er wusste, dass man bei Fraternity zum Schluss darüber nachgedacht hatte, ihn zu ersetzen, und verspürte keinerlei Verpflichtung, den anderen gegenüber loyal zu sein, ganz gleich für was sie noch zu kämpfen glaubten. Als ein weiterer trostloser Herbst und Winter in England bevorstanden, hatte Bon schließlich die Nase voll und besorgte für sich und Irene Rückflugtickets nach Australien. Pünktlich zum Weihnachtsfest 73 trafen sie in Perth ein, wo sie zunächst drei Tage bei Bons Eltern blieben, bevor sie mit dem Zug weiter nach Adelaide fuhren, um sich dort in Irenes winziger Wohnung einzuquartieren.
Obschon er seine Rockstarträume noch nicht ad acta gelegt hatte, hatte der inzwischen siebenundzwanzigjährige Bon seinen Zenith nach damaligen Verhältnissen, in denen große Popstars im Durchschnitt einundzwanzig Jahre alt waren und ihre Karriere üblicherweise nach fünf Jahren beendet hatten, bereits weit überschritten. Offiziell hatte man ihn zwar noch nicht zum alten Eisen gezählt, aber ohne Plattenvertrag, ohne Band und ohne irgendwelche Aussichten auf ein Angebot, das seine Situation verbessern könnte, war er gezwungen, sich einen »anständigen« Job zu suchen.
Selbst Irene schien inzwischen nicht mehr daran zu glauben, dass Bon noch ein großer Rockstar würde. Das Paar stritt sich immer öfter, Bon begann mehr zu trinken und kümmerte sich immer weniger um Irene. So schien es zumindest. Das Jahr 1974 begann für Bon als Tagelöhner, der Seepocken von Schiffsrümpfen kratzte. Da er aber nicht zu denen gehörte, die lange auf der Stelle treten, fand er schon wenige Wochen später eine sicherere und besser bezahlte Stelle in der Wallaroo Düngemittelfabrik. »Scheiße schaufeln«, erklärte Bon das, was er dort tat, den wenigen Musikern, die er noch zu seinen Freunden zählte. Und trotz des breiten Grinsens, das er dabei aufsetzte, sah er von Tag zu Tag älter und verhärmter aus.