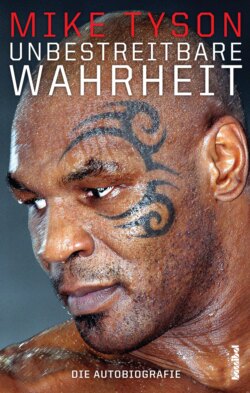Читать книгу Unbestreitbare Wahrheit - Mike Tyson - Страница 9
ОглавлениеNach den zwei Niederlagen gegen Tillmann war ich nicht gerade der gefragteste Kandidat der Boxszene. Cus’ Plänen zufolge hätte ich bei der Olympiade die Goldmedaille erringen und meine Karriere mit einem lukrativen TV-Vertrag starten sollen. Aber es hatte nicht geklappt. Kein professioneller Promoter war zu der Zeit an mir interessiert. Eigentlich glaubte damals niemand mehr an Cus’ Peak-a-boo-Stil. Und viele meinten, ich sei zu klein.
Dieses Gerede kam wohl auch Cus zu Ohren. Als ich eines Abends den Müll nach draußen trug, machte Cus gerade die Küche sauber.
„Mann, ich wünschte, du hättest einen Körper wie Mike Weaver oder Ken Norton“, sagte er aus heiterem Himmel. „Dann wärst du nämlich richtig einschüchternd. Du hättest eine Aura, die nichts Gutes verheißt. Die haben zwar nicht das Temperament, dafür aber die Statur eines einschüchternden Mannes. So könntest du die anderen Boxer vor Schreck erstarren lassen.“
Ich war sprachlos und bin heute noch betroffen, wenn ich diese Geschichte erzähle. Ich war tief gekränkt, wollte es Cus aber nicht zeigen. Sonst hätte er gesagt: „Was, du weinst? Was bist du für ein Baby? Wie willst du einen großen Kampf schaffen, wenn dir die emotionale Härte fehlt?“
Immer wenn ich Gefühle zeigte, tat er sie verächtlich ab. Also hielt ich meine Tränen zurück.
„Keine Sorge, Cus“, versuchte ich ihn großspurig zu beschwichtigen. „Du wirst sehen. Eines Tages erzittert die ganze Welt vor mir. Wenn sie meinen Namen hören, schwitzen sie Blut.“
An diesem Tag wurde ich zu Iron Mike. Ich wurde es zu 100 Prozent.
Obwohl ich fast jeden Kampf auf berauschende Weise gewann, identifizierte ich mich immer noch nicht ganz mit der Rolle des Wilden, in der Cus mich sehen wollte. Aber als er mir gesagt hatte, dass ich zu klein sei, wurde ich zu einem Brutalo. Ich fantasierte sogar, jemanden im Ring totzuschlagen, und so alle einzuschüchtern. Weil Cus einen asozialen Champion wollte, orientierte ich mich an den bösen Jungs, die ich aus Filmen kannte, an Jack Palance oder Richard Widmark. Ich schlüpfte in die Rolle des überheblichen Soziopathen.
Aber zunächst bekam ich einen Cadillac. Cus konnte meine Spesen nicht bezahlen, als ich meine Karriere aufbaute, und überredete deshalb seinen Freund Jimmy Jacobs und dessen Partner Bill Cayton dazu, Geld vorzustrecken. Jimmy war ein toller Kerl. Er war der Babe Ruth des Handballs. Auf seinen Reisen mit Handballern um die Welt hatte er Filme über außergewöhnliche Kämpfe gesammelt. Am Ende lernte er Bill Cayton kennen, der ebenfalls ein Sammler war. Beide gründeten die Big Fight Inc. und mischten den Markt für Filmmaterial zu Kämpfen auf. Cayton machte später ein Vermögen, indem er Videokassetten an den US-Fernsehsender ESPN verkaufte. Cus hatte in seiner Zeit in New York mit Jimmy zehn Jahre zusammengelebt. Sie waren enge Freunde. Er hatte sogar einen Geheimplan ausgeheckt, Jimmy zum Boxer auszubilden, ob Amateur oder Profi. Dann sollte er Archie Moore den Titel als Weltmeister im Halbschwergewicht abnehmen. Jacobs trainierte sechs Monate lang intensiv mit Cus. Aber der Kampf kam nie zustande, weil Archie sich aufs Altenteil zurückzog.
Für Jimmys Partner Bill Cayton konnte sich Cus allerdings nie erwärmen. Er war für seinen Geschmack zu sehr in sein Geld verliebt. Ich mochte ihn auch nicht. Während Jimmy ein großartiger offener Typ war, trat Cayton als aufgeblasener kalter Fisch auf. Jim und Bill managten schon seit vielen Jahren Boxer und hatten Wilfredo Benitez und Edwin Rosario im Stall gehabt. Also stellte ihnen Cus in Aussicht, dass sie auch mich managen könnten, als ich Profi wurde.
Cus sah Jimmy und Bill wohl als zwei Investoren an, die sich aus meiner Entwicklung heraushalten und ihm die volle Kontrolle über meine Karriere überlassen würden.
Bislang hatten die beiden über 200.000 Dollar in mich investiert. Als ich von der Olympiade zurückkam, sagte Jimmy Cus, er wolle mir einen neuen Wagen kaufen. Vielleicht machten sie sich sogar Sorgen, ich könnte Cus sitzenlassen, mich anderweitig orientieren und sie damit ausbooten. Das hätte ich natürlich nie getan.
Cus ärgerte sich wahnsinnig und meinte, ich hätte keinen Wagen verdient. Schließlich hatte ich keine Goldmedaille geholt. Trotzdem fuhr er mit mir zu einem Autohändler in der Nähe. Er versuchte mir einen Oldsmobile Cutlass aufzuschwatzen, weil er ziemlich billig war.
„Nee, ich will einen Cadillac, Cus“, sagte ich.
„Mike, ich sage dir …“
„Wenn ich keinen Cadillac kriege, will ich gar keinen Wagen“, konterte ich standhaft.
Ich bekam meinen Wagen. Wir fuhren zurück und parkten ihn in der Scheune. Ich hatte weder einen Führerschein, noch konnte ich fahren. Aber wenn Cus mich nervte, schnappte ich mir die Autoschlüssel, rannte zur Scheune, stieg in den Wagen und hörte Musik.
Im September 1984 unterschrieb ich mit Bill Cayton und mit Jimmy Jacobs je einen Vertrag. Cayton besaß eine Werbeagentur und nahm mich für sieben Jahre als mein persönlicher Manager im Bereich Werbung und Produktpräsentation unter Vertrag.
Statt der sonst üblichen 10 oder 15 Prozent nahm er 33,3 Prozent Kommission. Ich unterschrieb einfach, ohne die Konditionen zu kennen. Einige Wochen später unterzeichnete ich den Vertrag mit Jimmy, der mein Manager wurde: ein üblicher Vierjahresvertrag mit Zweidritteln für mich und einem Drittel für ihn. Dann kamen beide allerdings überein, die Einnahmen aus den Verträgen miteinander zu teilen. Allerdings unterzeichnete auch Cus meinen Management-Vertrag. Unter seiner Unterschrift stand: „Cus D’Amato, Berater Michael Tysons. Alle Entscheidungen zu Michael Tyson bedürfen seiner endgültigen Zustimmung.“ Jetzt hatte ich ganz offiziell ein Management. Ich wusste, dass Cayton und Jimmy im Umgang mit Medien besonders gewieft waren und diesen ganzen Scheiß organisieren konnten. Und da Cus alle Boxentscheidungen traf und meine Gegner handverlas, konnte ich meine Profikarriere starten.
Bis ich nach einer Woche Training einfach für vier Tage abtauchte. Als mich Tom Patti schließlich aufspürte, saß ich in meinem Caddy.
„Wo warst du, Mike“, fragte Tom.
„Ich brauch diesen Scheiß nicht“, machte ich meinem Ärger Luft. „Der Vater meiner Freundin Angie ist Abteilungsleiter bei J.J. Newberry’s, diesem Kaufhaus. Er kann mir einen Job verschaffen, bei dem ich 100.000 Dollar verdiene. Und ich habe einen Caddy. Ich verschwinde.“
In Wahrheit machte mich einfach der Gedanke nervös, in Profikämpfen anzutreten.
„Bloß weil du mit seiner Tochter ausgehst, Mike“, sagte er, „wirst du keine 100 Riesen im Jahr machen.“
„Ich kann vieles“, sagte ich.
„Mann, du hast nicht viele Möglichkeiten. Geh in die Boxhalle zurück, gewinn deinen Kampf und mach weiter.“
Am nächsten Tag trainierte ich wieder in der Boxhalle. Als ich den Bammel überwunden hatte, war ich wahnsinnig stolz, dass ich mit nur 18 Jahren Profiboxer wurde. Und ich hatte auch ein großartiges Team in meiner Ecke. Neben Kevin Rooney hatte ich Matt Baranski. Matt war ein klasse Mann und ein gewiefter Taktiker. Kevin war eher der Typ, der einem den Frust ins Gesicht brüllte.
Wir diskutierten darüber, mir einen Spitznamen zu geben. Jimmy und Bill hielten das für überflüssig, aber Cus wollte mich „The Tan Terror“, der „gebräunte“ Schrecken, nennen – eine Hommage an Joe Louis, den „braunen Bomber“. Ich fand den Namen richtig gut, auch wenn wir ihn nie durchsetzen konnten. Und ich huldigte noch weiteren Helden, die ich verehrte: Ich ließ mir eine Schüssel über den Kopf stülpen und mir mit dem Elektrorasierer einen Schnitt wie Jack Dempsey verpassen. Ganz ernst sagte ich zu Cus, ich würde den Leuten Angst einjagen. Als ersten Schritt legte ich mir diesen missmutigen Dempsey-Arschloch-Look zu. Und dann setzte ich auf das spartanische Erscheinungsbild meiner alten Helden: keine Socken und keinen Boxermantel. Diesen Look wollte ich wieder im Boxen einführen.
Mein erster Profikampf fand am 6. März 1985 in Albany statt. Der Gegner war ein gewisser Hector Mercedes. Weil wir über ihn überhaupt nichts wussten, telefonierte Cus mit einigen Trainern und Betreibern von Boxställen in Puerto Rico, um sich zu vergewissern, dass Mercedes kein Geheimtipp war.
Am Abend des Kampfs war ich nervös, aber kaum sah ich den Typen im Ring, wusste ich, dass ich ihn schlagen konnte. Ich wusste, dass sich Cus für meine ersten Kämpfe schwächere Gegner heraussuchte, um mein Selbstvertrauen zu stärken.
Ich hatte recht. Der Kampf wurde schon in der ersten Runde abgebrochen, als ich Hector in einer Ecke des Rings auf die Knie geprügelt hatte. Ich war in Hochstimmung – bis mir Cus im Umkleideraum alle meine Fehler aufzählte. „Du musste deine Hände höher halten. Du hast mit den Händen nur herumgefuchtelt.“
Die nächsten beiden Kämpfe fanden ebenfalls in Albany statt – praktisch in meiner Heimatstadt. Einen Monat nach Mercedes kämpfte ich gegen Trent Singleton. Ich trat in den Ring, verbeugte mich in alle vier Richtungen der Arena und riss dann wie ein Gladiator vor der Menge die Arme in die Höhe. Binnen kurzer Zeit schlug ich Singleton dreimal nieder. Der Ringrichter brach den Kampf ab. Ich schlenderte in seine Ecke, küsste ihn und strich ihm über den Kopf.
Einen Monat später sollte ich wieder antreten. Zwischen den Kämpfen trieb ich nichts anderes als zu laufen, zu trainieren und zu boxen. Mehr verlangte Cus nicht von mir. Boxen, boxen und nochmals boxen, sparren, sparren und nochmals sparren.
Am 23. Mai kämpfte ich gegen Don Halpin, einen deutlich erfahreneren Gegner. Halpin hielt drei Runden durch. Experimentierend pendelte ich zwischen der konventionellen und der Rechtsauslage hin und her, um Ringerfahrung zu bekommen. In der vierten Runde verpasste ich ihm eine Linke und eine Rechte, und als er schon zu Boden taumelte, setzte ich mit einem rechten Haken nochmals nach. Er blieb solange liegen, bis man ihn schließlich hochzog. Cus meinte natürlich, ich sei in den Gegner nicht richtig hineingegangen und hätte es versäumt, mich seitwärts zu bewegen. Aber Jacobs und Cayton waren von der Art, wie ich mich bislang geschlagen hatte, hellauf begeistert.
Mit den Kämpfen schuf ich mir allmählich eine Fangemeinde. Wie bei Baseball-Spielen tauchten sie mit kleinen Schildern auf. Auf einem stand: „GOODEN IST DR. K., ABER MIKE TYSON IST DR. KO.“ Und auch Groupies zog ich an. Damals nutzte ich ihre Annäherungsversuche noch nicht aus. Ich war zu sehr in mich selbst verliebt, um an andere zu denken. Cus meinte, dass ich es etwas übertreibe. Ich solle doch mehr ausgehen. Folglich ging ich nach Albany und trieb mich mit Freunden rum.
Mit diesen ersten Kämpfen verdiente ich kaum Geld. Mein erster Kampf endete für den Promoter im Minus. Aber Jimmy gab mir 500 Dollar. Davon zweigte er allerdings 50 Dollar für Kevin ab und zahlte 350 Dollar für mich auf der Bank ein. Mir blieben also nur 100 Dollar. Diese ersten Kämpfe dienten mehr dazu, mir einen Namen zu machen, als Geld zu verdienen. Jimmy und Cayton machten Aufnahmen von den Highlights der Kämpfe, von allen meinen Knockouts, und verschickten die Videokassetten an sämtliche Box-Journalisten im Land – damals eine höchst innovative Idee.
Obwohl ich Sensationelles leistete, wurde Cus immer missmutiger. Manchmal dachte ich, dass er mich für einen servilen Onkel Tom hielt. Wenn ich mich bemühte, höflich zu sein und brav „Ja, Ma’am“ und „Nein, Sir“ sagte, mischte er sich ein.
„Warum redest du mit denen so? Meinst du, die sind was Besseres? Diese Typen sind alle Angeber“, sagte er. Aber wenn ich dann den arroganten Unnahbaren gab, wie er es mir immer vorschrieb, schaute er auf mich herab: „Das gefällt dir wohl, wenn die Leute zu dir aufschauen, hä? Weil Typen wie Cayton und Co. dir sagen, wie großartig du bist.“
Ich glaube, er brauchte einfach einen zum Herummäkeln. Wie mein Tag verlief, hing davon ab, mit welchem Bein Cus zuerst aufgestanden war. Ich hatte inzwischen den Führerschein und fuhr ihn zu verschiedenen Treffen und Besprechungen.
Am 20. Juni, kurz vor meinem 19. Geburtstag, kämpfte ich in Atlantic City gegen Ricky Spain. Es war mein erster Profi-Kampf außerhalb von Albany, aber Cus hatte mich schon zu großen Kämpfen in Städte überall im Land geschickt, um mich an die Arenen zu gewöhnen.
„Mach die Arena zu deinem Zuhause, mach dich mit ihr vertraut, bis du sie wie deine Westentasche kennst“, sagte er mir. „Du wirst dort lange Zeit leben, also richte dich darauf ein.“ Er nahm mich auch mit, wenn wir uns mit den Akteuren großer Kämpfe trafen. Er setzte mich zum Abendessen mit ihnen an einen Tisch, um mich mit ihnen bekanntzumachen und damit ich mich von keinem Kämpfer einschüchtern ließ.
Ich war richtig begeistert über den Kampf in Atlantic City, der auch noch auf ESPN übertragen wurde. Mein Gegner, ebenfalls ungeschlagen, hatte eine 7:0-Kampfbilanz mit fünf Knockouts. Eingeführt wurde ich als „Der Baby-Rabauke“, wobei ich von der Rolle als Baby nichts wusste: Ricky Spain ging in der ersten Runde zweimal zu Boden, worauf der Ringrichter den Kampf abbrach.
Jimmy und Cayton versuchten mir einen regelmäßigen Sendeplatz bei ESPN zu verschaffen, aber Bob Arum, der die Kämpfe förderte, sagte ihnen, dass seine Matchmaker mich nicht für besonders talentiert hielten. Cus war deswegen stinksauer. Er hasste Arums Matchmaker und arbeitete nie wieder mit ihm zusammen.
Aber diese ganze Politik interessierte mich nicht. Ich konnte meinen nächsten Kampf kaum erwarten. Er fand wiederum in Atlantic City statt, am 11. Juli gegen John Alderson, einen großen rustikalen Typen aus West Virginia, der ebenfalls eine Kampfbilanz von vier Siegen in vier Kämpfen vorzuweisen hatte. Auch dieser Kampf wurde auf ESPN übertragen. Ich schickte Alderson in der zweiten Runde mehrfach zu Boden. Nachdem er in seine Ecke zurückgekehrt war, brach der Ringarzt das Spiel ab.
Auf 6:0 steigerte ich meine Bilanz im nächsten Kampf gegen Larry Sims, machte Cus dabei aber richtig wütend. Sims war echt gewieft und plump, einer dieser netten Fighter. In der dritten Runde wechselte ich in die Rechtsauslage und schickte ihn mit einem wuchtigen Punch zu Boden. Im Umkleideraum stellte mich Cus zur Rede.
„Wer hat dir diesen Linkshänderscheiß beigebracht? Jetzt wird’s vielleicht schwierig, Kämpfe für dich zu kriegen“, sagte er. „Gegen Linkshänder treten die Leute ungern an. Du bist dabei, alles zu ruinieren, was ich aufgebaut habe.“ Cus hasste Linkshänder.
„Tut mir leid, Cus“, entschuldigte ich mich. Aber war es nicht blöd, sich für einen spektakulären Knockout zu entschuldigen?
Einen Monat später stand ich wieder im Ring, erledigte in einer Runde Lorenzo Canady und trat drei Wochen später in Atlantic City gegen Mike Johnson an. Als wir uns zur Belehrung aufstellten, machte Johnson ein so arrogantes Gesicht, als hasse er mich persönlich. Binnen Sekunden schickte ich ihn mit einem linken Haken in die Nieren zu Boden, und als er wieder aufstand, verpasste ich ihm eine spektakuläre Rechte, die ihn so schwer traf, dass zwei seiner Schneidezähne im Mundschutz steckenblieben. Ich wusste, dass er lange brauchen würde, um wieder hochzukommen. Kevin sprang in den Ring. Lachend klatschten wir uns wie zwei kleine Angeber ab, so nach dem Motto: Ha ha, schau dir den toten Nigga an, Kevin.
Ich hatte jetzt acht von acht Kämpfen gewonnen, mit acht Knockouts. Jimmy und Cus nutzten alle ihre Kontakte bei der Presse, um mir Anerkennung zu verschaffen. Ich reiste nach New York und aß mit Jimmy und seinen Freunden von den Zeitungen zu Mittag. Wir hofierten die Presse regelrecht. Allmählich tauchte ich auch in den Klatschkolumnen auf, weil ich mich inzwischen in New Yorker Hotspots wie dem Restaurant Columbus an der Upper West Side herumtrieb. Ich freundete mich mit dem Fotografen Brian Hamill an, der mich mit seinem Bruder Pete, einem bekannten Schriftsteller, bei den ganzen Stars einführte. Pete hatte mich in die Bar abgeschleppt, in der wir dann mit Paulie Herman, einem der Inhaber, zusammensaßen. In New York war Paulie damals der gefragteste Mann. Mir kam es vor, als sei er berühmter als all seine prominenten Gäste. Jeder wollte in seiner Nähe sein, mit ihm am Tisch sitzen und ihn um einen Gefallen bitten. Irgendwie kam er mir wie ein Mafiaboss vor.
Man war nie darauf gefasst, wen man im Columbus kennenlernte. Pete ließ mich manchmal bei Paulie zurück. Irgendwann saßen David Bowie, Mikhail Baryshnikov und Drew Barrymore, damals noch blutjung, mit uns am Tisch. „Das ist heftig“, dachte ich, „verlier jetzt bloß nicht die Nerven.“ Ein anderes Mal schneiten Robert de Niro und Joe Pesci herein und ließen sich nieder. Wir plauderten miteinander, als Paulie irgendwann sagte: „Hey Mike, wir gehen jetzt mal alle weg.“ Und peng, fünf Minuten später saß ich bei Liza Minelli zu Hause und schwatzte mit Raúl Juliá.
Am Ende lernte ich all diese angesagten Typen der New Yorker Szene kennen. In diesem Kreis bekam ich mit, dass gerade zu der Zeit, als ich in die Szene kam, etwas ganz Besonderes untergegangen war, das man heute noch in der Musik von Elton John, Stevie Wonder oder Freddie Mercury spürt. Man wusste, dass sie in einer ganz besonderen Szene verkehrt hatten, die jetzt nicht mehr da.
Die Bekanntschaft mit all diesen Superstars war für mich allerdings keine Bestätigung, dass ich es geschafft hatte. Die erhielt ich erst, als ich den Wrestler Bruno Sammartino kennenlernte. Als Junge war ich ein großer Wrestling-Fan gewesen und ganz begeistert von Sammartino, Gorilla Monsoon und Billy Graham. Eines Abends lernte ich jedenfalls auf einer Party Tom Cruise kennen, der damals am Anfang seiner Karriere stand. Und dort sah ich auch Bruno Sammartino. Stars faszinierten mich absolut. Ich starrte ihn einfach an. Jemand stellte uns einander vor. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wer ich war, aber ich zählte ihm sämtliche großen Kämpfe auf, die ich von ihm gesehen hatte, zum Beispiel die gegen Killer Kowalski, Nikolai Voltoff oder George „The Animal“ Steele. In meinem kranken, größenwahnsinnigen Hirn dachte ich: „Das ist ein Zeichen meiner Größe. Mein Held ist bei mir. Ich werde so groß wie er und erringe den Weltmeistertitel.“
Cus war weniger begeistert, dass ich immer mehr Zeit in Manhattan verbrachte. Wenn ich in der Stadt war, pennte ich immer bei Steve Lott auf der Couch, Jimmy Jacobs rechter Hand. Steve war ein Model-Junkie und schleppte mich in den Nautilus Club oder andere Bars, in denen sich hübsche Mädchen herumtrieben. Ich war damals allerdings damit beschäftigt, wie ich zu meinem Gürtel kam, sodass ich noch nicht dauernd darauf aus war, Mädchen ins Bett zu kriegen. Ich versuchte, anständig zu sein, und hielt mich zurück. Meine Schwäche war damals das Essen. Steve war ein großartiger Koch. Wenn ich in die Nachtclubs ausschwärmte und zurückkam, wärmte er mir ein paar Reste chinesischer Snacks auf. Nach ein paar Tagen kehrte ich nach Catskill zurück – und Cus drehte schier durch.
„Schau deinen Arsch an. Der wird immer fetter“, sagte er kopfschüttelnd.
Mein nächster Kampf war mein erster richtiger Test. Am 9. Oktober trat ich in Atlantic City gegen Donnie Long an. Long hatte über die volle Distanz gegen James Broad, ein taffes Schwergewicht, und gegen John Tate durchgehalten, den ehemaligen WBA-Weltmeister im Schwergewicht. Mir war klar, dass es in der Boxszene einen guten Eindruck machen würde, wenn ich Long umgehend erledigte. Long ging zuversichtlich in den Kampf und sagte Al Bernstein von ESPN, er könne mich mit Treffern übertrumpfen. Die Nacht wurde für den „Master of Desaster“, den Herrn des Desasters, wie Long genannt wurde, allerdings tatsächlich zum Desaster, kaum dass der Gong ertönt war. Ich ging mit blitzschnellen wilden Schlägen auf ihn los und schlug ihn Sekunden nach Beginn mit einem linken Schwinger nieder. Kurz darauf brachte ich ihn mit einem rechten Aufwärtshaken zum Straucheln und gab ihm mit einer Kombination aus einem rechten Uppercut und einem linken Haken den Rest. Für den Sieg benötigte ich knapp eineinhalb Minuten.
Nach dem Kampf interviewte mich Al Bernstein.
„Ich hatte wirklich erwartet, dass Donnie Long für Sie ein ziemlich harter Gegner sein würde. War er aber nicht!“, sagte Al.
„Na, wie ich Ihnen heute schon sagte: Wenn ich ihn in einer oder zwei Runden k.o. schlage, sehen Sie das immer noch so?“
„Ich dachte, man müsse davon ausgehen, dass er es ist. War er aber offenbar nicht“, sagte Al.
„Tja, jetzt war er kein …“, lachte ich.
„Nein. Er war ein harter Gegner. Ich sage das nur deshalb, weil Sie ihn ja geschlagen haben.“
Ich wusste als Einziger von Anfang an, dass es kein Schwindel war. Ein Haufen Leute haben sich den Kampf angeschaut. Jesse Ferguson kam, die Fraziers kamen. „Kommt alle her und holt euch euer Fett ab. Hier wartet Mike Tyson. Er wartet auf euch. Holt euch alle euer Fett ab.“
Ich war damals fast überfokussiert und lebte nicht wirklich in der Realität. In einem Interview für Sports Illustrated sagte ich: „Am meisten stört mich, dass ich von Leuten umgeben bin, die dauernd Spaß haben, Partys feiern und so weiter. Das macht einen weich. Leute, die nur Spaß haben wollen, kriegen nichts hin.“ Ich bildete mir ein, stärker zu sein als Leute, die auf Partys gingen. Ich wollte zu dieser Promi-Welt im Columbus gehören, kämpfte aber zugleich gegen die Versuchung an, es richtig krachen zu lassen.
Und ich hatte immer noch keinen Sex. Mein letztes Mal war mit dieser Praktikantin gewesen, die ich auf der Olympiade flachgelegt hatte. Nicht, dass mir die Lust fehlte, ich war nur im Umgang mit Frauen einfach zu ungeschickt. Ich wusste nicht, wie ich an sie herankam. „Hey, hallo, willst du mit mir vögeln?“ Ich wusste nicht, wie man das ausdrückte. Um diese Zeit sollte ich im Vorprogramm eines Hauptkampfes im Madison Square Garden antreten. Mein Ruf war mir vorausgeeilt: Mein Gegner erschien erst gar nicht. Also verschwand ich aus der Arena und ging in der 42th Street in einen Puff. Von dem Laden wusste ich seit meiner Kindheit, als ich mich auf dem Times Square herumgetrieben hatte. Im Vorraum setzte ich mich auf einen Stuhl. „Brauchst du Gesellschaft?“, sagte die eine, und wenn man sie abblitzen ließ, kam gleich die nächste. Ich war der jüngste Gast und wirkte wohl süß. Ich pickte mir eine hübsche Kubanerin heraus und ging mit ihr nach hinten.
Freud wäre die Szenerie eine Feldstudie wert gewesen: Ich war darauf vorbereitet gewesen, alle Aggressionen zu bündeln und einen Gegner im Ring platt zu machen. Und weil der Kampf geplatzt war, reagierte ich mich mit Sex ab. Ich war total aufgeregt, und wir waren gerade zugange, als sie mich bat, aufzuhören, weil sie sich den Rücken verspannt hatte. Ich war noch nicht fertig und verlangte mein Geld zurück. Sie wechselte das Thema und bat mich, ihr mein Edwin-Rosario-T-Shirt zu geben. Sie war zu verletzt, um weiterzumachen, und sagte: „Lass uns reden.“ Also redeten wir eine Weile, und dann haute ich ab – mit T-Shirt.
Cus erhöhte für mich das Tempo. 16 Tage nach dem Kampf gegen Long kämpfte ich gegen Robert Colay und holte zweimal zu einem linken Haken aus. Der erste ging daneben, der zweite schlug ihn k.o. In 37 Sekunden war alles vorbei. Eine Woche später stand ich in Latham, New York, gegen Sterling Benjamin im Ring. Ich schlug ihn mit einem kurzen linken Haken nieder. Nachdem er bis acht angezählt worden war, bedrängte ich ihn mit vernichtenden Körperhaken und Uppercuts, woraufhin er zu Boden taumelte. Der Ringrichter brach den Kampf ab. Das Provinzpublikum flippte aus. Ich wandte mich den Leuten zu, steckte die Handschuhe durch die oberen Seile, riss die Hände hoch und grüßte wie ein Gladiator.
Aber es gab Wichtigeres als meinen elften Sieg als Profi.
Cus D’Amato war schwer krank. Er war schon kränklich gewesen, als ich bei ihm und Camille eingezogen war. Er hustete dauernd. Dass sich sein Zustand verschlechterte, merkte ich, als er nicht mehr mit uns zu den Kämpfen kam. Bei den Fights gegen Long und Colay war er zu Hause geblieben, aber zu meinem Kampf gegen Benjamin mit nach Latham gefahren. Er war ein alter Italiener, zu stur, um einen Kampf zu verpassen, der sozusagen in seinem Hinterhof stattfand. Zu Ärzten hatte er kein Vertrauen und verfocht stattdessen als einer der ersten Vitamine, „Alternativmedizin“, wie das heute heißt, und Ernährungstherapie.
Ich wusste, dass Cus krank war, dachte aber, er würde das schon überstehen, um mitzuerleben, wie ich den Meistertitel holte. Wir redeten ja dauernd darüber. Und er hielt durch, damit er meinen Erfolg sehen konnte. Aber nur zu mir sagte er manchmal: „Vielleicht bin ich irgendwann nicht mehr da. Also hör mir zu.“ Ich dachte, er wolle mir bloß Angst machen, um mich auf Kurs zu bringen.
Dann wurde er in ein Krankenhaus in Albany eingewiesen. Aber Jimmy Jacobs sorgte für eine Verlegung ins Mount Sinai in der New Yorker City. Ich besuchte ihn zusammen mit Steve Lott. Cus saß in seinem Bett und aß Eis. Nach ein paar Minuten bat Cus Steve, den Raum zu verlassen, um mit mir unter vier Augen zu sprechen.
Dann eröffnete er mir, dass er an Lungenentzündung sterben werde.
Ich glaubte es nicht. Er sah nicht sterbenskrank aus. Er war durchtrainiert, hatte Energie und strahlte Begeisterung aus. Er aß Eis und entspannte sich. Trotzdem flippte ich schier aus.
„Ohne dich will ich diesen Scheiß nicht machen“, sagte ich und würgte Tränen hinunter. „Das mache ich nicht.“
„Gut, wenn du nicht kämpfst, wirst du merken, dass Leute aus dem Grab steigen können. Dann suche ich dich für den Rest deines Lebens heim.“ Ich lenkte ein. Daraufhin nahm er meine Hand.
„Die Welt muss dich sehen, Mike. Du wirst Weltmeister, der Größte“, sagte er.
Dann brach Cus in Tränen aus. Es war das erste Mal, dass ich ihn weinen sah. Ich dachte, er würde weinen, weil er nicht mehr miterleben könnte, wie ich Weltmeister im Schwergewicht wurde, nach allem, was wir zusammen durchgemacht hatten. Aber dann begriff ich, dass er wegen Camille weinte. Ich hatte ganz vergessen, dass er eine Partnerin hatte, die ihm mehr bedeutete als ich. Er erzählte mir, dass es ihm leid tue, Camille nicht geheiratet zu haben. Er habe Probleme mit der Steuer. Das habe er ihr nicht aufhalsen wollen.
„Tu mir einen Gefallen, Mike“, sagte er. „Kümmere dich unbedingt um Camille.“
Ich ging geschockt aus dem Raum. Ich wohnte bei Steve in dem Gebäude, in dem auch Jimmy eine Wohnung hatte. Er holte mich am nächsten Tag ab und ging mit mir zu der Bank, um einen Scheck über 120.000 Dollar für meine letzten Kämpfe einzuzahlen. Inzwischen war mein Name in den Zeitungen. Ich erschien sogar auf dem Titelblatt von Sports Illustrated. Auf der Straße hielten mich Passanten an und wünschten mir Glück. Ich war bekannt und großspurig und machte eine gute Figur. In der Bank kannte ich sämtliche Mädchen und flirtete normalerweise mit ihnen.
Aber als wir hineingehen wollten, blieb Jimmy stehen. „Cus wird es nicht über die Nacht schaffen, Mike. Sie geben ihm nur noch ein paar Stunden.“
Ich heulte einfach los, als gehe die Welt unter. Meine ging ja auch unter. Die ganzen jungen Frauen in der Bank starrten mich an.
„Gibt es ein Problem?“, sprach uns der Filialeiter an.
„Wir haben eben erfahren, dass ein lieber Freund von uns im Sterben liegt. Mike trifft es sehr schwer“, sagte Jimmy. Er war ganz ruhig und gefasst. So wie Cus es ihm beigebracht hatte. Aber ich heulte wie ein verlorengegangener Soldat auf einer Mission ohne General. Ich habe diese Bank nie wieder betreten, so peinlich war mir das.
Cus wurde im Hinterland von New York beigesetzt. Ich war einer der Sargträger. Alle aus der Welt des Boxens kamen. Es war so deprimierend. Mein krankes Hirn dachte nur noch an den Erfolg. Ich hätte alles getan, um diesen Titel zu holen und so Cus’ Vermächtnis zu erfüllen. Ich tat mir selbst leid und dachte, ohne Cus würde mich ein beschissenes Leben erwarten. Camille war sehr gefasst, aber als wir wieder zu Hause waren, weinten wir zusammen.
Kurz nach dem Begräbnis organisierte Jimmy Jacobs für Cus eine Gedenkveranstaltung in seiner alten Boxhalle, dem Gramercy Gym in der New Yorker City. Alle Stars kamen. Norman Mailer sagte, Cus’ Einfluss auf den Boxsport sei so groß gewesen wie der Hemingways auf die jungen amerikanischen Schriftsteller. Gay Talese meinte, Cus gekannt zu haben, sei eine Ehre gewesen.
„Er hat mich so vieles gelehrt“, sagte Pete Hamill, „nicht nur übers Boxen, ein Handwerk, das man meistern kann, sondern auch übers Leben, das man nicht so einfach meistert.“
Jimmy Jacobs beschrieb Cus in seiner Rede ganz gut: „Cus D’Amato wandte sich erbittert gegen Ignoranz und Korruption im Boxsport. Während er sich seinen Feinden gegenüber unerbittlich zeigte, begegnete er Freunden verständnisvoll, mitfühlend und unglaublich tolerant.“
Nach Cus’ Tod machte ich emotional dicht. Ich wurde richtig, richtig gemein und wollte mich beweisen, wollte zeigen, dass ich ein Mann und kein Kind mehr war. Eine Woche nach Cus’ Beerdigung flog ich nach Texas zu einem Kampf gegen Eddie Richardson. Jimmy und Cayton ließen mich nicht einmal trauern. Ich nahm ein Foto von Cus mit und redete immer noch mit ihm, jede Nacht.
„Ich trete morgen gegen diesen Richardson an, Cus“, sagte ich. „Was meinst du? Wie mache ich das?“
Obwohl ich nicht aus dem Tritt kam, hatte ich nach Cus’ Tod den Mut, diesen Glauben an mich selbst, verloren. Mir fehlte jeder Antrieb, etwas Anständiges anzustellen. Ich glaube, ich bin bis heute nicht darüber hinweggekommen. Aber ich war auf Cus auch wütend. Es war so bitter: Wäre er bloß früher zum Arzt gegangen, hätte er vielleicht weiterleben und mich beschützen können. Aber er war ja so stur gewesen. Weil er sich nicht behandeln ließ, war er gestorben und hatte mich allein zurückgelassen, mich diesen Raubtieren der Boxszene überlassen. Nach seinem Tod war mir alles egal. Da boxte ich vor allem wegen des Geldes. Einen Traum hatte ich eigentlich nicht.
Zunächst machte ich Richardson fertig. Mit dem ersten Schlag, zu dem ich ausholte, einer Rechten, schlug ich ihn nieder. Er hielt noch eine Minute durch, aber dann traf ich ihn mit einer schwungvollen Linken. So groß, wie er war, taumelte er davon und landete auf der anderen Seite des Rings. Conroy Nelson, der Jahre zuvor den kanadischen Titel an Trevor Berbick verloren hatte, war als Nächster dran. In Kanada war er noch immer die Nummer zwei im Schwergewicht. Er war ein zäher und erfahrener Bursche, mit einem großen Adonis-Leib. Alle Moderatoren meinten, dieser Typ würde mich einem ersten echten Härtetest unterziehen. Ich bearbeitete diesen Körper regelrecht in der ersten Runde. Unter meinen Körperschlägen ging er zwei oder dreimal fast zu Boden. In der zweiten verpasste ich ihm ebenfalls zahlreiche Körperschläge, brach ihm mit einer Rechten von oben die Nase und schickte ihn mit einem linken Kinnhaken zu Boden. Als der Ringrichter den Kampf abbrach, stolzierte ich durch den Ring und saugte mit ausgebreiteten Armen die Bewunderung der Fans in meiner Heimatstadt in mich auf.
Mein nächster Kampf fand am 6. Dezember im Felt Forum im Madison Square Garden statt. Alle meine Kumpels aus Brownsville kamen. Aber ich war zu konzentriert, um das genießen zu können. Ich konnte es nicht erwarten, diese Kämpfe hinter mich zu bringen, um endlich – für Cus – die Chance auf den Titel zu bekommen. In der Nacht kämpfte ich gegen Sammy Scaff. Diesen trampeligen, gut 112 Kilo schweren Gesellen aus Kentucky traf ich mit zwei furchteinflößenden linken Haken so schwer am Kopf, dass sich sein Gesicht in eine blutige Maske verwandelte und seine Nase eine neue Gestalt erhielt. Länger als der Kampf selbst blieb mir mein Interview danach in Erinnerung. John Condon, der Box-Chef des Madison Square Garden, der als Ko-Kommentar auftrat, fragte mich nach dem typischen Tag im Leben des Mike Tyson.
„Mike Tyson ist einfach ein hartarbeitender Kämpfer, der ein langweiliges Leben führt. Alle, die meinen, sie wären gerne an meiner Stelle, diese Hunderte von Leuten, die das behaupten, haben keinen blassen Schimmer. Wenn sie an meiner Stelle wären, würden sie wie Babys losschreien. Sie würden damit nicht fertig.“
Mein nächster Kampf fand wieder in Latham statt, als Hauptveranstaltung in einer Arena, die vollgestopft war mit Fans von mir. Mein Gegner war Mark Young, ein zäh aussehender Bursche. Als wir zur Belehrung in die Mitte des Rings traten, spürte ich seine Ausstrahlung. Wenn ein Gegner bei der Belehrung zu Boden blickt, will das überhaupt nichts heißen. Es kann Augenwischerei sein. Man spürt die Energie, die sein Geist, seine Seele ausstrahlt, zieht sich in seine Ecke zurück und denkt: „Oh Scheiße“. Oder aber: „Dieser Kerl ist ein Schlappschwanz.“ In dieser Nacht dachte ich: „Oh Scheiße, der kämpft am Ende doch.“ Auch Kevin spürte das.
„Verpass ihm harte Jabs und beweg deinen Kopf“, sagte Kevin. „Vergiss nicht, den Kopf zu bewegen, der kämpft.“
Als der Gong ertönte, begann er sehr locker, wurde dann aber wild, worauf ich harte Jabs lancierte und den Kopf hin und her bewegte. Nach etwas mehr als einer Minute holte er zu einer wilden Rechten aus, worauf ich mich um ihn herum wand und ihm einen hinterhältigen bösen Aufwärtshaken verpasste: Peng! Er flog buchstäblich in die Luft und stürzte mit dem Gesicht nach vorn zu Boden. Der TV-Kommentator Ray Manicini war voll des Lobes für mein Können, meinte aber, es sei Zeit, dass mir mein Management endlich jemanden zum Kämpfen verschaffte.
Aber Jimmy hielt an seinem Plan fest. Zwei Wochen später trat ich in Albany gegen Dave Jaco an. Er hatte eine Kampfbilanz von 19 Siegen bei 5 Niederlagen und 14 Knockouts, darunter ein technischer K.o. über Razor Ruddock. Jaco war ein großer, dünner weißer Bursche, der nicht viel hermachte, aber richtig zäh war. Immer wenn ich ihn niederschlug, stand er wieder auf. Nach drei Niederschlägen in der ersten Runde brach man den Kampf ab.
In der Nacht feierte ich mit Freunden den Sieg. Am nächsten Morgen gegen acht Uhr klopfte ich an Camilles Tür. Als sie öffnete, ging ich hinein und setzte mich wortlos.
„Wie hast du dich geschlagen?“, fragte sie.
„Gut“, sagte ich. „Aber ich habe jemanden vermisst, der nicht da war.“ Tränen liefen mir die Wangen herunter.
„Cus war nicht da. Alle sagen mir, dass ich gut sei. Ich bin auch gut, aber wenn ich schlecht bin, sagt mir das keiner. Egal, wie gut ich gekämpft habe: Cus hätte wahrscheinlich etwas gesehen, das ich falsch gemacht habe.“
Ich ließ mich darüber aus, wie ich mich beim Interview für Sports Illustrated gefühlt habe.
„Ich vermisse Cus schrecklich. Er war mein Rückgrat. All diese Dinge, die wir uns erarbeitet haben, kommen jetzt so gut raus. Aber wen interessiert das schon, wenn’s drauf ankommt? Ich mag meinen Job, bin nach dem Sieg aber nicht glücklich. Ich reiß mir im Kampf den Arsch auf und gebe mein Bestes, aber wenn es vorbei ist, sagt mir kein Cus mehr, wie ich war. Und ich kann keiner Mutter meine Zeitungsausschnitte zeigen.“
Doch ich ließ meine Gefühle beiseite und hielt mich selbst auf Trab. Am 24. Januar 1986 trat ich gegen Mike Jameson an, einen großen Iren, der Entscheidungskämpfe gegen Tex Cobb und Michael Dokes gewonnen hatte. Fünf Runden brauchte ich, um ihn zu stoppen: Der gerissene Veteran wusste, wann er klammern musste, und sorgte so für einen lustlosen Kampf. Diese Taktik hievte mein nächster Gegner auf eine höhere Ebene. Am 16. Februar traf ich in Troy, New York, auf Jesse Ferguson. Der Kampf wurde von ABC übertragen und war mein erster landesweiter TV-Auftritt. Er war mit einem Sieg über Buster Douglas fünf Monate zuvor ESPN-Champion geworden. Bei diesem Kampf hatte ich ihn hinterher durch die Arena spazieren sehen. Diesen Gürtel wollte ich ihm unbedingt abnehmen.
Ich wusste, dass es ein harter Kampf werden würde. Während der Belehrung schaute er mir nicht in die Augen und nahm eine ganz demütige, ja unterwürfige Haltung ein. Aber ich spürte in seiner Ausstrahlung keinen Funken Angst oder Schüchternheit; von dem Scheißgetue, dass er mir nicht in die Augen schaute, ließ ich mich nicht täuschen. Ich spürte, dass er es nicht erwarten konnte, mich richtig zu vermöbeln.
Ich hatte jedoch den Heimvorteil – in mehrfacher Hinsicht. Jimmy hatte meinen ersten nationalen Auftritt zu meinen Gunsten vorbereitet. Er verpasste uns 8-Unzen-Handschuhe, leichtere als üblich. Wir kämpften in einem kleineren Ring als normal. Alle Offiziellen waren in unserer Ecke. Ich startete den Kampf mit einem barbarischen Angriff auf den Körper. Aber Ferguson war klug genug, mich zu umklammern. Die ersten vier Runden ging das so weiter. In der fünften drängte ich ihn allerdings in die Ecke ab, verpasste ihm einen rechten Aufwärtshaken und brach ihm dabei die Nase. Er schaffte es kaum durch die Runde und geriet in der sechsten wieder in Bedrängnis. Unverfroren umklammerte er mich immer wieder und ignorierte das Trennkommando des Ringrichters, bis der den Kampf schließlich abbrach. Dummerweise schien eine Disqualifizierung meine K.o.-Serie zu unterbrechen. Aber am nächsten Tag wandelte die örtliche Box-Kommission das Ergebnis in einen technischen K.o. um.
Als ich mich nach dem Kampf mit den Reportern traf, sorgte ich für eine Kontroverse. Auf den Treffer mit dem Uppercut angesprochen, der Ferguson wohl fertiggemacht hatte, sagte ich: „Ich wollte ihm nochmals auf die Nase hauen und ihm das Nasenbein ins Gehirn treiben … Ich habe mir immer die Schlussfolgerungen der Ärzte angehört. Sie sagten, immer wenn sich das Nasenbein ins Gehirn bohre, seien die Folgen, wenn er gleich wieder aufstehe, ziemlich klar.“
Die Reporter lachten, allerdings wohl eher aus Nervosität. Ich sagte ihnen, was Cus mir Wort für Wort immer wieder eingeschärft hatte. Ich glaube nicht, dass ich etwas Falsches gesagt habe. Cus und ich hatten ständig über die Wissenschaft gesprochen, jemanden zu verletzen. Als Champion wollte ich streitsüchtig und boshaft sein. Ich schaute mir im Fernsehen die Zeichentrickserie X-Men an. Einer meiner Lieblinge war die Figur Apocalypse. Er sagte: „Ich bin nicht boshaft, ich bin einfach ich.“ Wenn es nach Cayton und Jacobs ging, sollte ich zu allen freundlich und umgänglich sein, aber jemand, der zu allen freundlich ist, ist sich selbst ein Feind.
Am nächsten Tag war die Kacke wegen meines Kommentars am Dampfen. Die New Yorker Zeitungen titelten: „Ist das der wahre Mike Tyson? Ein Gangster?“ Ein Journalist rief sogar meine ehemalige Sozialarbeiterin Mrs. Colemen an. Sie gab mir den Rat, mich wie ein Mensch, nicht wie ein Tier zu benehmen. Aber mir war das egal. Ich hatte eine Mission zu erfüllen. Mike Tyson würde nicht Weltmeister im Schwergewicht werden, wenn er einfach nur nett war. Ich machte das für Cus. Meine Gegner sollten wissen, dass sie es vielleicht mit ihrer Gesundheit oder sogar mit dem Leben bezahlten, wenn sie mich herausforderten.
Nach dem Vorfall versuchten Jimmy und Cayton mir einen Maulkorb zu verpassen. Sie stellten Steve Lott dazu ab, mir vorzugeben, was ich nach einem Kampf zu sagen hatte. Jimmy feuerte sogar ihren PR-Typen, weil er dieses Zitat durch den Äther geschickt hatte. Kurz nach diesem Kampf lud Jimmy ein paar handverlesene Reporter zu einem Abendessen mit uns ein. Ed Schuyler von Associated Press kam und meinte, Cayton und Jimmy versuchten mir verzweifelt einen Titel zu verschaffen, ehe ich mich in echte Schwierigkeiten bringen würde. Aber es war gar nicht so. Sie wollten einfach möglichst viel Geld einsacken. Für meine Mission hatten sie keinerlei Respekt übrig.
Cayton und die anderen versuchten, die Zeit, in der ich in Brooklyn aufgewachsen war, auszulöschen und mir ein positives Image zu verpassen. Cus war klar gewesen, dass so etwas Blödsinn war. Sie versuchten, mein wahres Ich zu unterdrücken und mich ihnen anzupassen. Aber ich wollte, dass die Leute sahen, was für ein brutaler Kerl ich war.
Nach dem Sieg über Ferguson war feiern angesagt. In dieser Zeit trank ich ziemlich viel Alkohol, zwar nicht im Training, aber kaum war der Kampf vorüber, war Selbstzerstörung angesagt. Als ausgewachsener Alki trank ich allerdings immer abseits der Medienscheinwerfer in der Stadt. Gefeiert wurde in Albany, im September’s, der Bar eines Freundes, die mir sehr vertraut war. Hier verkehrten Leute aus New York, Boston oder L.A., die aus beruflichen Gründen da waren, sich wie große Tiere aufspielten und meinten, sie könnten uns als kleine Provinzler abtun. Aber den Scheiß prügelten wir aus ihnen heraus. Ich selbst hielt mich zurück, weil ich nicht verklagt werden wollte, ließ aber andere für mich prügeln, indem ich sie auf blödsinnige Art anstachelte: „Verpass diesem Wichser einen Tritt. Was meint der denn, wer er ist?“ An diesen Auswärtigen hielten wir uns gerne schadlos.
Mein nächster Kampf fand am 10. März im Nassau Coliseum gegen Steve Zouski statt. Zouski war noch in keinem Kampf zu Boden gegangen, aber ich traf ihn in der dritten Runde mit mehreren Aufwärtshaken und schlug ihn k.o. Ich selbst war von meiner Leistung allerdings eher unbeeindruckt. Zum einen war ich bei Camille im Taubenstall von einer Leiter gestürzt und hatte mir einen Riss in der Ohrmuschel zugezogen. Zouski hatte mein Ohr mehrfach getroffen, sodass es anschwoll und meinen Gleichgewichtssinn beeinträchtigte. Im Interview nach dem Kampf erwähnte ich auch noch andere Sorgen.
„Ich war mit meiner Leistung nicht zufrieden“, sagte ich Randy Gordon, der den Kampf angesagt hatte. „Ich muss mit einer Menge persönlicher Probleme fertigwerden.“
Cayton teilte der Presse später mit, ich habe Schwierigkeiten mit einer „Freundin“, was aber absurd war, weil ich damals gar keine hatte. Ich war vielmehr schlicht deprimiert, weil so viele meiner Freunde in Brownsville umgebracht wurden. Es war barbarisch. Wegen Geld brachten Freunde andere Freunde um.
Nach dem Kampf entdeckte einer der Offiziellen die riesige Schwellung an meinem Ohr. Jimmy ließ mich deswegen von einem Facharzt untersuchen, und der stellte fest, dass sich mein Knorpel schwer infiziert hatte. Er schickte mich sofort zur weiteren Untersuchung ins Mount Sinai an der Upper East Side. Er befürchtete, dass ich das Ohr verlieren könnte, wenn es nicht behandelt würde. Zehn Tage hielt man mich im Krankenhaus fest. Zweimal am Tag wurde ich in die Hochdruckkammer gesteckt und bekam Antibiotika gespritzt.
Die Ärzte im Mount Sinai meinten, es täte mir gut, wenn ich an die frische Luft ginge. Deshalb holten mich jeden Tag um 15 Uhr nach der zweiten Behandlung Tom Patti und Duran, ein guter Freund aus der Kindheit, in einer Limousine ab und fuhren mit mir zum Times Square. Wir trieben uns herum, machten Fotos mit den Nutten und diesen Typen, die Touristen Pythons um den Hals hängten, Bilder schossen und sie ihnen verkauften. Mit einem Mordsspaß feierten wir die halbe Nacht durch. Wenn ich gegen 4 Uhr wieder im Krankenhaus einlief, flippten die Schwestern schier aus. „Das ist hier kein Hotel, sondern eine Klinik.“ Und als ich den Ärzten das Foto mit mir und der Nutte und der Python um den Hals zeigte, drehten die auch noch durch. „Es war nicht die Rede davon, dass sie die ganze Nacht wegbleiben sollen. Sie sollten hinausgehen, sich in den Central Park setzen, die Vögel und Eichhörnchen beobachten und frische Luft schnappen.“
Fast zwei Monate später trat ich im Norden des Bundesstaates gegen James Tillis an. Ich war nicht in bester Verfassung – wegen der Infektion am Ohr und weil ich viel zu viel getrunken und gefeiert hatte. Der Kampf dauerte zehn harte Runden. Danach war ich einfach nur froh, dass ich ihn für mich entschieden hatte. Ich schickte Tillis einmal zu Boden, weshalb sich die Waagschale zu meinen Gunsten neigte, aber er war der härteste Gegner, auf den ich bis dahin getroffen war. Er traf mich am Körper mit so schweren Schlägen, dass ich nach dem Fight nicht mehr gehen konnte. Ich konnte nicht einmal mehr nach Hause fahren und musste im Hotel bleiben. In dieser Nacht erfuhr ich, was es wirklich heißt zu kämpfen. Mehrmals hatte ich mir sehnlichst gewünscht, zu Boden zu gehen, nur um ein bisschen verschnaufen zu können. Stattdessen umklammerte ich ihn immer wieder, um zu Atem zu kommen.
Am nächsten Tag schaltete Jimmy in den Beschwichtigungsmodus. Er teilte der Presse mit, der „Kampf war nur eine Hürde für ihn. Jetzt sehen wir, dass er die volle Distanz schafft“. Er verstand es meisterhaft, die Presse zu manipulieren, ganz zu schweigen von der Öffentlichkeit. Er und Cayton heckten eine bis dahin nie dagewesene PR-Kampagne aus. Kein Schauspieler auf der Welt hat je so eine Presse bekommen. Das machen heute alle so, aber damals waren sie echte Innovatoren.
Knapp drei Wochen später trat ich im Madison Square Garden gegen Mitch Green an. Er war wirklich ein verrückter Scheißkerl. Vor dem Kampf versuchte er sich bei mir ins Bewusstsein zu bringen, indem er der Daily News mitteilte, dass ich erst 19 sei, aber wie 40 aussehe. Als Marv Albert mich fragte, ob mich Green wütend gemacht habe, sagte ich: „Mitch Green ist ein guter Kämpfer, aber rhetorisch hat er nicht das Kaliber, um mich aus der Ruhe zu bringen, also gar nicht.“
Es war mein erster Kampf im Rahmen meines neuen HBO-Vertrags, den Jimmy und Cayton ausgehandelt hatten. Und es war ein Kick, zum ersten Mal in der großen Arena des Madison Square Garden zu boxen. Mein Interview auf HBO vor dem Kampf ließ diesen Schluss allerdings nicht zu. Als man mich fragte, ob ich diese ganze neuerliche Aufmerksamkeit und den Wohlstand genießen würde, wurde ich unwirsch: „Die Leute würden sicher nicht mit mir tauschen wollen“, sagte ich. „Wow, so viel Geld kann man damit verdienen“, meinten sie. „Aber wenn sie durchmachen müssten, was ich durchmache, kämen ihnen die Tränen. Es ist richtig deprimierend. Alle wollen was. So erbittert, wie man in der Trainingshalle arbeitet, so erbittert arbeiten die Leute daran, einen auszunehmen.“ Man hörte Cus aus mir reden. Ich hätte eigentlich aufgekratzter sein müssen, denn ich bestritt meinen ersten Hauptkampf im Garden. Und Green war damals ein hochangesehener Kämpfer. Er war vierfacher Golden Gloves Champion, der in seiner Laufbahn nie besiegt worden war, bis er 1985 den Entscheidungskampf für den USBA-Titel an Trevor Berbick verlor. Dass ich ihn schlagen würde, wusste ich allerdings schon, als wir in den Ring einzogen. Ich spürte bei ihm keinerlei bedrohliche Ausstrahlung. Der Kampf ging über die volle Distanz, was aber okay war. Nach dem Fight gegen Tillis sollte ich zehn Runden bequemer überstehen können. Weil ich wusste, dass er mich nicht verletzen konnte, arbeitete ich an meiner Ausdauer. Ich entschied jede Runde für mich – in einem Kampf, der alles andere als langweilig war. Irgendwann schlug ich ihm den Mundschutz und eine Brücke mit mehreren Zähnen aus dem Mund. Er kassierte zahlreiche Strafpunkte. Ich war so locker, dass ich Kevin zwischen der achten und der neunten Runde, als er dauernd auf mich einschwatzte und mich anhielt, mehr Schläge auszuteilen, ein Küsschen aufdrückte.
Nach dem Kampf hatte ich zu meinem überheblichen Ego zurückgefunden:
„Mit Verlaub: Diesen Kampf habe ich sehr leicht gewonnen. An diesem Ort schlägt mich keiner. Ich lasse nicht zu, dass mir jemand in die Quere kommt“, teilte ich der Presse mit.
Meine nächste Zielscheibe war Reggie Gross. Dieser harte Kämpfer hieß „The Spoiler“, der Spielverderber, weil er einige gute Boxer aus der Fassung gebracht hatte, darunter Bert Cooper und Jimmy Clark, einen großen amerikanischen Olympia-Teilnehmer. Fast wäre der Kampf abgesagt worden, weil ich in der Woche eine schwere Bronchitis bekam. Die Bronchitis war sozusagen eine stetige Begleiterin in meinem Leben, an die ich mich längst gewöhnt hatte. Aber diesmal war der Fall so ernst, dass man mich am Tag vor dem Kampf zur Untersuchung zum Arzt brachte.
„Ich fürchte, den Kampf werden Sie verschieben müssen. Er ist erheblich krank“, sagte der Arzt.
„Kann ich Sie einen Augenblick sprechen, Sir?“, fragte Jimmy. Ich sah seinen Blick und wusste sofort, dass ich doch im Ring stehen würde. In der ersten Runde bearbeitete ich Reggie Gross mit einer wilden Serie von Hieben, während der er sich bedeckt hielt. Dann ging er plötzlich zu Gegenangriffen über, die ich aber gut parieren konnte. Ich duckte mich unter seinen hefigen Schlägen weg, schlug ihn mit einem wuchtigen linken Haken ein erstes Mal und mit einer Serie von Schlägen ein zweites Mal nieder. Der Ringrichter brach den Kampf ab, weil Reggie Gross glasige Augen bekam, aber Reggie protestierte. „Du kannst nicht mehr laufen und willst kämpfen?“, konterte der Ringrichter.
Meine beiden nächsten Gegner waren anscheinend von kleinerem Kaliber. Vielleicht wollten Jimmy und Cayton aber auch, dass ich weitere K.o.-Siege in der ersten Runde erzielte. Während ich bei William Hosea ihre Erwartungen erfüllte, benötigte ich bei Lorenzo Boyd dafür allerdings zwei Runden. Aber meine blitzschnelle Rechte, die seinen Brustkorb traf, und mein sofort nachgeschobener wuchtiger rechter Aufwärtshaken ließen eine jubelnde Menge zurück. Zwei Wochen später machte ich von mir reden, als ich Marvis Frazier, den Sohn von Joe Frazier, in 30 Sekunden erledigte. Ich trieb ihn in die Ecke, stellte ihm mit meiner Führhand eine Falle und machte ihn mit meinem Lieblingspunch, dem rechten Aufwärtshaken, vollends fertig. Er wirkte so stark verletzt, dass ich zu ihm eilte, um ihm aufzuhelfen. Ich liebe Marvis. Er ist ein großartiger Kerl.
Ich war erst vor einigen Wochen 20 Jahre alt geworden. Unserem Plan zufolge sollte ich Ende 1986 jüngster Weltmeister im Schwergewicht werden. Während Jimmy und Cayton für mich darüber verhandelten, ließen sie mich am 17. August in Atlantic City gegen Jose Ribalta antreten. Ribalta war ein spielerischer Kämpfer, der mich im Gegensatz zu Green und Tillis tatsächlich beschäftigt hielt. Und er hatte offenbar den Willen, sich nicht k.o. schlagen zu lassen. Ich schlug ihn in der zweiten und erneut in der achten Runde nieder, aber er stand immer wieder auf. In der zehnten ging er ein drittes Mal zu Boden. Als er wieder aufstand, drängte ich ihn in die Seile. Daraufhin brach der Ringrichter den Kampf ab.
Ribalta erwarb sich mit seinem entschlossenen Kampf nicht nur beim Publikum und den Kommentatoren großen Respekt, er schaffte es auch, mir die Nacht zu ruinieren. Ich hatte nach dem Kampf noch eine Verabredung mit einer schönen jungen Studentin der Penn State University, die ich auf der Hundertjahrfeier der Freiheitsstatue kennengelernt hatte. Die junge Lady begleitete mich auf mein Zimmer. Als sie mich berührte, zuckte ich vor Schmerz zurück.
„Hey! Bitte fass mich nicht an“, sagte ich ihr. „Das geht nicht gegen dich. Ich brauche einfach ein bisschen Ruhe.“
Sie hatte Verständnis für meine Misere und fuhr zurück zu ihrer Uni, wir verabredeten jedoch, es sobald wie möglich nachzuholen. Sie hatte den Kampf und die vielen Schläge gesehen, die ich hatte einstecken müssen. So etwas hatte ich bislang noch nicht erlebt. Von den ganzen Körperschlägen war mir richtig schlecht, sogar noch Stunden danach. Ribalta und Tillis waren die einzigen Typen, die mich so zugerichtet haben. Nie wieder haben mir alle Knochen so wehgetan. Aber ich hatte viel darüber gelesen, wie sich andere große Kämpfer nach manchen Fights gefühlt hatten, als fehle ihnen der halbe Kopf, und ich war der Meinung, dass das dazugehörte, wenn ich meine Mission erfüllen wollte. So viel Schmerz musste sein.
Inzwischen gingen die Verhandlungen für meinen Titelkampf in die heiße Phase. Jimmy beschloss, mich in Las Vegas kämpfen zu lassen, um mich an die Umgebung zu gewöhnen, in der ich dann später im Jahr meinen Titel holen sollte. Wir kamen bei Jimmys Freund Dr. Bruce Handelman unter. Ich trainierte in Johnny Toccos Boxstudio, einer heruntergekommenen Boxhalle ohne Komfort. Es gab nicht einmal eine Klimaanlage. Tocco war ein respekteinflößender Typ und einst mit Sonny Liston befreundet. An den Wänden hingen Bilder von Johnny und den ganzen Größen der alten Zeit.
Vor dem Sparring packte es mich einmal im Umkleideraum. Ich sagte Kevin, dass es mir in Vegas nicht gefalle und dass ich nach Hause wolle. Wegen des Kampfes machte ich mir richtig Sorgen. Ich brauchte diesen Sieg über Ratliff, um mich für den Kampf gegen Trevor Berbick zu qualifizieren.
Kevin ging hinaus und teilte es Steve Lott mit. Steve hatte den WWCT-Gedanken: „Was würde Cus tun?“ Er kam zu mir in den Umkleideraum und versuchte mühselig, Zuversicht zu verbreiten. „Du bist der Star der Show. Du wirst diesen Kerl in zwei Runden niederschlagen. Du wirst einen fantastischen Kampf hinlegen. Wenn es dir hier nicht gefällt, brauchen wir nie wieder hierherzukommen. Was meinst du?“
Steve bewältigte Situationen immer auf die charmante Art. Natürlich wäre ich nirgendwo hingegangen. Manchmal musste ich einfach Dampf ablassen. Und was Cus getan hätte, wusste er nicht. Cus hätte mich angeschaut: „Was? Vor diesem Typen hast du Angst? Der ist doch ein fauler Sack. Den erledige ich für dich.“
Also trat ich am 6. September gegen Alfonzo Ratliff, einen ehemaligen Weltmeister im Cruisergewicht, in den Ring. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er eine Stufe über Ribalta stand, aber er war sicher kein fauler Sack, sondern ein taffer Gegner. Die Buchmacher in Vegas waren offenbar anderer Meinung. Sie nahmen zum Ausgang keine Wetten an, sondern nur dazu, ob der Kampf länger oder kürzer als fünf Runden dauern würde. Bevor ich auf der Bildfläche erschienen war, hatte es solche Wetten nicht gegeben, ich erschloss ihnen quasi Neuland. Als der Gong ertönte, tänzelte Ratliff gleich davon. Dagegen war Mich Green ein Spaziergänger gewesen. Es war so übel, dass sogar die HBO-Typen Witze rissen. „Ich frage mich, ob er in der zweiten Runde sein 10- oder sein 12-Gang-Rad benutzt“, höhnte Larry Merchant.
In der nächsten Runde versuchte er ernsthaft zu kämpfen, aber das währte nicht lange. Ich schickte ihn mit einem linken Haken zu Boden, und als er wieder aufstand, nietete ich ihn mit mehreren Schlägen wieder um.
„Sein Fahrrad hat einen Platten“, witzelte Merchant. Als Jimmy nach dem Kampf in den Ring kam, kommentierte er Ratliffs Herumgerenne. „Ich habe seinen Zug gespürt“, sagte ich.
Bald war es offiziell, am 22. November 1986 sollte ich Trevor Berbick seinen Titel streitig machen. Bis zu dem Kampf waren es noch über zwei Monate. Jimmy und Cayton beschlossen, mich in den Talkshows herumzureichen, um für den Kampf zu werben und meine Karriere zu fördern. Als Erstes war ich zu Gast in David Brenners Nightlife. David war ein großartiger Kerl, der mich mit größtmöglichem Respekt behandelte. Er prophezeite netterweise, dass ich der nächste Weltmeister im Schwergewicht würde. Aber mehr bedeutete mir, dass sein anderer Gast, der große ehemalige Champion Jake LaMotta, dieselbe Vorhersage traf.
„Ohne jeden Zweifel der nächste Weltmeister im Schwergewicht“, sagte Jake, als er eintrat und mich umarmte. „Und wenn er das nicht schafft, verabreiche ich ihm Prügel. Wenn du nicht nachlässt, Kumpel, wirst du so gut wie Joe Louis, wie Marciano oder sogar besser.“
Mir ging das Herz auf.
Dann stellte Brenner eine Frage, die Jake sehr weitsichtig beantwortete.
„Nehmen wir an, Mike wird Weltmeister. Welche Ratschläge geben Sie ihm dann?“
„Der beste Ratschlag, den ich ihm geben kann, lautet: Halt dich selbst auf Trab und tu so, als seist du für ein paar Jahre im Knast“, sagte Jake. „Halt dich von dem ganzen Müll da draußen fern. Da draußen ist viel Müll.“
„Was meinst du mit Müll?“, fragte ich.
„Leider ziehen Typen wie du und ich den Müll an“, sagte er.
Ich wurde in die Joan Rivers Show eingeladen. Von ihr und ihrem Mann Edgar war ich begeistert. Die beiden gaben mir ein richtig gutes Gefühl. Ich spürte, dass ihre Ausstrahlung echt war. Das war einer der besten Momente in meinem Leben. Während unseres Interviews fragte mich Joan, ob es da jemanden in meinem Leben gebe wie Adrian im Film Rocky.
„Keine Freundin“, sagte ich.
„Wenn Sie ins Training gehen, ist’s mit Sex dann vorbei?“, fragte sie.
„Nein.“
„Schau an, mein Mann redet sich nämlich immer damit heraus, dass er im Training sei“, witzelte sie.
In der Dick Cavett Show führte mir Dick ein wenig Aikido vor. Er bat mich, ihn an den Handgelenken festzuhalten.
„Der 87-jährige Begründer des Aikido kann sich aus dem Griff des weltstärksten Manns befreien“, sagte er, machte eine kurze Bewegung und entwand sich meinem Griff.
„Aber so packt Sie kein Straßenräuber an“, protestierte ich.
Ich war in diesen Shows so charmant, wie Jim und Bill mich haben wollten – im Gegensatz zu mir selbst. Ich wollte ein übler Kerl sein, mit dem Football-Spieler Jim Brown als meinem Vorbild. Als ich mich in den New Yorker Bars herumzutreiben begann, traf ich auf ältere Profi-Footballer, die mit ihm gespielt hatten. Sie redeten von ihm wie von einem Mythos.
„Hey, wenn der hereinkäme und ihm irgendwas nicht passte, der Geruch, die Musik oder laute Unterhaltungen, würde er sofort alles kurz und klein schlagen.“
Ich hörte mir das an und dachte: „Verdammt, ich wünschte, ich wäre so ein übles Arschloch, über das die Leute so reden. Wenn Jim dich fertigmacht, weil er den Gestank vor Ort nicht mag, dann muss ich hereinspazieren und gleich irgendein Arschloch umbringen.“
Als der 22. November näher rückte, begann ich ernsthaft zu trainieren, zunächst einen Monat in Catskill und dann in Vegas. Gleich zu Beginn gaben mir Jimmy und Cayton ein Video mit Berbicks Kampf gegen Pinklon Thomas, in dem er sich den Meistertitel geholt hatte. Ich schaute mir das Video an und meldete mich dann bei Jimmy.
„War das Video in Zeitlupe?“
Ich war wahnsinnig überheblich, hatte aber einfach das Gefühl, dass meine Zeit gekommen sei. In meinem kranken Hirn kamen sämtliche alten großen Boxkämpfer und Kriegsgötter über mich, um mir zuzusehen, wie ich in ihren Kreis aufstieg. Sie würden mir ihren Segen geben und mich in ihren Club aufnehmen. Im Kopf hörte ich immer noch Cus, aber nicht in einem krankhaften Sinn, sondern zur Unterstützung.
„Das ist der Moment, für den wir trainiert haben, seitdem du 14 bist. Wir sind das immer wieder durchgegangen. Gegen diesen Typen kannst du mit geschlossenen Augen antreten.“
Ich wusste, dass Berbick grob, zäh und ein harter Gegner war, weil er als Erster in einer Titelverteidigung 15 Runden gegen Larry Holmes durchgestanden hatte. Larry hatte bislang alle k.o. geschlagen. Ich wollte Berbick einfach zurechtstutzen, dann würden mich alle ernstnehmen. Denn damals dachten alle, dass ich gegen Flaschen und Staubflusen antreten würde. Es hieß, dieser Typ sei kein echter Fighter, der trete bloß bei leichten Kämpfen an. Deshalb war es mein Hauptziel, Berbick zu erledigen. Ich wollte ihn in der ersten Runde aus dem Rennen werfen – und ihn richtig übel zurichten.
Kevin und Matt Baranski waren so zuversichtlich wie ich. Wir waren alle in Hochstimmung, und meine war noch höher. Einen Tag vor dem Kampf schaute ich auf meine Unterhosen und bemerkte einen Ausfluss. Ich hatte einen Tripper und wusste nicht, ob ich ihn mir bei einer Hure oder einem schmuddeligen jungen Mädchen eingefangen hatte. Wir übernachteten wieder in Dr. Handlemans Haus, der mir ein Antibiotikum spritzte.
Später am selben Tag zogen Steve Lott und ich los, um einige Videokassetten auszuleihen.
„Was wohl Cus über diesen Berbick sagen würde, Mike?“, fragte er mich.
Steve wollte mich auf die Art dazu bringen, mich in Cus hineinzuversetzen und so zu denken wie er. Was Steve nicht wusste: Ich brauchte nicht wie Cus zu denken. Er war bereits in meinem Kopf. „Er würde sagen, dass dieser Typ eine Flasche ist“, antwortete ich. „Ein fauler Sack.“
Beim Wiegen führte ich mich wie ein echtes Arschloch auf. Ich starrte Berbick immerzu an, sobald ich ihn im Blick hatte. Als er zu mir kam, um mir die Hand zu schütteln, ließ ich ihn mit der ausgestreckten Hand stehen und drehte mich weg. Wenn ich ihn dabei ertappte, wie er mich anschaute, kläffte ich ihn an: „Was zum Teufel glotzt du mich an?“ Dann sagte ich ihm, dass ich ihn in zwei Runden ausschalten würde. Als er mit seinem Gürtel posierte, brüllte ich: „Viel Spaß mit deinem Gürtel. Lange hast du ihn nicht mehr. Der wandert jetzt weiter an die Taille eines echten Weltmeisters.“ Ich war damals unglaublich großspurig und aggressiv. Irgendwie konnte ich Berbick damals einfach nicht ab. Außerdem wollte ich seinen Gürtel. Ich ließ das grünäugige Monster in mir raus. Ich musste einfach auf Touren kommen.
Ich war auch deshalb wütend, weil Berbicks Trainer Angelo Dundee damit prahlte, dass mich sein Schützling schlagen könne. Cus war immer neidisch gewesen auf Dundee, weil er Ali trainiert hatte und ihm so die Aufmerksamkeit der Medien sicher gewesen war. Cus hatte geglaubt, dass er das nicht verdient hatte.
„Berbick hat einen Stil, mit dem er Tyson übel reinlegen kann“, teilte Dundee der Presse mit. „Trevor leckt sich die Lefzen beim Gedanken, dass er wenigstens einmal nicht jagen muss, weil Tyson sich ihm direkt stellen wird. Trevor ist gut bei Körpertreffern und hat schon 23 Knockouts in der Bilanz. Er ist zuversichtlich. Und ich bin es auch. Ich denke, er wird Tyson in einer der letzten Runden stoppen.“
In der Nacht vor dem Kampf konnte ich nicht schlafen. Ich hing ständig am Telefon und redete mit Mädchen, die ich mochte, aber mit denen ich noch keinen Sex gehabt hatte. Um mich abzulenken, fragte ich sie, was sie so machten, aber sie wollten bloß über den anstehenden Kampf reden. Dann stand ich auf und machte in meinem Schlafzimmer Schattenboxen.
Am Tag des Kampfs aß ich um 13 Uhr eine kleine Pasta, um 16 Uhr ein Steak und um 17 Uhr nochmal Pasta. Im Umkleideraum verdrückte ich einen Schokoriegel und trank Orangensaft. Dann bandagierte mir Kevin die Hände und zog mir die Handschuhe über. Es war Zeit, in den Ring zu steigen. Weil es in der Arena kühl war, zerschnitt Kevin ein Handtuch und legte es mir um den Hals. Ich trug die schwarzen Shorts, die ich schon seit ein paar Kämpfen trug. Das kostete mich 55.000 Dollar Strafe, weil Berbick schon schwarze Shorts trug, aber mir war das egal. Ich brauchte so ein unheilverheißendes Outfit.
Als Herausforderer musste ich als Erster hinausgehen. Zu meinem Einzug spielte man einen Song der Gruppe Toto, während ich in meinem Kopf aber nur einen Song von Phil Collins hörte: „In The Air Tonight“.
Ich trat durch die Seile und schritt durch den Ring. Als ich in die Menge blickte, sah ich Kirk Douglas, Eddie Murphy und Sylvester Stallone. Minuten später kam Berbick in einem schwarzen Boxmantel mit schwarzer Kapuze herein. Er wirkte großspurig und voller Zuversicht, aber ich spürte, dass es nur Fassade, nur eine Illusion war. Ich wusste, dass sich dieser Typ für seinen Gürtel nicht umbringen würde.
Ali wurde der Menge präsentiert und kam dann zu mir herüber.
„Tritt ihm für mich in den Arsch“, sagte Ali.
Ali war von Berbick fünf Jahre zuvor geschlagen worden und hatte sich daraufhin aus dem Boxsport zurückgezogen. Den Gefallen wollte ich ihm mehr als gerne tun.
„Das wird leicht“, versicherte ich Muhammad.
Schließlich war es Zeit für den Kampf. Der Gong ertönte. Ringrichter Mills Lane forderte uns mit einer Geste zur Aktion auf. Ich griff Berbick an und prügelte gleich mit harten Schlägen auf ihn ein. Ich fasste es nicht, dass er sich weder bewegte noch zurückschlug. Er blieb einfach vor mir stehen. Nahe am Rand des Rings verpasste ich ihm eine Rechte auf sein linkes Ohr und versuchte ihm das Trommelfell zu zerschlagen. Ungefähr in der Mitte der Runde überraschte ich ihn mit einer harten Rechten und setzte ihm so sehr zu, dass er gegen Ende der ersten Runde benommen wirkte. Er hatte ein paar richtig fette Treffer einstecken müssen.
Ich ging in meine Ecke und setzte mich. Wegen der Antibiotika tropfte ich wie ein angeschlagener Wasserhahn. Aber das störte mich nicht, ich wollte nur Berbick umnieten. Übrigens kämpfte einer meiner Helden, Kid Chocolate, die ganze Zeit über mit einer Syphilis.
„Beweg deinen Kopf. Vergiss die Führhand nicht“, sagte Kevin. „Du machst hier ja den Kopfjäger. Halt dich zuerst an den Körper.“
Zehn Sekunden nach Beginn der zweiten Runde schickte ich ihn durch einen Volltreffer mit der Rechten zu Boden. Er sprang aber sofort wieder auf und ging auf mich los. Er versuchte zurückzuschlagen, aber seine Schläge blieben wirkungslos. Ungefähr eine halbe Minute vor Ende der Runde traf ich ihn mit einem Körperhaken und setzte einen Aufwärtshaken nach, der aber danebenging. Dafür traf ich ihn mit der Linken an der Schläfe. Etwas verzögert ging er zu Boden. Ich hatte den Schlag selbst nicht gespürt, aber er tat beste Wirkung. Berbick versuchte aufzustehen, stürzte aber wieder zu Boden. Mir fiel auf, dass sein Knöchel geknickt war.
„Der steht vor dem Auszählen nicht mehr auf“, dachte ich.
Ich behielt recht. Berbick versuchte ein zweites Mal aufzustehen, taumelte über den Boden und fiel wieder hin. Als er es am Ende doch noch schaffte, umarmte ihn Mills Lane und schleppte ihn fort. Das war’s. Ich war der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten.
„Es ist vorbei. Das war’s. Wir haben eine neue Ära im Boxsport“, sagte der HBO-Ansager Barry Watkins.
„Mike Tyson hat gemacht, was Mike Tyson normalerweise macht. Er hat gekämpft“, fügte Sugar Ray Leonard hinzu.
„Und Kampf schreibt man hier groß“, sagte Watkins.
Ich war einfach nur benommen und empfand überhaupt nichts. Mir war bewusst, was um mich herum vor sich ging, ich war aber wie betäubt. Kevin umarmte mich. José Torres kam zu mir.
„Ich kann nicht glauben, was der Mann gesagt hat. Mit 20 werde ich ein verdammter Weltmeister sein“, sagte ich zu ihm. „Dieser verdammte Scheiß ist doch irreal. Weltmeister mit 20. Ich bin ein kleiner Junge, ein verdammt kleiner Junge.“
Jimmy trat in den Ring und küsste mich.
„Glaubst du, Cus hätte es gefallen?“, fragte ich. Jimmy lächelte.
Don King, dessen Sohn Berbick managte, kam rüber, um mir zu gratulieren. Ich blickte über das Publikum hinweg und verspürte ein Gefühl der Arroganz. „Ja, wir haben’s geschafft“, dachte ich. „Ich und Cus haben es geschafft.“ In meinem Kopf redete ich mit Cus: „Wir haben es geschafft und den ganzen Typen gezeigt, dass sie falschlagen. Ich wette, Berbick hält mich jetzt nicht mehr für zu klein, oder?“ Dann merkte ich, dass Cus die Art, wie ich gekämpft hatte, verabscheut hätte.
„Alles, was du im Ring vorgeführt hast, war Müll“, hörte ich ihn in meinem Kopf sagen. „Aber der Ausgang war so fulminant, dass er allen im Gedächtnis bleibt.“
Es war Zeit für die Interviews nach dem Kampf. Ich musste Cus würdigen. Ich, der bedeutendste Boxer der Welt, war seine Kreatur. Cus hätte dabei sein müssen. Er hätte diesen Leuten, die ihn als verrückt abgetan hatten, mal so richtig den Kopf gewaschen, und ihnen gesagt: „Keiner hier kann meinen Jungen schlagen. Er ist erst 20, aber keiner auf der Welt zwingt ihn in die Knie.“
„Auf diesen Augenblick“, sagte ich zu Beginn der Pressekonferenz, „habe ich mein ganzes Leben gewartet, seitdem ich mit dem Boxen angefangen habe. Berbick war ein sehr starker Gegner. Ich hätte nie erwartet, dass er so stark wie ich ist … Ich habe ihm jeden Hieb mit üblen Absichten verpasst. Meine Bilanz reicht für die Unsterblichkeit, sie wird nie übertroffen werden. Ich will ewig leben … Ich denke nicht daran, zu verlieren … Um zu verlieren, müsste ich tot hinausgetragen werden. Ich war gekommen, um zu zerstören und den Weltmeistertitel im Schwergewicht zu erringen. Ich habe es geschafft. Ich möchte meinen Kampf meinem großen Betreuer Cus D’Amato widmen. Ich bin sicher, er ist hier, schaut herunter, redet mit all den großen Kämpfern und sagt, dass es sein Junge geschafft habe. Ich dachte, er sei ein irrer weißer Typ … aber er war ein Genie. Alles, was er vorausgesagt hat, ist eingetroffen.“
Jemand fragte, gegen wen ich als Nächstes antreten würde.
„Mir ist egal, gegen wen ich als Nächstes kämpfe“, sagte ich. „Wenn ich der Größte sein will, muss ich gegen jeden kämpfen. Ich will gegen alle antreten.“
Nach dem Kampf lobte mich sogar Dundee.
„Tyson teilt Kombinationen aus, die ich noch nie gesehen habe. Ich war verblüfft. Ich habe mit Ali und Sugar Ray gearbeitet, sehe aber bei Tyson eine einzigartige Dreier-Kombination. Wann sieht man schon einen Boxer, der eine Rechte in die Niere schlägt, in der Mitte einen Uppercut anbringt und dann einen linken Haken verpasst?“
Den Gürtel legte ich die ganze Nacht nicht mehr ab. Ich trug ihn in der Eingangshalle des Hotels, auf der Siegesfeier nach dem Kampf und noch danach, als ich ganz spät mit Jay Bright, meinem Zimmerkameraden in Cus’ Haus, mit Bobby Stewarts Sohn und dem Kämpfer Matthew Hilton einen heben ging. Wir gingen vom Hilton aus schräg über die Straße in die Kellerbar The Landmark in Las Vegas. Obwohl der Laden leer war, setzten wir uns und becherten die ganze Nacht durch. Ich trank Wodka pur und war am Ende sturzbesoffen. Matthew kippte am Ende der Nacht aus den Latschen. Danach zog ich einfach weiter herum, ging zu verschiedenen Mädchen nach Hause und führte meinen neuen Meisterschaftsgürtel vor. Ich hatte keinen Sex mit ihnen, blieb einfach eine Weile da, zog zur Nächsten weiter und blieb ein bisschen bei ihr. Es war verrückt. Man erinnere sich daran, dass ich damals gerade 20 Jahre alt war. Und das hieß, dass viele meiner Freunde gerade 15 oder 16 waren. Der Altersunterschied war nicht sehr groß. Weil ich Weltmeister war, erwarteten alle ganz plötzlich von mir, dass ich ein total beherrschter Typ war – wegen dieses Titels und was er darstellte. Aber eigentlich war ich nur ein Kindskopf, der auf Fun aus war.
Und ich war orientierungslos. Zu der Zeit, als ich den Gürtel errang, war ich seelisch richtig kaputt, weil mir jede Führung fehlte. Mit fehlte Cus. Für ihn hatte ich diesen Gürtel erringen müssen. Wir hatten ihn erringen oder untergehen wollen. Ohne den Gürtel aus dem Ring zu steigen, wäre undenkbar gewesen – wegen all dieser Opfer, dieser Leiden und der ganzen Hingabe Tag für Tag. Als ich früh am Morgen in mein Hotelzimmer zurückkehrte, schaute ich mich mit dem Gürtel im Spiegel an und stellte fest, dass ich unsere Mission erfüllt hatte. Jetzt war ich frei.
Aber dann erinnerte ich mich wieder an ein Lenin-Zitat, das ich in einem der Bücher in Cus’ Bibliothek gelesen hatte. „Freiheit ist etwas sehr Gefährliches. Wir rationieren sie sehr vorsichtig.“ Ich hätte diese Warnung in den folgenden Jahren beachten sollen.