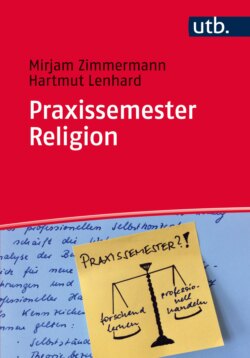Читать книгу Praxissemester Religion - Mirjam Zimmermann - Страница 9
Оглавление2 An einem fremden Ort: Meine Praktikumsschule auf den ersten Blick
„Jemand, der eine Schule in einem anderen Land betritt, ist in der Regel irritiert: Alles ist verblüffend ähnlich im Vergleich mit der Schule, die er aus eigener Erfahrung kennt – und alles ist zugleich verblüffend anders.“1 Gleiches gilt auch für den Erstkontakt mit einer neuen Schule, wie er z.B. beim ersten Kennenlernen der Praktikumsschule erfolgt. Exemplarisch wird diese Wahrnehmung aus der folgenden Darstellung eines Studierenden deutlich.
Dichte Beschreibung des Evangelischen Gymnasiums Weidenau (Simon Bäumer im SS 2014)
Die erste Anfahrt gleicht dem Eintritt in eine neue Welt. Eine gewundene Straße führt geradewegs ab von der pulsierenden Weidenauer Straße, unter der stark befahrenen Straße der Region hindurch, hinein in eine durch Wald und den Berg geprägte Enklave. Das Gebäude an sich gleicht einer Burg. Man muss erst zu Fuß den Berg entern, um hinter der Fassade das pulsierende Leben dieses Ortes erkunden zu können. Nach außen wirkt zuerst das Graue und Triste der Außenfassade und die winzigen, quadratischen Fenster, hinter denen sich, auf den zweiten Blick, das Treppenhaus befindet.
Geht man dann hinauf, taucht man ein in eine bunte und abwechslungsreiche Welt, die von Schülern und Lehrern gestaltet wurde. Überall hängen kreative Produkte der Bewohner dieser Burg. Und dabei spiegelt die Vielfalt dieser Produkte wohl auch die Entfaltungsmöglichkeiten innerhalb der grauen Fassade wider. Hier steht der Milchautomat neben Plakaten der Baseball-AG, die Werte der Schule hängen neben Plakaten des Abi-Jahrgangs 1998.
Als Zentrum des Lebens liegt der Schulhof umklammert von allen Gebäuden inmitten der Burganlage. Von dort aus erreicht man sternförmig alle Möglichkeiten der Schule. Aus dem Lehrerzimmer erblickt man auf 12 Uhr das neue Mensagebäude. Im Erdgeschoss ist auch hier die Vielfalt unbeschreiblich. Tagesgericht, Pizza, Pasta, Salat, Nachtisch, Getränke, und das für 3,50 €. Der Mittag kann hier genauso gut verlebt werden wie im Hauptgebäude bei der ÜMi (ÜberMittagsBetreuung), die mit Sesseln, Sofas und neuem Mobiliar sowie den Fotos glücklicher betreuter Schüler zum Verweilen einlädt. Im zweiten Geschoss findet man eine großzügige Bibliothek. Ein sehr breit gefächertes Sortiment bietet anscheinend eine ideale Lernvoraussetzung. Und es wird investiert. Wenn bei einem Einbruch die PCs geklaut werden, wieder auftauchen und von der Versicherung geprüft werden, bestellt man einfach neue. Der aufsichtführende FSJler begrüßt schick gekleidet alle Gäste und wirkt wie ein professioneller Bibliothekar.
Auf 11 Uhr blockiert im Hintergrund zwischen Bäumen versteckt das Studentenwohnheim das Blickfeld. Zwischendurch ist das Schulgelände mit Zäunen und Toren begrenzt. Wie eben in einer Burganlage.
Auf 10 Uhr findet man das ehemalige Haus des Direktors. Heute quasi eine unbenutzte „Ruine“, wurde es, nachdem die Direktoren dieses seit vielen Jahren nicht mehr benutzten, einfach mehr und mehr in Schülerhand gegeben. Als Aufenthalts- und Arbeitsraum. Heute ist es in keinem guten Zustand mehr, ein Zeichen dafür, dass die SuS schalten und walten konnten, wie es ihnen beliebt. Eine freie Selbstbestimmung eben.
Von 8 bis 13 Uhr ist quasi die Hauptburg. Die Gänge gleichen Museumsgängen, die Zeugnis liefern von der Arbeit, die hier geleistet wird. Ein großer Teil der Arbeiten hat, wie man es in einem Gymnasium in kirchlicher Trägerschaft erwartet, einen christlich-ethischen Hintergrund.
Das Lehrerzimmer ist die geistige Zentrale. Die Arbeitsräume gleichen einer altehrwürdigen Bibliothek. Die Atmosphäre ist still, Gespräche werden mit sehr gedämpfter Stimme geführt. Die ehemalige Bibliothek ist eigentlich gar nicht ehemalig. Zwei Leitern helfen den Pädagogen, ihre Literatur auch in der zweiten und dritten Etage der Bücherregale zu finden. Die Werke sind teilweise alt, manche extrem neu, ein guter Mix, ein breites Angebot eben. Wie auch in den Klassenräumen. Besonders beeindruckend ist der Religionsraum. Im hinteren Teil reihen sich fünf Schränke aneinander, alle prall gefüllt mit Klassensätzen an theologischer und geschichtlicher Literatur. Bibelausgaben aller Art, Denkschriften und Lehrwerke. Währenddessen berät der Träger der Schule, das Lehrerzimmer noch arbeitsorientierter zu gestalten. Diverse Arbeitsbereiche, getrennt von ‚Unterhaltungs-‘Bereichen. Die Teeküche muss einem vernünftigen Kopierraum weichen. Dazu eine striktere Trennung von Lehrer- und Schülerleben, die jetzt schon durch Türen separiert sind; künftig soll die Trennung aber noch optisch intensiviert werden.
Die Schulleiterin erzählt über ihre Schule. Eines ihrer ersten Worte „Ich liebe diese Schule“ unterstützt sie mit einem obligatorischen Handkreuzen auf der Brust. Man kauft ihr aber auch ohne gestische Unterstützung ab, dass sie ihre Schule liebt. Sie erklärt, dass aktuell ganz groß das Thema „Smartphones“ diskutiert wird, aber alle wehren sich gegen ein striktes Verbot. Man setzt auf eigenverantwortliche Schüler. Und das spiegelt die Schule wider: Lehrer und Träger investieren in Angebote, die das eigenverantwortliche Leben der Schüler fördern und begleiten sollen. Einige Lehrer sehen sich sogar „nur als Moderator“ im Unterricht. Deutlich machen diesen Trend drei weitere Beobachtungen: 1. Ein wohl sehr intensiv gepflegter Schüleraustausch mit Israel. Ein Wimpel im Lehrerzimmer, eine eigene Abteilung im Medienzentrum, ein eigener Film über ein gemeinsames Projekt. Das Motto: Erfahrung durch Praxis und dadurch lernen. 2. In der Theater-AG können die SuS sich ausleben. Ein großer Raum mit Bühne bietet Platz sich zu erfahren und im Theater kreativ zu werden. 3. Der Musiklehrer baut gerade für eine große Band auf. Er stöpselt die Anlage an. In der Band: Flügel, Bongos, Trommeln, Bass, Gitarre etc. Viele, viele Möglichkeiten sich zu beteiligen.
Und das Konzept scheint aufzugehen: Es ist Mottowoche der Abiturienten. Alle sind im Thema verkleidet. Laute Musik, gemeinsame Gesänge und Jubelschreie schallen ins Gebäude. Es ist eine ausgelassene Stimmung und anscheinend freuen sich nicht nur die Schüler. Auch Lehrer gehen mit einem Lächeln im Gesicht vorbei.
Es gibt kein zweites Mal einer ersten Wahrnehmung. Der erste Eindruck bei der Begegnung mit einer Person oder einer Sache ist deshalb auch immer entscheidend für die meist länger andauernde Einschätzung. Diesen „ersten Blick“ hinsichtlich der Erstbegegnung mit einer Schule festzuhalten und zusammenhängend zu interpretieren (zu konzeptualisieren), ist ein Schritt auf dem Weg zur Professionalisierung. Studierende können so ein Gespür dafür entwickeln, dass Gebäude und deren Ausstattung, die ja immer durch Menschen geprägt sind und belebt werden, ‚sprechen‘. Deren Sprache wahrzunehmen und zu deuten, unterstützt die sogenannte „Selbstkompetenz“2 und hilft, eine Wahrnehmungskompetenz zu erwerben, die für eine vor allem später notwendige Gestaltungskompetenz, z.B. des eigenen Klassenraums, einer Stellwand für Projektergebnisse, eines Einladungsplakats für einen Schulgottesdienst etc. notwendig wird. Diese Art der Wahrnehmung des Schulraums auch in Bezug auf den Religionsunterricht spielt neben der Beobachtung der Interaktion im Klassen- und Lehrerzimmer bei Praktika eine wichtige Rolle und ist gänzlich anders als die übliche Zusammenstellung von meist aus der Internetpräsentation übernommenen Informationen zur Situation der Schule.3
Das Vorgehen bei der unvoreingenommenen Betrachtung, der Beschreibung und Interpretation ähnelt dem eines Forschers, der sich in einer fremden Kultur befindet und versucht, sich den Sitten und Gebräuchen beschreibend anzunähern und die eigene Wahrnehmung zu deuten. Deshalb kann die Methode des amerikanischen Ethnologen Clifford Geertz zur „Dichten Beschreibung“ die erste Wahrnehmung der Praktikumsschule und deren Reflexion unterstützen, auch wenn es in diesem Kontext nicht auf die exakte Einhaltung der Methode ankommt.
Geertz nähert sich Kulturen an, indem er sie als Systeme symbolischer Formen auffasst. Diese vermitteln entscheidende Informationen über den Zusammenhang, wie sie sich dem Zuschauer darbieten. Das Verstehen folgt dabei einer spezifischen Denkbewegung, einem beständigen Pendeln zwischen lokalspezifischen Details und umfassenden Strukturen,4 die allgemeine Beobachtungen und detaillierte Kommentare ermöglichen. Auch (Schul-)Kultur präsentiert sich als öffentlich lesbares Dokument anhand von Symbolen wie Gebäuden, Ausstattungen, gestalteten Produkten, aber auch Bemalung, Graffiti, Müll, Verschmutzung u.Ä. Daran wird viel über ein explizites und auch ein implizites Programm der Schule deutlich.
Die Besonderheit der Dichten Beschreibung ist, dass sie „mikroskopisch ansetzt, d.h. sich auf einzelne, vergleichsweise überschaubare Phänomene konzentriert.“5 Dabei versucht Geertz diejenigen Elemente einer Kultur zu berücksichtigen, die grundlegende Erfahrungs- und Orientierungsweisen zum Ausdruck bringen. „Ausgangspunkt und erster Schritt einer Dichten Beschreibung ist eine knappe Schilderung des Geschehens, wie es sich den Beobachtern der betreffenden Abläufe unmittelbar bietet.“6 Interessant ist in der Übernahme dieser ethnologischen Methode, dass der Beobachter versuchen soll, sich als Fremder dem Vertrauten zu nähern. Es ist „dieser Effekt des ‚fremden Blicks‘ auf das Vertraute, der uns an dieser Methode interessiert.“7 Dies wird dann in einem zweiten Schritt gedeutet und verbunden. Sinnzuschreibung findet erst auf der Ebene des interpretierenden Zusammenführens statt,8 wobei ein enger Zusammenhang zwischen ‚objektiven Tatbeständen‘ und dem subjektiven Erleben bzw. der Bewertung deutlich wird.
Analysiert man die oben abgedruckte exemplarische Beschreibung, kann man eine Liste der berücksichtigten Aspekte erstellen und diesen jeweils beschreibende und bewertende Adjektive zuordnen. Dabei kann herausgearbeitet werden, dass „sich objektive Realität und subjektives Erleben in einem kongruenten Verhältnis manifestiert (…). Solche Gesetzmäßigkeiten in der Gestalt liefern zur ersten Beobachtung einer Schule mit der Methode der Dichten Beschreibung Anknüpfungspunkte für weitere Forschungen im Bereich ‚Schulklima und Lernerfolg‘ etc.“9
Anregungen zur Weiterarbeit
1.Erstellen Sie eine Dichte Beschreibung Ihrer Praxissemesterschule. Berücksichtigen Sie die aus der Analyse gewonnenen Aspekte und listen Sie diese in einer Checkliste auf.
2.Erkunden Sie das spezifische Profil der Schule in Sachen ‚Religion‘ und notieren Sie die für Ihre künftige Tätigkeit wichtigsten Informationen:
•Religionsbrett, Einladungen zu Andachten, Gottesdiensten, religiöse Tagungen, Veranstaltungen
•Religionsraum, technische Ausstattung, spirituell bedeutsame Gegenstände (Kerzen, Symbole, Kreuz, Blumen etc.)
•Lehrerbibliothek, Bereich Religion (Handbücher, religionspädagogische Literatur, Aktualität)
•Religionspädagogische Materialien, z.B. Notfallseelsorgekoffer, Modelle, Medien
•Fachkollegen/Fachkolleginnen (Personal, Zuständigkeiten für Studierende, Aufgeschlossenheit für Hospitationen, Stundenpläne der Fachkollegen, Fachkonferenz und Termine)
•Schulprogramm zum RU, Religion außerunterrichtlich
•Schul- bzw. Fachcurriculum RU
•Absprachen in der Fachkonferenz, ökumenische Zusammenarbeit, Gewohnheiten, eingeführte Methoden, Zusammenarbeit mit islamischem RU, Kontakte zu Kirchengemeinden
•Außerunterrichtliche religiöse Veranstaltungen/Situationen/Organisationsformen
•Allgemeine Haltung im Kollegium zu Religion/RU/Lehrkräften
•Erwartungen der Schule an eine Religionslehrperson
3.Was zuerst dran ist – Sammeln Sie wichtige Informationen für den Schulalltag
•Wo kann ich sitzen, habe ich ein Fach?
•Wo kann ich in Ruhe arbeiten?
•Wer ist für was mein/e Ansprechpartner/in?
•(Wo) bekomme ich einen Schlüssel?
•Wo ist der Dienstplan/Vertretungsplan?
•Was muss ich über die Schulordnung wissen?
•Welche Vereinbarungen der Schule sind wichtig?
•Gibt es einen Beschluss- oder Konferenzordner?
•Wo liegt das Mitteilungsbuch?
•Welche Lehrmaterialien für meine Fächer hat die Schule?
•Wie bediene ich den Kopierer, brauche ich eine Karte?
•Welche technischen Geräte kann ich nutzen? Wo bekomme ich eine Gebrauchsanleitung?
•Was sind meine Aufgaben für die ersten Wochen?
Literatur zur Weiterarbeit
Büttner, Gerhard/Pütz, Tanja, „Dichte Beschreibung“ als methodische Möglichkeit bei der Erstellung von Praktikumsberichten. Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (2007), Heft 3, 56- 64
Geertz, Clifford, „Aus der Perspektive des Eingeborenen“. Zum Problem des ethnologischen Verstehens. In: Geertz, Clifford (Hg.), Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt a.M. 1983, 289–309
Wolff, Stephan, Clifford Geertz. In: Flick, Uwe/von Kardorff, Ernst/Steinke, Ines (Hg.), Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek, 3. Auflage 2004, 84–96
1Baumann/Sunier, 2002, 24f.
2Der Begriff wurde von dem Erziehungswissenschaftler Heinrich Roth 1971 geprägt und bezieht sich – gemeinsam mit Sachkompetenz und Sozialkompetenz – auf grundlegende menschliche Fähigkeiten, die Mündigkeit als emanzipatorisches Ziel überhaupt erst ermöglichen. Selbstkompetenz (selfcompetence) ist danach die „Fähigkeit, für sich selbstverantwortlich handeln zu können“. Roth, 1971, 180.
3Büttner/Pütz, 2007.
4Vgl. Geertz, 1983, 307f.
5Vgl. Wolff, 2004, 89.
6Wolff, 2004, 89.
7Büttner/Pütz, 2007, 58.
8Wolff, 2004, 91.
9Büttner/Pütz, 2007, 63f. Die Autoren verweisen hier auf Varbelow, 2003.