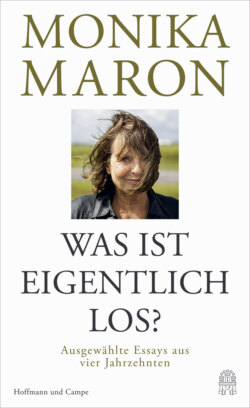Читать книгу Was ist eigentlich los? - Monika Maron - Страница 10
Liebster Heinrich!
ОглавлениеEs bedeutet mir nichts, Gräber berühmter Verstorbener zu besuchen, ich komme ihnen nicht näher, indem ich mich nahe ihren Knochen oder ihrer Asche aufhalte. Trotzdem ging ich kürzlich auf den Friedhof von Montmartre in die Avenue Berlioz, wo das »freisinnige Wien« im Jahre 1902 ein Grabmal errichten ließ für Heinrich Heine und Frau Heine, eine weiße Büste, die Heine mit geneigtem Kopf und gesenkten Lidern auf nichts mehr schauen lässt als auf das eigne Grab. Darauf hatte die Stadt Düsseldorf ihr ehrendes Gedenken in Form eines inzwischen angewelkten Kranzes abgelegt. Auch andere Besucher hatten Zeichen ihrer Anwesenheit hinterlassen: Forsythien, Anemonen, einige kleine Steine auf der hinteren Ecke des Grabsteins.
Ich hatte, nicht ohne Scham über die Sentimentalität solcher Geste, eine rote Rose mitgebracht. Es war ein Augenblick, der in meine Jugend gehörte, und da er damals verhindert war, holte ich ihn nun nach. Ich war sechzehn oder siebzehn, als ich mich in Heine verliebte, schwärmerisch und ernsthaft, wie andere sich in Filmstars verliebten. Ich schrieb ihm sogar einige Briefe. Seine Gedichte nahm ich an als für mich geschrieben, nicht an mich, sondern für mich, statt meiner, und ich lernte sie wie meine eigene Sprache.
Ich war schon fünfundvierzig Jahre alt, als mir das fast unentwirrbare Gefühlsgestrüpp, in dem ich mich sechzehnjährig scheinbar sicher zurechtgefunden hatte, bewusst wurde. In meinem Roman Die Überläuferin gebrauchte ich ein Zitat aus einem meiner liebsten Heine-Gedichte, Der Asra:
Täglich ging die wunderschöne
Sultanstochter auf und nieder
Um die Abendzeit am Springbrunn,
Wo die weißen Wasser plätschern.
Täglich stand der junge Sklave
Um die Abendzeit am Springbrunn,
Wo die weißen Wasser plätschern;
Täglich ward er bleich und bleicher.
Eines Abends trat die Fürstin
Auf ihn zu mit raschen Worten:
Deinen Namen will ich wissen,
deine Heimat, deine Sippschaft!
Und der Sklave sprach: Ich heiße
Mohamet, ich bin aus Yemmen,
Und mein Stamm sind jene Asra,
Welche sterben, wenn sie lieben.
Und plötzlich, nach fast dreißig Jahren, fiel mir auf, dass ich in Heines Gedichten immer als Mann, niemals als Frau gelebt hatte. Der stolze Gestus freiheitlicher Liebe gehörte den Männern, der Sklave hatte ihn, die Sultanstochter nicht, also war ich der Sklave. Es hat mich damals nicht gekümmert, weil ich offenbar den Unterschied zwischen dem Liebenden und dem Geliebten entscheidender fand als den zwischen Mann und Frau.
Meinen idealen Entwurf von mir stattete ich mit schmaler, schmuckloser, eher männlicher Kleidung aus, ohne dass ich ein Mann sein wollte. Aber meine jugendliche Neigung zum Heroischen fand in der Literatur – nicht nur bei Heine – keine weibliche Gestalt; eine Ausnahme ist Jeanne d’Arc, und die trug als Heldin Männerkleider.
In den Mann Heine war ich ganz und gar als Mädchen verliebt, mein Menschenbild und mein Frauenbild ließen sich auf dem Umweg über die männliche Pose miteinander verbinden.
Rückblickend frage ich mich, ob ich nicht, ganz nebenbei und ohne mir dessen bewusst zu sein, außer dem libertären Anspruch einen Hauch von Frauenverachtung gelernt habe, was Selbstverachtung bedeutete.
Blamier mich nicht, mein schönes Kind, und grüß mich nicht unter den Linden. / Wenn wir nachher zu Hause sind, / wird sich schon alles finden, – ein Vers, der sich eher gegen mich richtet, als dass er für mich spricht; ich erinnere mich nicht, es damals so empfunden zu haben.
Geblieben ist die Gewissheit, dass die Poeten der Liebe die Liebenden sind, nicht die Geliebten, unabhängig davon, ob sie Männer sind oder Frauen.
1988/89