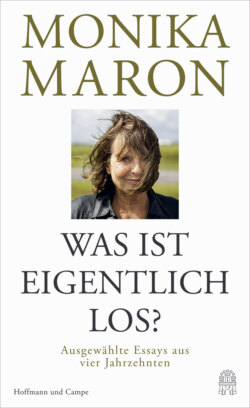Читать книгу Was ist eigentlich los? - Monika Maron - Страница 4
II
ОглавлениеDie Umstände schriftstellerischer Intellektualität haben sich seit den Tagen Heinrich Heines geändert. Medial beispielsweise. So waren die Gebildeten, die ohne politischen Auftrag ihre Stimme geltend machen, seit jeher an Journale und an die Tagespresse gebunden. Heine spricht von »wilden, in Druckpapier gewickelten Sonnenstrahlen«, als er auf Helgoland von der Pariser Julirevolution erfährt. Was Intellektuelle sagen, steht seitdem in der Zeitung. Und selbst die späte, an ihrer Zeitungslektüre fast verzweifelnde Monika Maron kommt nicht darum herum, dieses Missvergnügen in Form eines Essays mitzuteilen, der in einer Zeitung abgedruckt wird.
Seit den sechziger Jahren jedoch und bis in die jüngste Gegenwart hinein wurde das Fernsehen für die Bildung einer massendemokratischen Öffentlichkeit viel entscheidender. Die Wiedervereinigung etwa war ein Ereignis, das sich über Sendungen mitteilte: Sendungen von Demonstrationen, Berichte über besetzte Botschaften und Pressekonferenzen. Man denke nur an Günter Schabowskis zögerndes »unverzüglich« und seine gewaltigen, grenzöffnenden Folgen.
Heute wiederum sind längst die digitalen Stürme und Wellen hinzugekommen, die das Profil von Stimmen einzelner Personen und also auch das von Intellektuellen schwächen. Es gibt inzwischen sehr viele Urteile, an denen nicht gearbeitet worden ist, sondern die der Subjektivität momentaner Mitteilungsbedürfnisse entspringen und zugleich anonym mitgeteilt werden. Manche halten diesen Trend zu unredigierten Texten, die selbst nur als Teil von größeren Textmengen Wirkung entfalten, für einen demokratischen Fortschritt. Endlich können alle publizieren. Doch selbst wenn das unter manchen Gesichtspunkten auch ein Rückschritt sein sollte, ist es einer, mit dem wir alle und mithin auch die Intellektuellen leben müssen.
Die Stimme der Intellektuellen wirkte sich außerdem früh in einem Meinungskampf um Mehrheiten aus. Der französische Streit um die angebliche Schuld des Hauptmann Dreyfus, die Geburtsstunde der Figur der Intellektuellen, war insofern bezeichnend. Es war ein Kampf darum, die Öffentlichkeit auf eine Seite zu ziehen und dadurch die Politik zu verpflichten. Intellektuelle sind insofern selbst dort der Idee demokratischer Verfahren verpflichtet, wo sie solche Verfahren nicht verwirklicht vorfinden, sondern nur an sie appellieren können. Wenn es auf ihren Beitrag ankommt, dann nur im Licht öffentlicher Debatten, die etwas bewirken. Dass Monika Maron in einem ihrer jüngeren Texte sogar ausbreitet, welche Parteien für sie noch wählbar sind, und dann dabei landet, am liebsten in Österreich wählen zu wollen, unterstreicht den Sprung, der heute zwischen Intellektualität und politischer Parteinahme liegt.
Eine letzte Bedingung der Intellektuellenrolle im Beruf der Literatur selbst. Als Heinrich Heine schrieb, gab es für Einwirkungen auf die lesende Öffentlichkeit noch kaum andere Kandidaten als Schriftsteller. Als Émile Zola seine Anklage gegen die Verfolger von Dreyfus formulierte, waren die Fächer der politischen Wissenschaft, der Soziologie oder gar der Vorurteilsforschung längst noch nicht institutionalisiert. Auch Staatsrechtler hätten sich damals nicht leicht hervorgewagt. Heute hingegen würde man wohl nicht als Erstes einen Romancier anrufen, um ein Urteil über einen Justizskandal zu bekommen. In dieser Situation steht die schriftstellerische Intellektualität stets in der Gefahr, nur gut formulierten Small Talk anbieten zu können, weil sie sich weder forschend noch professionell zu ihrem politischen Gegenstand verhält. Das bloße Meinen kommt deshalb nicht oder nur unehrlich um die Frage herum, wie für seine Meinungen denn auch Mehrheiten gewonnen werden können.
Was bleibt also für die Intellektuellen? Die Besonderheit vieler Interventionen von Monika Maron liegt darin, dass sie sich dieses Ungleichgewichts zwischen ihrer Stimme und der Masse der Meinungen bewusst ist. Sie verzichtet in ihren Texten nie auf das »Ich«, weil sie der Schlüsselgewalt persönlicher Erfahrung vertraut, auf den Bericht aus dem Alltag, auf die Anekdote. Die ernst genommene Erfahrung der Literatur hat hier intellektuelle Folgen, die denen der wissenschaftlichen Expertise im öffentlichen Diskurs ähneln. Dort werden, wenn es gut geht, Argumente auf ihre Darstellbarkeit geprüft. Literatur prüft Individualität auf Darstellbarkeit. Dass wir die im frühen neunzehnten Jahrhundert aufgeschriebene Geschichte über das Schicksal eines Pferdehändlers im sechzehnten Jahrhundert auch im einundzwanzigsten Jahrhundert nicht nur historisch verstehen, hat darum Konsequenzen für die Gegenwart. Monika Maron spricht von »intuitiver Erkenntnis« als ihrem literarischen Antrieb. Das gilt auch für ihre Aufforderungen, ernsthaft öffentlich zu streiten.
Verstehen und streiten heißt dabei, eines nicht zu akzeptieren: die Verachtung des Verstehens und des Streitens selbst, den unzugänglichen Dogmatismus einer ganz handgreiflichen Polemik gegen die Prämissen der Verständigung. Es ist lautstark und kurz angebunden über Monika Marons Kritik der fundamentalistischen Zurückweisungen solcher Prämissen geurteilt worden. Islamophob wurde sie gescholten, als handele es sich um eine Krankheit, die gleichwohl selbstverschuldet sei, und als gelte ihre Kritik den Muslimen als solchen und nicht denjenigen, die ihre Religion politisch in Stellung gegen Prinzipien wie die Gleichheit der Geschlechter, die Freiheit der Partnerwahl oder den religionsneutralen Gerichtssaal in Stellung bringen. Panikmache wurde ihr vorgeworfen, als existierten die am Ende von Verzicht auf Argumentation stehenden Gewalttaten – von Paris über Nizza und den Breitscheidplatz bis nach Hamburg-Barmbeck und Conflans-Saint-Honorine –, gar nicht oder als gingen sie nur aus schwierigen sozialen Lagen hervor, nicht auch aus religiösen Gesinnungen.
Maron fordert hier »die Solidarität der Aufgeklärten«, die Intoleranz gegen Intoleranz, den Primat der Freiheit gegenüber der Einfühlung in Kulturen. Sie verbindet diese Forderung mit ihren Erfahrungen aus der Zeit um 1989. Damals waren viele im Westen blind gegen die DDR als Diktatur, weil sie nach wie vor an irgendwelchen von 1968 hergebrachten Utopien hingen und dafür eine Leinwand brauchten. Die oben bezeichnete Unkenntnis kam passenderweise hinzu. Existierende Konflikte zur Projektionsfläche eigener, damit gar nicht zusammenhängender Absichten zu machen, geht Monika Maron besonders gegen den Strich. Was hat die Beurteilung der DDR mit verblassten Akademikerphantasien im Westen zu tun, was die Diskussion über den fundamentalistischen Teil des Islam mit dem Unbehagen westlicher Autoren an ihrer eigenen religiösen Existenz? Dass Maron dieses Gebot, von Projektionen Abstand zu nehmen, in jedem ihrer eigenen Texte auf gleiche Weise durchgehalten hat, ist unwahrscheinlich. Aber wir können nicht beides haben, den zugespitzten Streit und jene Empfindlichkeit, die von sich derart überzeugt ist, dass sie Dissens im Grunde für unzumutbar hält.