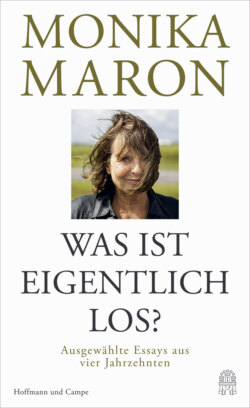Читать книгу Was ist eigentlich los? - Monika Maron - Страница 8
Aus der Straßenbahn, Alte Schönhauser Straße, Mitte, 1998
ОглавлениеEs ist Freitag, 18 Uhr, wir, das sind ein Historiker, eine Fotografin, ein Naturwissenschaftler und ich, sind die einzigen Gäste. Drei junge Kellner, alle nach 61 geboren, umwerben uns mit ungewohnter Aufmerksamkeit, preisen uns die exotischen Speisen und Getränke so lässig an, als hätte man sie im Säuglingsalter schon mit Kiwi-Mus gefüttert. Wir verzichten auf einen Kir Royal, der uns als eine Spezialität des Hauses offeriert wird, und bestellen trockenen Sherry, bis auf den Naturwissenschaftler, einen fanatischen Biertrinker, der seine Trinkgewohnheiten auch der angestrengten Noblesse des Etablissements nicht unterwerfen will.
Durch das braun getönte Fensterglas sehen wir über die Spree auf den Dom und den Palast der Republik, Domizil der gesetzgebenden Körperschaft der DDR, der Volkskammer. Dem Hotel gegenüber steht das neue Marx-Engels-Denkmal, umgeben von weiteren bildkünstlerischen Dokumenten des Klassenkampfes, über deren Dualität wir uns gerade streiten, als der Ober die Krabbensuppe serviert.
Hier oben, zwischen schwedischer Architektur, französischen Weinen und russischem Kaviar gerinnt, was mich angesichts der klinkenlosen Eisentür erschauern lässt, zur Groteske. Ein Stückchen Westen im Osten, der Eintritt ins Paradies kann erkauft werden, sofern man über harte Währung verfügt und bereit ist, ein beliebiges Nobelrestaurant als Paradies zu akzeptieren.
Das Palasthotel ist eins der beiden Valutahotels in der Hauptstadt. Demnächst kommt ein drittes hinzu, das Grand Hotel an der Friedrichstraße. Während die valutären Habenichtse aus dem eigenen Land und aus den Bruderländern es schwer haben, in Berlin ein Hotelzimmer zu finden, wird im Palasthotel – so sagt man – in den Wintermonaten ein ganzer Trakt geschlossen, weil die devisenzahlenden Gäste ausbleiben. Es gehört dann zu den Aufgaben des Personals, in den unbewohnten Zimmern morgens und abends das Licht an- und etwas später wieder auszuschalten, um so wenigstens im Straßenbild die Illusion eines weltstädtischen Fremdenverkehrs zu vermitteln. Einen Sinn ergibt das Ganze nur im Hinblick auf die Wortschöpfung: Devisenrentabilität.
Von den Kellnern des »Roti d’Or« erzählt man sich, dass sie den ganzen Tag über eine Wache für den Eingang abstellen, derweil die übrigen in einem Hinterraum Karten spielen. Ich frage den Ober, der uns gerade den Wein einschenkt, ob das der Wahrheit entspreche, und er antwortet mit einem reizenden Lächeln: »Nein.«
Die Gäste an diesem Abend sind unauffällig: Ehepaare, mehrere ältere Damen, die offenbar zu einer Reisegruppe gehören, einige Herren, die aussehen wie Geschäftsleute aus dem Nahen Osten. An dem Tisch hinter uns unterhalten sich vier Männer miteinander, von denen drei ein sächsisch eingefärbtes Englisch sprechen, der vierte hat eine etwas kehlige Aussprache. Wir nehmen an, dass es sich bei ihnen um »Markgäste« handelt, die, wie wir vom Kellner erfahren, hier angemeldet werden – durch wen, erfahren wir nicht – und in Mark der Deutschen Demokratischen Republik bezahlen dürfen.
Wir erkundigen uns, was geschähe, würden wir nach einem ausgiebigen Mahl bekennen, nur über des Landes eigene Währung zu verfügen. Der Ober lacht wie über einen Witz, und in seinen Augen erglimmt Misstrauen. Er wolle sich erkundigen, sagt er, schließlich gehe es ums Geld, was den Historiker zu der Frage veranlasst, ob wir überhaupt wüssten, dass dort, wo sich heute das Hotelfoyer befindet, früher einmal die Berliner Börse stand; und dass hinter dem Hotel, neben dem ehemaligen S-Bahnhof »Börse« – heute Marx-Engels-Platz – der Zirkus Busch sein festes Haus hatte, in dem sich im November 1918 die Berliner Arbeiter- und Soldatenräte versammelten. Übrigens hätte dann Ende Dezember 1918 der Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte in Berlin beschlossen, Wahlen zur Nationalversammlung abzuhalten und keine Sowjetrepublik zu errichten.
Inzwischen hat der Ober die gewünschte Auskunft eingeholt: Es sehe nicht gut aus für uns, man würde uns zum Direktor führen, der seinerseits die Polizei benachrichtigen müsse, denn es würde sich, für den Fall, dass wir wirklich …, um vorsätzlichen Betrug handeln.
Wir bestellen ein Heidelbeersorbet und bekommen es auch. Es schmeckt, wie das übrige Essen, vorzüglich.
Wir zahlen, zur offensichtlichen Erleichterung des Personals, in D-Mark. Der Fotografin und mir überreicht man, nach der Art des Hauses, je eine Rose.
Das Romantikerviertel – hier heißen die Straßen nach Tieck, Schlegel, Eichendorff – liegt in der Nähe des Oranienburger Tores, wo die Friedrichstraße in die Chausseestraße mündet. In der Novalisstraße findet man eine namenlose kleine Kneipe, von den Stammgästen »Jette« oder »Mehlwurm« genannt. »Jette« hieß die Kneipe früher einmal, nach ihrer ehemaligen Wirtin. Der Name »Mehlwurm« geht auf die gehässige Bemerkung eines trunkenen Gastes über das weißblonde Haar des jetzigen Wirts, Jettes Sohn, zurück. Ich selbst gehöre zur Mehlwurmfraktion. Hier kostet das Bier 58 Pfennig und eine Portion Pökelfleisch mit Sauerkraut und Brot um die drei Mark.