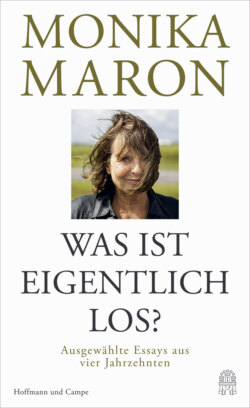Читать книгу Was ist eigentlich los? - Monika Maron - Страница 3
ОглавлениеVorwort
von Jürgen Kaube
I
Monika Marons Eingriffe begleiten uns seit mehr als dreißig Jahren. Wie viele im Westen Deutschlands las ich von der Schriftstellerin zum ersten Mal etwas im Juli 1987. Da hatte sie schon zwei Romane, darunter den berühmten Flugasche, und einen Erzählungsband veröffentlicht. Viel bekannter aber wurde sie damals durch ihren öffentlichen Briefwechsel mit dem Autor Joseph von Westphalen. Maron war sechsundvierzig Jahre alt und lebte seit 1951 in Ost-Berlin. Sie war die Stieftochter eines ehemaligen Innenministers der DDR, zunächst Journalistin von Beruf, von 1976 an dann freie Schriftstellerin, deren Werke im Osten aber nicht gedruckt wurden. Und nun tauschte sie Briefe mit einem westdeutschen Publizisten aus, die wöchentlich im Magazin der Zeit abgedruckt wurden. Das war schon als Vorgang ungewöhnlich. Am Ende des Briefwechsels hatte die DDR als Staat noch anderthalb Jahre, doch das wusste niemand.
Nach wenigen der Briefe war klar, wie viele Missverständnisse den deutsch-deutschen Gedankenaustausch erschwerten. Zumeist waren es einseitige Missverständnisse, sie beruhten auf Unkenntnis und auf zu umstandslosem Hinschreiben. Unvergesslich bleibt, wie Westphalen den Spruch »Schwerter zu Bierdosen!« aufnahm, eine damalige Persiflage auf das friedensbewegte »Schwerter zu Pflugscharen!«, um Monika Maron zu fragen, ob der »pfiffige« Aufruf womöglich aus der DDR stamme. Maron: In der DDR gebe es gar kein Dosenbier. Und kein Verwaltungsrecht, das einem im Umgang mit dem Staat womöglich nützlicher sei als Pfiffigkeit. Man dürfe sich beschweren, könne aber nicht klagen. Maron störten außerdem die Projektionen. In der DDR nenne niemand, den sie kenne, sein Freizeithäuschen »Datscha«, das sei ein Ausdruck von Westdeutschen. »Und waren Sie auch in Wohnungen?«, fragt sie noch 2019 diejenigen, die ihr Urteil über die DDR in Gaststätten und bei Stadtrundgängen bildeten. Mehr aber noch als über Ahnungslosigkeiten war Maron früh darüber verärgert, wie schematisch das Verhältnis gedeutet wurde: »Warum können Sie es eigentlich nicht lassen, jeden Unterschied zwischen Ihnen und mir zum Unterschied zwischen Ost und West zu erklären!«
Dieser reizbare Überdruss an undurchdachtem Reden, Fühlen und Verhalten findet sich auch in vielen der hier versammelten Stücke von Monika Maron dokumentiert. Die Adresse ihrer Wortmeldungen ist nicht, wie bei manchen Intellektuellen, in erster Linie die Politik. Sie reflektiert zumeist nicht oder protestiert gar gegen staatliche, juristische oder wirtschaftliche Entscheidungen. Der Gestus des »Ich verstehe zwar wenig davon, aber ich sage trotzdem mal etwas sehr Entschiedenes dazu«, den manche intellektuelle Einlassungen zur Gegenwart pflegen, ist ihr fremd. Kaum ein Aufsatz aus ihrer Hand, in dem die Mitteilungen über gesellschaftliche Vorkommnisse nicht durch die erläuternde Mitteilung privater Erfahrungen unterstützt würden. Wäre es nicht paradox, so könnte man sagen, der Gegenstand wie die Adresse ihrer Schriften sind deutsche Mentalitäten. Aber es ist paradox, denn Mentalitäten haben gar keine Adresse. »An alle, die es angeht«, lautet ihr Motto.
Im Jahr 1992 wendet sich Monika Maron beispielsweise gegen den Glauben vieler ihrer ostdeutschen Landsleute, die Wiedervereinigung habe ihnen die Würde genommen. So viel Würde sei aber, so sagt sie, zuvor gar nicht dagewesen, wie jetzt angeblich abhandengekommen sein sollte. Tatsächlich vermissten viele nur die Gleichheit und rechneten in ihre Ungleichheitsbilanz weder die eigene Treuherzigkeit bei Wahlen ein, noch die geringen Mieten im Osten oder die Lage anderer postkommunistischer Länder wie Polen, Ungarn, Russland. Unerwachsene Haltungen also regen Maron auf, die sich verbreitende Bereitschaft etwa, Opferrollen einzunehmen und betroffen Klage darüber zu führen, wenn Erwartetes nicht eintritt, der »dauerpubertäre« ziellos trotzige Protest mittels Beleidigtsein. Sie hat diese Einstellungen, die sich heute überall finden, früh an ostdeutschen Reaktionen nach der Wende registriert.
Ihnen stellt sie, der Erfahrung von 1989 entnommen, entgegen, »woran es diesem Land bis zur Psychose mangelt: die Lust zu leben«. Woran es diesem Land mangelt. Nicht »den Ostdeutschen«, auch wenn es an jener Stelle um sie ging. Dass uns die Lust zu leben fehlt, ist ein sehr hartes Urteil, aber ist es abzuweisen? Gut siebzig Jahre zuvor hatte der französische Intellektuelle Jacques Rivière in seinem Buch L’Allemande ein ähnliches Urteil über die Deutschen gefällt, wie er sie in vierjähriger Kriegsgefangenschaft von 1914 bis 1918 erlebt hatte. Die Deutschen, hieß es dort, führten alles, was man ihnen vorgebe, mit großer Akribie und Sachlichkeit aus, »fromm und stark«, aber sie wüssten selbst nicht, was sie wollten. Es fehle ihnen die Leidenschaft, ein Gefühl dafür, wofür sie sich auf jeden Fall entscheiden und dafür, was sie auf keinen Fall tun würden.
Zu solcher Indifferenz hat Marons Biographie das »antifaschistische Kind«, das sie war, nicht disponiert. Wer Geschichte im Sinne des Durchlebthabens von dramatischen Umbrüchen wesentlich nur aus dem Schulunterricht, dem Studium und den Medien kennt, der hat in bestimmter Weise Glück gehabt. Viele Umbrüche sind keine guten und niemandem zu wünschen. In anderer Hinsicht verschiebt sich dadurch aber die Gelegenheit zur Willensbildung und zum Selbstbewusstsein davon, was es heißt, unter extremen Umständen nicht den Verstand zu verlieren. Gar keine Umbrüche verführt zum Verdämmern des Freiheitsgefühls. Monika Marons jüdisch-polnischer-sozialistisch-bürgerlicher-ost-westdeutscher Lebenslauf ist darum sehr eindrücklich. In ihren Essays wie in ihren Romanen zeichnet sie nach, wie Geschichte in Familien und Paarbeziehungen nicht nur vorkommt, sondern auf sie durchschlägt, weil sie dort zu Handlungen aufruft. Fast niemand ist Innenminister der DDR, aber alle müssen ihre private Geschichte mit der des Weltlaufs auf irgendeine Art verbinden. Marons Stück über Lebensentwürfe und Zeitenbrüche in diesem Band ist der Entwurf eines ganzen Forschungsbereichs über Biographien.
Sobald es zu Umbrüchen kommt, kann sich ihnen niemand entziehen, ohne durch den Entzug Schaden zu nehmen. Die Geschichte der zwei Brüder, die Maron im Jahr 1995 erzählt hat und die sich wie die Essenz eines ganzen Romans liest, ist ein Sinnbild dafür. Denn auch die Indifferenz gegen Geschichte, das bloße Sicheinrichten oder das Streben nach unbeschadetem Durchkommen, hat Kosten und wird von ihnen oft eingeholt. Was privat die verbreitete Wahl ist, das Ausweichen und die Versuche, sich stumm zu arrangieren, lässt gesellschaftlich ein Land hinter seinen Möglichkeiten zurück. Hier liegt die intellektuelle Aufgabe, die Monika Maron in vielen ihrer Texte sich stellt: zum Bewusstsein solcher besseren, wenngleich nicht ohne Verzichte ergreifbaren Möglichkeiten aufzurufen.
Im Jahr des Mauerfalls schreibt sie so, »das Volk in der DDR« sollte niemandem gestatten, sich dieses Augenblicks zu bemächtigen, weder Kalten Kriegern noch denen, die nun mehr oder weniger verdruckst über das Ende der sozialistischen Utopie klagten. Weder das Bewusstsein der Schande des jahrzehntelang gebeugten Rückens noch das Gefühl, ihn jetzt endlich gestreckt zu haben, sollten vergessen werden. Im Osten Deutschlands, heißt es Jahre später in derselben Richtung, sei das demokratische System installiert worden, aber der demokratische Geist lasse sich nicht installieren. Denn der demokratische Geist, so darf man das zusammenziehen, ist genau jener, dem erinnerlich und gegenwärtig bleibt, wogegen er erkämpft wurde.