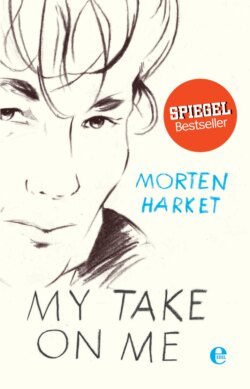Читать книгу My Take on Me - Morten Harket - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4 Schuljahre
ОглавлениеIm Alter von acht bis dreizehn Jahren wurde ich in der Schule gemobbt. Das war eine schwere Zeit in meinem Leben, die ich ganz allein meistern musste. Ich war nicht in der Lage, dem, was mir da passierte, ein Ende zu bereiten. Klassenkameraden mischten sich nicht ein, und die Lehrer sahen entweder weg oder waren zu schwach um einzugreifen.
Das Mobbing hatte verschiedene Ausprägungen. Ich wurde tätlich angegriffen: getreten, in den Bauch geboxt, geohrfeigt und geschlagen. Manchmal sah ich es kommen: Eine ganze Gruppe von ihnen lauerte mir bisweilen auf, wenn die Schule aus war. Andere Male kamen die Angriffe überraschend; ich ging nichtsahnend meiner Wege, als – Peng! – ein Schlag aus dem Nichts mich fast umhaute.
In gewisser Weise waren diese Attacken leichter zu ertragen. Viel perfider war das psychologische Mobbing. Das setzt sich wirklich in deinem Kopf fest und macht dich fertig. Jedes Mal, wenn ich etwas sagte, lachten einige in der Klasse mich aus. Und sie spielten mit mir: Wegen meines Zeichentalents wollten meine Peiniger manchmal, dass ich etwas für sie malte. Weil ich akzeptiert werden wollte, rannte ich nach Hause und machte die Zeichnung für sie. Aber sobald sie das, was sie wollten, bekommen hatten, verspotteten sie mich, und alles fing wieder von vorne an.
Für ein Kind ist das eine sehr schwierige Situation. Du siehst, dass auch andere ausgegrenzt werden, und am schlauesten wäre es sicher gewesen, sich mit ihnen zusammenzutun, Sicherheit in der Gruppe zu suchen. Aber als Kind denkst du nicht so strategisch. Du willst instinktiv nichts mit den anderen Schwachen zu tun haben, und hoffst, dass dich dann alle mögen. Doch so läuft das nicht, und am Ende bleibst du allein.
Das schlimmste am Psycho-Mobbing ist, dass man irgendwann denkt, die Mobber haben Recht. Ein Teil von mir konnte nicht leiden, wie ich aussah, wie ich redete, hasste mein Unvermögen, mich so ausdrücken zu können, wie ich es wollte. Der Wunsch, gemocht zu werden, dazuzugehören ist so groß, dass es schwer ist, nicht von solchen Gedanken vereinnahmt zu werden. Für Anerkennung war ich bereit, mich teilweise zu verleugnen. Gleichzeitig war mir bewusst, was ich tat – ich sah mich als unterwürfigen Hund, der unauffällig sein und gefallen will. Dass ich nicht völlig einknickte, lag an einem gewissen Grundvertrauen in mich selbst, was ich aber erst später erkannte.
Warum wurde ich zum Mobbing-Opfer? Teil des Problems war, dass mich die Schule nicht sonderlich interessierte. Die Lehrer versuchten vergeblich, mich zu motivieren, aktiv am Unterricht teilzunehmen. Ich hatte ein großes Lernpotenzial – wie mein Interesse an der Natur bewies –, aber meine Lehrer schafften es nie, dieses Potenzial zu erschließen. Im Unterricht war ich nur physisch anwesend. Weil ich nicht schwer von Begriff war, kam ich immer irgendwie durch, aber interessiert habe ich mich für den Lehrstoff nie. Ich war da und gleichzeitig weit weg: in meinem Kopf, in meiner eigenen Welt.
Eine Mischung aus Unschuld und Verträumtheit machte mich zum leichten Opfer für Schulhoftyrannen. Dass mein Vater Arzt war, half wahrscheinlich auch nicht gerade: Viele meiner Mitschüler kamen aus sozial schwächeren Familien. Ich war also anders, fiel auf – das ideale Opfer. Ich konnte nichts dagegen tun, so sehr ich auch wollte, dass es aufhört.
Einer der Jungs war der Anführer. Ein richtiger Widerling. Dabei war er noch nicht mal besonders stark und griff mich selten selbst an – höchstens mal bei einem Überraschungsangriff, auf den ich mich nicht einstellen konnte. Stattdessen ließ er die anderen zuschlagen, die ihn damit beeindrucken wollten. Komischerweise war der größte und kräftigste Junge unter ihnen gar nicht so übel. Er konnte mich als einziger in einem fairen Kampf besiegen. Ich erkannte, dass er eigentlich ganz in Ordnung war, aber die Atmosphäre war vergiftet, und der Junge wollte eben auch dem Anführer gefallen.
Mir ging es zwar nie so, aber ich kann verstehen, warum Kinder in einer solchen Situation an Selbstmord denken. Gemobbt zu werden ist eine einsame Erfahrung. Man sieht kein Licht am Ende des Tunnels. Meinen Geschwistern vertraute ich mich nicht an, weil sie das Gefühl nicht kannten und mir also weder helfen noch mich verstehen konnten. Du befindest dich in einem Teufelskreis: Du wirst gemobbt, weil du in deiner eigenen kleinen Welt lebst. Aber das Mobbing führt dazu, dass du dich immer weiter zurückziehst, was dich noch mehr zur Zielscheibe macht, weshalb du dich noch mehr zurückziehst. Und immer so weiter.
*
Fast genauso schockierend wie das Mobbing selbst war die Reaktion meiner Lehrer. Sie wussten, was vor sich ging, griffen aber nicht ein. Einige meinten wohl, das müssten wir Kinder unter uns ausmachen, andere sahen es als gesunden Reifungsprozess an – eine Art Abhärtung, die dem betroffenen Kind letztendlich gut tun würde. Und einige Lehrer hatten schlicht Angst, sich einzumischen. Nur ein einziger Lehrer versuchte tatsächlich, mir zu helfen, aber er wurde dafür von den anderen Schülern so stark angefeindet, dass er am Ende aufgab. Mit dem Resultat, dass sie ihn nicht länger respektierten: Sie hatten keine Angst vor seinem Zorn, weil er keinen zeigte – um des lieben Friedens willen gab er klein bei. Die Tyrannen konnten auf dem Schulhof also hemmungslos weiter ihr Unwesen treiben.
Damals wurde mir bewusst, wie sehr sich das Verhalten vieler Menschen von dem meiner Eltern unterschied. Für ein Kind sind die Eltern die ersten Vorbilder; diejenigen, zu denen man aufblickt und die man nachahmt. Meine Eltern waren extrem fürsorglich und hilfsbereit – nicht nur ihren eigenen Kindern, sondern auch anderen gegenüber. Sie führten ein offenes Haus: Jeder von uns durfte nach Hause einladen, wen er wollte. Und sie erwarteten von uns dieselbe Offenheit. Deshalb wunderte ich mich über die Haltung der Lehrer an meiner Schule. Jemandem bewusst Hilfe zu verweigern widersprach allem, was meine Eltern mich gelehrt hatten. Das war eine Art Weckruf für mich: Ich erkannte, dass es in der Welt nicht immer so zuging wie bei uns zu Hause und dass der Respekt, den meine Eltern anderen gegenüber zeigten, nicht selbstverständlich war. Zu sehen, wie meine Eltern sich verhielten, war mir eine große Hilfe – es zeigte mir, dass es auch anders ging, und gab mir Kraft, nach vorne zu schauen. Sie lehrten mich, jeden Menschen zu respektieren, egal, wo er herkommt oder in welchen Umständen er lebt. Deshalb war ich auch später bei a-ha nie besonders beeindruckt von dem ganzen Starrummel. Ich wusste, was im Leben wirklich wichtig ist, und das ließ mich auf dem Teppich bleiben.
Rückblickend glaube ich, dass die Mobbing-Erfahrung mir dabei half, mit dem Erfolg von a-ha umzugehen. Dass ich das Ganze überlebt hatte, gab mir eine innere Festigkeit und Selbstvertrauen. Ich ließ mich nicht fertigmachen, sondern dachte nur: Ich bin stärker als ihr alle, auch wenn ihr in der Überzahl seid. Warum ich so dachte, hätte ich nicht sagen können, aber ich war einfach überzeugt davon, dass ich unter dem Druck nicht zusammenbrechen würde. Ich schlug nicht zurück, sondern hielt es einfach aus. Tatsächlich habe ich, glaube ich, nie jemanden geschlagen, bis ich einmal in den späten Achtzigern einen Fotografen verprügelte. Aber davon später mehr.
Diese Erfahrung gab mir auch einen ersten Einblick in das Verhalten von Gruppen. Viele der Kinder, die beim Mobbing mitmachten, waren keine schlechten Menschen. Sie hatten teilweise Angst und wollten selbst nicht zum Außenseiter werden. Also machten sie mit, und in diesem Moment änderte sich ihre Haltung. Ich erinnere mich noch daran, wie sich die Energie wandelte, die Stimmung plötzlich umschlug, sobald diese Individuen zu einem Mob wurden. Ich hatte es dann nicht länger mit einzelnen Personen zu tun, sondern mit einer Menge. Und die hat ihre eigene Dynamik und Verhaltensweise.
Ich habe mehr Menschenmengen studiert als die meisten Leute je zu Gesicht bekommen und habe einen Heidenrespekt vor den Kräften, die da wirken. Die Massen, vor denen ich zum Beispiel in Südamerika spielte, waren erstaunlich: Zehn- oder Hunderttausende von Menschen, die sich wie ein Organismus bewegen, sind ein wirklich inspirierendes Schauspiel. Bei einem Gig bat ich die Menschen ganz vorne einmal, aus Sicherheitsgründen etwas nach hinten zu rücken, und die Menge wich wellenförmig vor mir zurück. Man muss das gesehen haben, um zu verstehen, welche Kräfte dabei frei werden.
Die Macht der Massen kann etwas Wunderbares sein. Aber sie kann auch zur Bedrohung werden. Ich habe oft genug erlebt, dass Fangruppen im Kollektiv ihre Hemmungen verlieren: Es gibt nichts Gefährlicheres als eine Meute von hysterischen Teenagern, sowohl für dich als auch für sie selbst. Menschenmengen sind eine Urgewalt ohne moralischen Kompass. Jedes Geschichtsbuch enthält Beispiele für Massen, die sich fortreißen ließen, von guten Menschen, die Teil schlimmer Taten wurden. Das Mobbing an meiner Schule war nur ein kleines Beispiel für diesen Aspekt menschlichen Verhaltens. Ich gewann dadurch Erkenntnisse, die mir später zugutekamen.
Als a-ha prominent wurde, erkannte ich ziemlich schnell, wie viele Gemeinsamkeiten „berühmt sein“ und „gemobbt werden“ haben. Und ich konnte auf meine Erfahrungen mit Letzterem zurückgreifen, um mit Ersterem fertig zu werden. In beiden Fällen ist man ein Außenseiter, isoliert von der Gemeinschaft, zu der man gehört. Die Gründe sind vielleicht unterschiedlich, aber die Resultate sind gleich. Ich würde sagen, dass nichts mich so sehr auf den Ruhm mit a-ha vorbereitet hat wie die Jahre, in denen ich gemobbt wurde.
*
An der weiterführenden Schule ließ das Mobbing deutlich nach. Es gab dort zwar viele Mitschüler aus der Grundschule, die mich gemobbt hatten, aber andere Dinge wie zum Beispiel die Pubertät nahmen ihre Aufmerksamkeit nun mehr in Anspruch. Ich stand immer noch etwas abseits, aber das schien sie nicht mehr zu stören. Ich war dieser etwas seltsame Junge, der Blumen und Schmetterlinge liebte. Mädchen gegenüber war ich schüchtern, ich wusste nicht wirklich, wie ich mit ihnen umgehen sollte. In meinen frühen Teenagerjahren war ich sogar mehr an Insekten als an Mädchen interessiert!
Das änderte sich eines Tages – ich war sechzehn – schlagartig. Wir hatten gerade Sportunterricht gehabt, und ich zog mich in der Umkleidekabine aus, um zu duschen, als plötzlich – Blitz! – einer meiner Klassenkameraden, der mit einem Fotoapparat herumrannte und Überraschungs-Schnappschüsse von allen machte, auch mich erwischte. Das Ganze geschah so schnell, dass ich keine Zeit hatte, mir ein Handtuch umzubinden oder mich zumindest mit den Händen zu bedecken. Als ich am nächsten Tag das Klassenzimmer betrat, stand ein Pulk meiner Mitschüler dichtgedrängt vor einer Wand, um von irgendwas einen Blick zu ergattern.
Ich drängelte mich vor, um herauszufinden, was es da zu sehen gab. Da hing ich an der Wand, in Schwarzweiß und voller Pracht, nichts blieb der Fantasie überlassen. Die Mädchen in meiner Klasse hatten sich die Fotos ganz genau angesehen – und sie schienen ihnen zu gefallen. Als sie bemerkten, dass ich da war, ging ein bewunderndes Raunen durch den Raum. Das war ein fantastischer Moment in meinem Leben, denn inzwischen hatte ich ein genauso großes Interesse an Mädchen wie an Schmetterlingen und Orchideen.
Meine Reaktion war: O.K., ihr hattet euren Spaß, jetzt bin ich dran. Am nächsten Tag spazierte ich also in die Mädchenduschen: Es war Winter, und ich trug einen dicken Mantel. Ich stellte mich in eine der Duschkabinen und sah den Mädchen beim Duschen zu. Dabei versuchte ich nicht mal, mich besonders zu verstecken. Ich erwartete, dass sie sich umdrehen und mich sehen würden, und das wär’s dann gewesen, Revanche beendet. Aber sie drehten sich nicht um. Also stand ich einfach da und genoss den Anblick.
Das war eine ziemlich verwegene Aktion, aber ich hatte eben immer diese neugierige Seite in mir, und wenn ich etwas tun wollte, machte ich es einfach. Ich fühlte, dass sich hier eine Gelegenheit bot. Wegen der Sache mit den Fotos besaß ich eine Rechtfertigung. Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mich nie im Leben da hinein getraut. So wurde es ein aufregendes Erlebnis.
Ganz im Gegensatz zu meinen sonstigen Schulerfahrungen. Wie schon in der Grundschule interessierte ich mich auch jetzt nicht sonderlich für die unterrichteten Fächer. Ich wusste noch nicht so genau, was ich später mal machen wollte – vielleicht als Bildhauer oder Maler arbeiten oder irgendein Handwerk ausüben, irgendwas mit den Händen machen. Eine akademische Laufbahn konnte ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen.
Im Rückblick denke ich, dass ich gerne studiert und etwas getan hätte, was mich intellektuell fordert. Der Grund, warum mich das damals nicht lockte, lag am Unterricht, der mich kalt ließ. Meiner Meinung nach kann man nicht hoch genug bewerten, wie wichtig gute Lehrer für eine Gesellschaft sind. Jeder Lehrer, der ein Klassenzimmer voller Kinder inspirieren kann, ist Gold wert – er oder sie erschließt das Potenzial, das ein Land wachsen und gedeihen lässt.