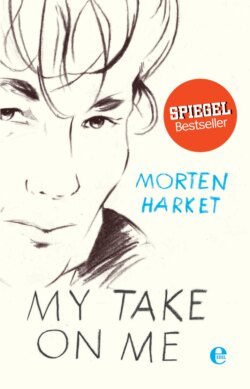Читать книгу My Take on Me - Morten Harket - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 5 Hey Joe
ОглавлениеIch war drei Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Freude erlebte, mit der Musik Menschen erfüllen kann, und die Macht, die sie auf sie ausübt. Meine Familie hatte mich zum Konzert einer Blaskapelle mitgenommen, und ich war völlig in der Musik gefangen: Sie schoss wie 1000 Volt durch meinen Körper. Ich fühlte mich lebendig, voller Energie. Es war eine sehr starke emotionale Reaktion. Ich muss ganz schön komisch ausgesehen haben mit meinen herumfuchtelnden Armen, weil mich im nächsten Moment der Dirigent hochhob und auf seine Schultern setzte. Jetzt hatte ich das Orchester auch bestens im Blick und konnte beim Dirigieren helfen.
Es war genau wie das Erlebnis auf der Blumenwiese: Obwohl ich noch so klein war, erkannte ich plötzlich eine elementare Kraft, die Macht der Musik. Es war ein rein emotionales Verstehen, ebenso wie ich die Schönheit der Natur begriffen hatte. Obwohl ich damals noch nicht ahnen konnte, was aus mir werden würde, wusste ich, dass ich dieses Gefühl, diese Freude immer und immer wieder erleben wollte.
Ein Glück, dass ich in einer so musikalischen Familie aufwuchs. Mein Vater wollte, dass wir alle ein Musikinstrument spielen lernen. Aber obwohl ich mich brennend für Musik interessierte, ließ mein Enthusiasmus beim Erlernen eines Instruments zu wünschen übrig. Ich nahm Klavierunterricht, stellte aber schnell fest, dass ich keine Lust hatte, die Stücke zu üben, die mein Lehrer mir vorgab. Nicht weil ich unmotiviert war oder nicht spielen wollte – das genaue Gegenteil war der Fall. Ich wollte improvisieren und experimentieren, wollte meine Ohren aufsperren anstatt gesagt zu bekommen, was ich tun sollte.
Ist das eine seltsame Reaktion für ein Kind? Ich denke nicht. Ich war nicht frech, sondern höflich und gut erzogen. Aber ich konnte eben auch stur und sehr auf ein Ziel fixiert sein. Für mich – und das hat sich bis heute nicht geändert – ist Musik Teil der Natur. Man musste mir nichts beibringen, weil ich schon „wusste“, wie es ging. Ich fühlte es instinktiv, und wenn jemand mir erzählen wollte, wie es funktioniert, so zeugte das von mangelndem Respekt gegenüber einer Macht, die größer war als wir beide. Das ist natürlich eine ziemlich hochtrabende Aussage für ein Kind, und ich hätte es sicherlich nicht so ausdrücken können. Aber das Gefühl war da.
Weiß der Himmel, was mein Klavierlehrer von mir hielt. Ein guter Unterricht lässt Kinder selbst Dinge entdecken, anstatt ihnen alles vorzukauen. Der Lehrer sollte seine Schüler an den Ausgangsort der Entdeckungsreise führen – von dort finden sie schon von alleine weiter. An diesem Punkt war ich im Hinblick auf das Klavier schon von Anfang an.
Mein Klavierlehrer war intelligent und zugleich hochemotional – eine gefährliche Kombination: Seine emotionale Reaktion war immer schneller als seine rationale. Er war sehr witzig, aber alles musste nach seinen Vorstellungen ablaufen; wenn man ihm witzig Kontra gab, war er nicht begeistert. Er war zwar musikalisch, gehörte aber zu den Menschen, die sich streng an Regeln halten – beim Lernen ging es für ihn vor allem um Systeme, Anordnungen und Übungen. Darin war er ziemlich dogmatisch, und so war es kaum überraschend, dass wir uns nur mittelmäßig verstanden. Wir respektierten einander aber in der Hinsicht, dass wir die Musikalität des anderen nie infrage stellten.
Ich befand mich in einer schwierigen Lage. Wie gesagt, war ich ein wohlerzogenes Kind und respektierte die Wünsche meiner Eltern, die uns nie zu etwas zwangen, was wir nicht tun wollten. Sie erklärten immer alles ganz sanft, und weil ich noch jung war, hatte ich keine Argumente parat, um zu widersprechen. Beim Klavierunterricht wollte ich sie nicht enttäuschen, und das bedeutete üben und den Klavierlehrer zufrieden stellen. Wenn ich nicht übte, hatte ich ein schlechtes Gewissen, obwohl ich keinen Sinn im Üben sah. Am Ende fand ich einen Mittelweg, die am wenigsten anstrengende Alternative: Ich merkte mir, wie der Lehrer spielte, und kopierte einfach seinen Stil. Acht Jahre lang hatte ich bei ihm Unterricht, ohne jemals wirklich Notenlesen zu lernen. Letztendlich kann ich ihm aber nichts vorwerfen, denn mit einem anderen Lehrer wäre es sicher ähnlich abgelaufen.
Ich hatte auch Posaunenunterricht. Dieser Lehrer war einfühlsamer. Er erkannte ziemlich schnell, dass ich ein gutes Ohr hatte, aber äußerst schwer zum Üben zu bewegen war. Er sagte Sachen wie: „Versuch wenigstens, bis zu diesem Takt zu kommen, dann ist es ein bisschen leichter für dich im Unterricht“, formulierte das Ganze also eher als Vorschlag.
Ich trat einem Orchester bei. Nicht aus freien Stücken, sondern weil meine Eltern wollten, dass wir alle in einem mitspielten. Sie versuchten, uns so viel musikalischen Input wie möglich zu bieten. Dabei war das gar nicht nötig, denn ich trug den Musik-„Virus“ bereits in mir und wusste, dass er nicht ohne weiteres verschwinden würde. Aber ich wollte ihnen eine Freude machen und trat in das Orchester ein, obwohl ich es hasste: Die Uniformen, die wir tragen mussten, waren ziemlich hässlich und schlecht geschnitten. Ich fühlte mich darin total linkisch und unattraktiv, und es war mir peinlich, wenn jemand zum Konzert kam und mich so sah.
Über Musik lernte ich im Orchester nicht sehr viel, dafür aber umso mehr darüber, wie man sich im Leben „durchwurschtelt“. Ich begriff, wie man Aufgaben aus dem Weg geht, wie man sich aus der Affäre zieht, und wie man so tut, als würde man etwas machen. Das Einzige, was mir wirklich Spaß machte, war, mein Ding durchzuziehen, während wir spielten. Anstatt meinen vorgesehenen Part zu spielen, dachte ich mir etwas Eigenes aus – etwas, das musikalisch irgendwie reinpasste, dem Stück aber einen neuen Touch verlieh.
Das fühlte sich gut an. Aber wenn ich so vor mich hin improvisierte, erklang meist das Tapp Tapp Tapp des Dirigenten, und das Orchester kam quietschend zum Stillstand. Oje, dachte ich dann, es geht wieder los. Der Dirigent zeigte in meine Richtung und bat mich, meinen Part vorzuspielen, um sicher zu gehen, dass ich das Richtige spielte. Häufig verwies er auf irgendwas in den Noten, und ich hatte, ehrlich gesagt, meistens keine Ahnung, wovon er überhaupt sprach! Glücklicherweise spielte mein Posaunenlehrer die erste Posaune und konnte mir aus der Patsche helfen. Er lehnte sich zu mir herüber und blies oder pfiff mir den Posaunenpart leise ins Ohr. Der Dirigent dachte, meine langsame Reaktion hätte mit meinem mangelnden Selbstbewusstsein zu tun, und ich ließ ihn in dem Glauben – so hatte ich Zeit, von meinem Posaunenlehrer zu hören, was ich eigentlich spielen sollte. Mit meinem musikalischen Gedächtnis konnte ich das Stück dann notengenau nachspielen.
***
Bei uns zu Hause drehte sich alles um klassische Musik – das war die Musikrichtung, die mein Vater hörte und spielte. Er interessierte sich nie für improvisierte Musik wie Jazz oder für Popmusik in den Charts. Obwohl wir in den Sechzigerjahren aufwuchsen, erklangen bei uns weder die Beatles noch die Rolling Stones.
Die erste zeitgenössische Musik, die ich hörte, war, glaube ich, Simon & Garfunkels „Bridge Over Troubled Water“. Das war das erste Mal, dass ich mir Musik richtig anhörte, die weder klassisch noch Kirchenmusik war. Ich war begeistert. Bei Johnny Cash verliebte ich mich sofort in diese Stimme, ihre abgründige Tiefe. Bevor ich in die Pubertät kam, reichte meine Stimme nicht besonders tief, und so hörte ich Johnny Cash und versuchte, seinen Gesangsstil zu imitieren, um meinen Stimmumfang zu erweitern.
Und das war nur der Anfang. In den frühen Siebzigerjahren gab es eine endlose Serie von Rockbands, die mein musikalisches Erwachen vorantrieben. Zum Beispiel Queen, vielleicht die erste Rockband, die meinem Vater gefiel – er respektierte Songwriting und Arrangements. Ihre frühen Alben fesselten mich – vom Debütalbum Queen über A Night at the Opera bis zu A Day at the Races. Danach fand ich, dass ihre Musik sich veränderte: Sie wurde fröhlicher und entspannter; die Spannung der frühen Werke fehlte etwas. Ich weiß nicht, ob das am Erfolg der Band lag, dem großen Erwartungsdruck, der auf ihr lastete, aber es war irgendwie nicht mehr dasselbe, und ich verlor eine Weile das Interesse. Doch die Spannung verschwand nie völlig – sie schlummerte nur und kam schließlich wieder zum Vorschein.
Was ist das Besondere an der Musik von Queen? In ihren besten Momenten besitzt sie etwas Traumhaftes: Sowohl mit der Musik als auch mit den Texten können die Musiker Bilder heraufbeschwören, die gleichzeitig erfunden und real wirken. Sie können dich mit ihrer Musik an einen anderen Ort entführen. Nicht nur die Musiker fühlen beim Spielen der Songs den Zauber des Augenblicks, sondern auch die Fans. Große Musik überschreitet Grenzen, und die von Queen zog mich als Teenager total in ihren Bann.
Einer der Vorteile einer erfolgreichen Karriere als Sänger ist, dass man Gelegenheit bekommt, Leute zu treffen, die einen inspiriert haben. Freddie Mercury lernte ich leider nur flüchtig kennen, aber den übrigen Bandmitgliedern von Queen begegnete ich mehrfach und konnte mich ausgiebig mit ihnen unterhalten. Sie sind ausgesprochen nett und normal, wir haben uns immer gut verstanden. Obwohl Freddie Mercury mit seiner Ausstrahlungskraft als Leadsänger immer im Vordergrund stand, ist Queen eine richtige Band, bei der die, die weniger im Scheinwerferlicht stehen, genauso wichtig für den Sound und Erfolg der Gruppe sind. Als Zuhörer kriegt man vielleicht nicht immer alles mit, aber man braucht das, was hinten passiert, um das, was vorne passiert, zu ermöglichen. Jeder in der Band ist wichtig – es ist ein Gruppending, aus dem etwas entsteht, dass größer ist als die Summe seiner Teile.
Queen war nur eine von vielen Bands, die ich als Jugendlicher mochte. Genesis und David Bowie hörte ich ständig, Bands wie Deep Purple und Nazareth nicht ganz so oft. Meine absolute Lieblingsband damals war aber Uriah Heep, eine britische Rockband, deren Debütalbum 1970 erschien. Sie spielten Heavy Metal, aber melodischer als andere. Das erste Album, das ich von ihnen hörte, war Wonderworld, das Ende 1974 erschien. Schon nach den ersten paar Sekunden hatte die Musik mich „gepackt“. Ich war total wild vor Aufregung, es fühlte sich so an, als wäre etwas in meinem Kopf und meinem Herzen explodiert. Und nicht nur ich fühlte so: Die Band war in Großbritannien und den USA erfolgreich, räumte aber vor allem in Norwegen, Deutschland, Österreich und Finnland ab. Wonderworld stand auf Platz drei der norwegischen Albumcharts und war eins von insgesamt sieben Alben von Uriah Heep, die unter die Top Five kamen.
Die Musik von Uriah Heep besaß eine Progressive-Rock-Komponente und Leadsänger David Byron eine stimmliche Reichweite, die mich sofort faszinierte. Wie bei Freddie Mercury und Queen hatten die Vokalarrangements einen leicht klassischen Touch, der mir gefiel. Mein Cousin war auf einer Reise in England gewesen – einem Fußballturnier oder Schulaustausch oder irgend so etwas – und brachte diese Platten mit. Dafür werde ich ihm ewig dankbar sein. Und meinen Eltern auch: Ich hatte nie einen eigenen Plattenspieler in meinem Zimmer, es gab nur den im Wohnzimmer, also hörte ich dort meine Platten. Meine Eltern müssen sehr tolerant gewesen sein!
Dieses Uriah-Heep-Album hatte auf mich als junger Teenager eine enorme Wirkung. Aber das war alles nichts gegen Jimi Hendrix, den ich ein paar Jahre später entdeckte. Ich war damals siebzehn, und „Hey Joe“ der Song, der mich völlig aus der Fassung brachte. Zu diesem Zeitpunkt war ich in meinem Musikgeschmack ziemlich dogmatisch – ich wusste, was mir gefiel und was nicht, und ließ mich von niemandem umstimmen. Es gab immer noch diesen roten Faden, die klassische Musik, mit der ich aufwuchs und die in ausgefeilt komponierten und arrangierten Songs wie denen von Queen anklang.
Aber Hendrix, wow! Das war irgendwie natürlich und roh und fühlte sich einfach unwiderstehlich an: die Musikalität, die Phrasierung, die Attitüde, mit der er Gitarre spielte und sang. Es war anders als alles, was ich bisher gehört hatte, und stellte alles, was ich über Musik zu wissen glaubte, auf den Kopf. Ich weiß nicht mehr, wem die Platte gehörte, aber sie befand sich in der Schule. Im Aufenthaltsraum gab es einen Plattenspieler, und der Song beeindruckte mich so, dass ich die Platte unbedingt haben musste. Also nahm ich sie einfach mit. Ich klaute sie! Was mir überhaupt nicht ähnlich sah, aber es war einfach eine innere Notwendigkeit – wir gehörten zusammen. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen!
Was aber noch seltsamer war: Ich spielte die geklaute Platte nicht ab. Ich spielte gar nichts ab. Drei Monate lang hörte ich überhaupt keine Musik mehr. Die Wirkung der Hendrix-Platte war so groß, dass alles, was ich zuvor gehört hatte, plötzlich überflüssig schien. Sie änderte alle Regeln und Werte, die ich bisher mit Musik verbunden hatte. Wie bei den meisten Jugendlichen war Musik ein wichtiger Bestandteil meiner Identität gewesen. Das war nun alles mit einer einzigen Plattenumdrehung verflogen.
Ich hörte also nicht länger die Musik, die mitbestimmt und definiert hatte, wer ich zu sein glaubte. Doch die Hendrix-Platte hörte ich mir auch nicht an. Ich verstand sie nicht, fühlte mich nicht bereit dafür, falls das einen Sinn ergibt. In dieser Musik steckte eine „Wahrheit“, die besagte, dass alles, was ich bisher gehörte hatte, neu definiert werden musste. Es würde Zeit brauchen, diese Wahrheit zu verstehen und anzunehmen. Eins war mir allerdings nun klar: Ich wollte Musiker werden.