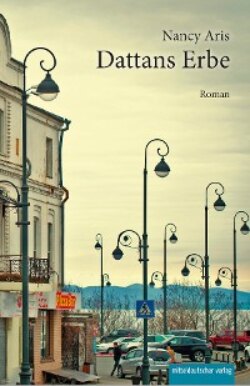Читать книгу Dattans Erbe - Nancy Aris - Страница 8
Erstkontakt in den Neunzigern
ОглавлениеWladiwostok – Beherrsche den Osten! Was für ein Name … Vor über zwanzig Jahren hatte ich mich schon einmal auf den Weg dorthin gemacht. Es war eine der abenteuerlichsten Reisen, die ich je unternommen hatte. Eigentlich wollte ich gar nicht nach Wladiwostok, sondern nach China. Angefangen hatte alles mit Qiang, einem Nachbarn im Studentenwohnheim. Ich hatte in Moskau studiert. Nach der Wende, als es fast alle in den Westen zog, nahm ich die andere Richtung. Ich wollte Russisch lernen. Eigentlich eine Schnapsidee, denn es war eine total chaotische und harte Zeit damals. In den Geschäften gab es nichts zu kaufen, und wir Studenten bekamen wie zum Trost Lebensmittelmarken ausgehändigt. Cafés suchte man vergeblich und in der Mensa gab es tagein tagaus trockene Buchweizengrütze ohne etwas dazu. Überall leere Auslagen, in denen die Kakerlaken verloren umhereilten. Wohl dem, der ein Stück Land besaß und sich selbst versorgen konnte. Auf privaten Märkten fand man alles. Die Preise waren horrend, aber dank D-Mark blieb für uns die Versorgung billig. Ich weigerte mich, dort einzukaufen, weil ich nicht besser gestellt sein wollte als die Einheimischen, aber ich hasste den strengen Geschmack des Buchweizens. Von Anfang an hatte ich mir angewöhnt, immer einen Rucksack dabei zu haben. Sah ich eine Schlange, schaute ich, was es gab und stellte mich an. Das starre System der sozialistischen Planwirtschaft war kollabiert. Ein noch nie gesehener Manchesterkapitalismus machte sich breit. Marx hätte gestaunt. Betriebe und Wohnungen wurden privatisiert, aus linientreuen Apparatschiks wurden Oligarchen, die das Volkseigentum aufgeteilt hatten, bevor die Masse überhaupt verstand, was vor sich ging. Die Preise explodierten, aber die Mehrheit arbeitete für den alten Sowjetlohn, der hinten und vorne nicht reichte. Viele erhielten monatelang keine Kopeke. Im Straßenbild tauchten erste Obdachlose auf, marodierende Kinderbanden, beinlose Afghanistanveteranen, die auf kleinen Wagen in den Metroeingängen saßen und bettelten, weil der Staat seine Fürsorgepflicht vergessen hatte. Das öffentliche Leben löste sich auf: Busse kamen nur noch sporadisch, Vorortzüge wurden nicht mehr beheizt, aus Schlaglöchern wurden Fallgruben. Die Gesellschaft schien aus den Fugen, kein Stein blieb auf dem anderen, doch in der Uni herrschte unbeirrt das alte Sowjetregime, es ging zu wie unter Breschnew. Wir Ausländer wurden separiert, der Kontakt zu einheimischen russischen Studenten war zwar nicht ausdrücklich verboten, aber die Uni-Leitung achtete peinlich genau darauf, jedwede Berührungspunkte zu vermeiden. Wir sollten unter uns bleiben, immerhin waren wir jetzt die aus dem Westen. Die Angst vor dem Klassenfeind saß tief. Das Studium in meiner „Berliner Seminargruppe“ war eine Farce. Da saß ich in Moskau mit den gleichen Leuten zusammen, mit denen ich auch an der Humboldt-Uni studierte, nur dass eine verknöcherte Altstalinistin ihren Frontalunterricht abspulte. Als ich einmal vorschlug, mehr dialogisch zu lernen, stellte sie mich als Lehrerin vor die Gruppe. Ich mied die Lehrveranstaltungen mehr und mehr, ließ mich stattdessen durch die Stadt treiben, schaute mir Ausstellungen an, ging auf Konzerte und lernte dabei unaufhörlich neue Leute kennen. Irgendwann verliebte ich mich in einen Amerikaner, der eigentlich Brite war. Und ich verreiste viel, denn ich wusste, dass ich unterwegs mehr lernte als beim todlangweiligen Übersetzen mit Nina Andrejewna. China jedoch stand damals nicht auf meinem Wunschzettel. Wäre Qiang nicht gewesen …
Qiang kam aus China. Er wohnte auf der gleichen Etage und manchmal trafen wir uns in der Gemeinschaftsküche. Immer schwärmte er von seiner Heimat. Er riet mir, unbedingt dorthin zu fahren. Moskau sei die Hälfte des Weges, von Berlin aus sei es weiter und viel teurer. Qiang wohnte mit drei Landsleuten in zwei Zimmern. Zwei von ihnen waren sehr alt, ganz offensichtlich keine Studenten mehr. Wie sie das arrangiert hatten, war mir schleierhaft, denn unser Wohnheim war ausschließlich westeuropäischen und amerikanischen Studenten vorbehalten. Es herrschte strengstes Reglement. Das zentral gelegene Nobelheim für die Besserverdiener war keine Herberge für chinesische Studenten, schon gar nicht für deren Verwandte. Die zwei ausgemergelten Alten, die mit Qiang und Wei zusammenlebten, wären der rund um die Uhr besetzten Eingangswache unweigerlich in die Hände gefallen. Sie mussten also irgendeinen Deal ausgehandelt haben. Die schon gebeugt gehenden Herren, Jian und Kang, stellten sich mir als schamanische Wunderheiler vor, deren Namen so viel wie Gesund und Glücklich bedeuteten. Anfangs hielt ich das für einen Witz. Wahrscheinlich wollten sie mich damit aufziehen, weil für uns alle Chinesen gleich aussahen, fast jeder Ling hieß und Akupunkturexperte war … Und in der Tat, rein äußerlich hätte ich sie ohne Zögern in die Schublade „buddhistische Ginsengwurzelsucher“ gesteckt. Ich schenkte dem also keine Beachtung und lachte innerlich, wenn Glücklich und Gesund meinen Weg kreuzten. Als mir Qiang später erzählte, dass sie tatsächlich so hießen, war ich fast ein wenig enttäuscht.
Irgendwann tauchte mein Exfreund Sebastian in Moskau auf. Eigentlich wollte er nur kurz vorbeischauen, einer seiner gefürchteten Überraschungsbesuche. Aber dann wurde sein Pass geklaut und er musste länger bleiben. Im penibel überwachten Wohnheim waren diese Tage, vor allem aber die Nächte absoluter Stress. Jeden Abend musste ich Sebastian vor den Kontrollen der Eingangswache verstecken, weil sie zuvor jeden Besucher notiert hatten. Wer bis 23 Uhr die Pforte nicht wieder passiert hatte, wurde im Wohnheim gesucht. Nach drei Nächten verzweifelten Versteckspiels und waghalsiger Ausreden suchte sich Sebastian ein Zimmer bei einer Oma um die Ecke. An jedem Bahnhof standen die Alten und hielten nach Untermietern Ausschau, um im wütenden Raubtierkapitalismus überleben zu können. Plötzlich war er Teil dieser altmodischen und zugleich chaotischen Welt, die komplett anders tickte als sein Berliner Leben. Sebastian fand das so aufregend, dass er trotz ausgehändigtem Ersatzpass beschloss, in Moskau zu bleiben. Aber wie sollte das gehen? Er hatte kein Visum und gerade erst seinen Zivildienst angefangen. Zur Armee wollte er nicht, aber auch der Zivildienst nervte ihn. Eine unzumutbare Zwangsmaßnahme. Als Künstler wollte er sich in kein System pressen lassen. Auch wenn er die Geschichten der Alten mochte, hatte er keine Lust, ihre Windeln zu wechseln. Altenpflege war was für Weicheier. Allein der hilfsbereit weinerliche Ton in seiner Sozialstation reizte ihn.
Und genau hier gerieten Glücklich und Gesund wieder ins Blickfeld. Sebastian hatte die Idee, dass ihm die Schamanen, die vorgaben, zertifizierte Alternativmediziner zu sein, eine Bescheinigung ausstellen könnten. Ein Attest über ein plötzlich eingetretenes Rückenleiden. Es klang absurd, aber warum nicht? Ein Versuch war es wert. Ich bahnte über Qiang den Kontakt an und Sebastian ging zur Sprechstunde ins Wohnheimzimmer 412. Die Chinesen nahmen sich seiner an. Sie schrieben Sebastian ein Attest und bescheinigten ihm, dass er eine akute Nerveneinklemmung habe, nicht transportfähig sei und nur durch eine schonende, aber sehr langwierige Therapie genesen könne. Sebastian blieb schließlich zwei Monate in Moskau, genoss sein Leben bei der betagten Jewfrosinija Petrowna und erfreute sich bester Gesundheit.
Qiang lag mir weiter in den Ohren. Irgendwie fühlte ich mich verpflichtet. Immerhin hatte er Sebastian aus der Klemme geholfen. Und so beschloss ich, meinen alten Reisekumpanen Jan zu fragen, ob wir nicht gemeinsam in Qiangs Heimat fahren sollten. In ein paar Tagen würde er ohnehin nach Moskau kommen. Aber Jan war von meinen Abwegen nicht begeistert. Er wollte nach Moskau kommen, um Freunde zu besuchen. Mal keine Fernreisen, mal kein Abenteuer. Auch mir passte das nicht, weil ich eine Amerikareise geplant hatte und in Gedanken schon im Flugzeug nach New York saß. Andererseits … Jan und ich waren das perfekte Reise-Duo. Wir hatten unzählige Orte in der Sowjetunion bereist, in Zentralasien, in Sibirien, im Kaukasus, am Schwarzen Meer, im Baltikum. Wir waren überall, manchmal in brisanten Zeiten, fast nie mit gültigen Papieren, dafür immer abenteuerlich und irgendwie erfolgreich an den Behörden vorbei. Wir fanden immer die richtigen Tricks, mit denen wir uns durchmogeln, die Polizisten oder andere Kontrolleure hinters Licht führen konnten. Irgendwie hatten wir immer Glück. Nur einmal musste das deutsche Außenministerium eingeschaltet werden. Da waren wir sechs Wochen ohne Visum durchs Land gereist, vom Baltikum bis an die iranische Grenze, alles mit einer Einladung aus Litauen. Damit wollte uns verständlicherweise keiner ausreisen lassen, weder an der Grenze zur Türkei noch an der Grenze nach Polen. Letztlich klappte auch das. Wie immer. Warum also nicht ein Abstecher nach China? Jan blieb stur, nein, diesmal bitte kein Chaos. Aber kaum war er in Moskau gelandet und kaum hatte er Glücklich und Gesund kennengelernt, hatte ihn die Abenteuerlust gepackt. Doch in Berlin durfte keiner davon erfahren.
Wir besorgten uns kurzerhand ein Visum in der Chinesischen Botschaft in Moskau. Das war unkompliziert und nicht teuer. Für Russland hatten wir ein Dauervisum. Wir gaben unsere DDR-Pässe ab und nahmen sie eine Woche später mit Visum in Empfang. Das Ganze hatte etwas Skurriles. Da bekamen wir ein Visum in den Pass eines Landes, das seit Monaten nicht mehr existierte. Der Pass hingegen würde noch bis Juni 1992 seine Gültigkeit behalten. Komisch. So beständig die deutsche Verwaltung war, so flatterhaft arbeiteten die russischen Ämter. Und so war es nicht verwunderlich, dass wir genau einen Tag vor unserer geplanten Abreise böse überrascht wurden. Man hatte bei der staatlichen Fluggesellschaft Aeroflot verfügt, ausländischen Studenten ab sofort keine Flugtickets mehr für Rubel zu verkaufen. Auch wir sollten von nun an die teuren Valuta-Tickets für Ausländer kaufen. Der Studenten-Schalter in der Aeroflot-Zentrale war geschlossen. Auch wenn wir schon vorher mehr bezahlten als die Einheimischen, so war Fliegen trotzdem spottbillig. Es war wie U-Bahn-Fahren in Berlin. Auch deshalb hatten wir uns so leichtfertig auf das China-Abenteuer eingelassen. Wir wollten bis Wladiwostok fliegen und von dort den Zug nehmen.
Und dann diese Ticketpleite, genau einen Tag vor der Abreise. Wir hatten uns vorher nicht darum gekümmert, weil es keine große Sache war, Flugtickets zu besorgen. Nicht wie bei uns, wo damals nur Reisebüros die wichtig anmutenden Flugscheine ausstellten. Die Russen flogen viel. Es war nichts Exklusives. Man ging zum Schalter und holte sich ein Ticket, so wie für den Zug. Es gab immer genug.
Nun waren wir aufgeschmissen. Wir beschlossen, direkt zum Flughafen zu fahren. Vielleicht würde sich dort etwas ergeben. Wenn ich heute, in Zeiten paranoider Terrorangst und minutiöser Sicherheitskontrollen, daran denke, wie wir uns damals verhielten, dann erscheint es mir vollkommen absurd.
Wir wussten, wann der Flug nach Wladiwostok gehen sollte. Also betraten wir den Flughafen, in dem Glauben, jemanden bestechen zu können. Wir gingen in die Abflughalle und verfolgten das Prozedere ganz genau, erst die Abfertigung und dann den Einstig in die Maschine. Gepäck hatten wir kaum. Ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern, wie wir es schafften, die Kontrolle zum Einstieg zu umgehen, aber plötzlich standen wir auf dem Flugfeld. Wir rannten über das Rollfeld mit einem Geldbündel in der Hand. Ringsherum Schnee, eisiger Wind und der Lärm der Flugzeuge. Ich hatte die Geldrolle mit einem Gummi zusammengebunden, damit nichts wegflog. Es dämmerte bereits. So blieb die Hoffnung, dass uns keiner bei unserer Wahnsinns-Aktion bemerken würde.
Die Passagiere gingen bereits die Treppe hinauf und wir standen unten mit unserem Geldbündel. Nach und nach eilten sie an uns vorbei. Und langsam wurden es weniger.
War das überhaupt die richtige Maschine? Wir hatten den Überblick verloren. Und was, wenn die Stewardess sich nicht darauf einließ? Vielleicht waren nicht alle bestechlich. Was, wenn unser Bündel zu klein war? Wir hatten keine Ahnung, was angemessen war. Und was, wenn die Maschine ausgebucht war und es gar keinen Sitzplatz mehr für uns gab? Erst nach dem letzten Passagier wollten wir hochgehen, denn keiner sollte hinter uns stehen. Bloß keine Zeugen! Aber als der Letzte angehetzt kam und die Treppe hinaufgerannt war, bekamen wir es plötzlich mit der Angst zu tun. Auch wenn wir im anarchistischen Russland waren, wo fast jeder korrupt schien, dämmerte uns, dass man auch hier nicht auf dem Rollfeld eines Hauptstadtflughafens spazieren gehen durfte.
Wir gerieten in Panik. Und noch bevor die Stewardess die Einstiegstür verriegelt hatte, rannten wir wieder zurück. Zum Glück hatte uns niemand bemerkt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie frustriert ich war. Warum hatten die mit ihrer bescheuerten Regelung nicht ein paar Tage warten können? Warum musste es ausgerechnet uns treffen?
Plötzlich hatte Jan eine Idee.
„Warum lassen wir uns die Tickets nicht von einem Einheimischen kaufen? Wenn die uns nicht als Ausländer wollen, dann gehen wir eben als Russen durch. Bei der Bahn machen wir das doch auch immer so.“
Genau, warum nicht? Flugtickets wurden sogar in Metrounterführungen an Kiosken verkauft. Man bekam einen Zettel, auf dem Fluglinie, Reisedatum und der Passagiername standen. Keine Ausweisnummer, kein Geburtsdatum.
Wir hatten Glück, jemand kaufte uns die Tickets für den nächsten Tag. Jan hieß laut Ticket Razumnij – der Vernünftige. Ich musste lachen, denn vernünftig war das alles nicht. Auf meinem Küchentisch in Berlin lag ein Flugticket nach New York in nicht einmal drei Wochen …
Nun hatten wir zwar die Tickets, aber trotzdem war alles ungewiss. Wie würden wir wieder zurückkommen? Mit der Transsib würden wir sechs Tage brauchen.
Wir durften nicht auffallen mit unseren russischen Tickets. Damals fertigte man ausländische Fluggäste gesondert ab. Es gab einen speziellen Schalter mit separatem Wartebereich. Das war ein Überbleibsel aus der Sowjetzeit, als es galt, jedwede Kontaktaufnahme mit dem Klassenfeind zu unterbinden. Wir mussten also wie Russen aussehen und durften nicht auffallen. Aber nicht aufzufallen war gerade damals viel komplizierter, als man es sich heute vorstellen würde. Jeder Ausländer fiel auf, allein schon wegen der Schuhe, der Kleidung und auch, weil sich die Frauen in Russland auffallend anders schminkten. Ich versuchte eine äußerliche Annäherung und machte mich betont auffällig mit viel Wimperntusche, Lidschatten und einem pinkrosa Lippenstift zurecht. Meine langen schwarzen Haare steckte ich kunstvoll zu einem Frisurturm hoch. Dann borgte ich mir ein folkloristisches Wolltuch mit buntem Blumenmuster, das ich mir über die Schultern legte. Es war der Look einer Fünfzigjährigen. Ich war einundzwanzig. Jan lachte. Ja, die Männer hatten es leichter.
Wir wussten, dass die Ausweise stichprobenartig kontrolliert wurden. Natürlich hatten wir Angst, aufzufliegen, aber wir versuchten, nicht darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das haben könnte.
Ich hatte eine Idee. Die Flucht nach vorn. An Zeitungskiosken wurden Schutzhüllen verkauft. Sie sahen genauso aus, wie ein Reisepass – gleiches Format, gleiche Farbe, gleicher Aufdruck. Nur das Material war anders. Fast alle benutzten diese Hüllen. Ich kaufte zwei Hüllen für unsere DDR-Pässe. Ein Glück, dass wir uns noch nicht von ihnen getrennt hatten, denn der grüne Bundespass hätte nicht in die Hülle gepasst.
Natürlich war es absurd, anzunehmen, dass diese Hüllen helfen würden, aber es gab uns Sicherheit. Jan Razumnij kaufte sich eine russische Zeitung und las darin. Ich mimte die gelangweilte Gattin, hielt meinen Pass demonstrativ in der Hand und zog ab und zu meinen Lippenstift nach. Dann kam der Aufruf zum Einstieg. Wir gingen ganz langsam am Kontrollpunkt vorbei und ich kramte in meiner Tasche, um den Milizionär nicht anschauen zu müssen, immer den falschen Pass in der Hand. Dann waren wir durch. Wir stiegen in den Bus zum Flugzeug, gingen die Treppe hinauf und ließen uns erleichtert in die Sitze fallen. Erst als die Maschine zum Abflug bereit war und die Kabinentür geschlossen wurde, sprachen wir wieder miteinander. Wir waren wie im Rausch. Ja, wir hatten es wieder einmal geschafft und das starrsinnige System ausgetrickst. Jan amüsierte sich den ganzen Flug über mein Aussehen und ich kam mir absolut bescheuert vor mit meiner Kriegsbemalung und der Turbanfrisur. Fast schade, dass wir davon kein Foto gemacht haben.
Leider hatten wir von Wladiwostok nicht viel gesehen, weil wir gleich weiterfuhren. Die Stadt gehörte zu den „Geschlossenen Städten“, die für Ausländer absolute Tabuzonen waren. Sogar Sowjetbürger brauchten eine Genehmigung für Wladiwostok, wenn sie dort nicht gemeldet waren. Im Hafen von Wladiwostok lag die russische Pazifikflotte, deshalb galt strengste Geheimhaltung. Ich weiß nicht, ob die Regelung damals noch galt, die Sowjetunion brach zusammen, es war die chaotische Übergangsphase, eine Zeit der Ungewissheit, in der jeder alles und nichts bestimmen konnte. Erst im Sommer hatte ich bei meiner Ankunft in Simferopol erlebt, dass ein unangenehm aufdringlicher Typ sich als Verwaltungsbeamter ausgab und uns direkt auf dem Bahnsteig abkassieren wollte, sozusagen als Eintrittsgebühr für die Krim.
Also vermieden wir möglichst jedes kleinste Risiko und fuhren schnurstracks zum Bahnhof. Bloß nicht auffallen, bloß nicht verhaftet werden. Aber auch ohne viel von der Stadt gesehen zu haben, blieb Wladiwostok in meinem Gedächtnis. Wie überhaupt die ganze Reise. Vielleicht, weil China ein Schock war und sich komplett anders präsentierte als Qiang uns vorausgesagt hatte. Vielleicht, weil wir den Rückweg tatsächlich mit der Transsib antreten mussten und die sechs Tage todkrank auf unseren Schlafwagenpritschen darniederlagen, weil wir in China, wo selbst in besseren Hotels die Leitungen eingefroren waren, ununterbrochen gefroren hatten. Wahrscheinlich hatte genau deshalb diese mysteriöse Anzeige eine solche Anziehungskraft auf mich gehabt. Sie hatte mich in diese wilde Zeit zurückkatapultiert. Nun saß ich wieder hier in Moskau auf dem Flughafen. Aber diesmal hatte ich ein anständiges Visum, ein korrektes Flugticket und sogar ein im Voraus gebuchtes Hotel. Siegfried Bornecker hatte für alles gesorgt.