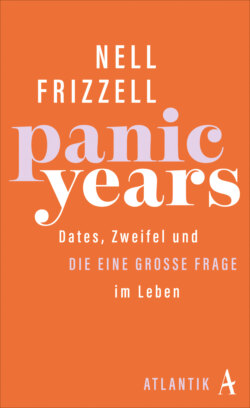Читать книгу Panic Years - Nell Frizzell - Страница 4
Einleitung
ОглавлениеAm Morgen meines achtundzwanzigsten Geburtstags wachte ich allein in einem Einzelbett im Gästezimmer meiner Mutter auf und erinnerte mich daran, dass mein Freund der letzten sechs Jahre nicht mehr mein Freund war. Während ich vom Gewicht meines eigenen Herzens auf die Matratze gedrückt wurde, kam mir der Gedanke, dass ich mich zum ersten Mal seit langer Zeit allein fühlte, fremd, unsicher und ungebunden.
Am Morgen meines dreißigsten Geburtstags wachte ich im Bett neben meiner besten Freundin auf. Sie war im fünften Monat schwanger, hatte einen Immobilienkredit aufgenommen und war verlobt. Ich war ein kinderloser Single und würde bald überflüssig sein. Ich blickte zu ihr hinüber, während die grelle Dezembersonne durchs Fenster kreischte wie ein Feueralarm, und fühlte mich, als stünde ich auf einem Bahnsteig und sähe zu, wie meine Freundin außer Sichtweite verschwand.
Am Morgen meines dreiunddreißigsten Geburtstags wachte ich neben einem Mann im Bett auf, den ich liebe, mit einem zwei Wochen alten Baby, das neben mir so sanft atmete, dass ich zum 578. Mal seit seiner Geburt eine Hand ausstrecken und sein Gesicht berühren musste, um sicherzugehen, dass es noch am Leben war. Mein Bauch fühlte sich an wie nasser Schlamm. Meine Augen waren vom andauernden Weinen zu Lychees angeschwollen. Seit den letzten paar Wochen meiner Schwangerschaft hatte ich nicht länger als drei Stunden am Stück geschlafen, ich trug eine Binde in Luftmatratzengröße und roch nach vergorener Milch. Als eine blassrosa Dämmerung die Baumkronen entlang des Flusses Lea küsste, zog ich mir einen XL-Herren-Jogginganzug und Socken von meinem Freund an, schlich mich aus meiner überhitzten kleinen Wohnung, überquerte die Fußgängerbrücke zu den Walthamstow Marshes, hielt mein Gesicht in die Sonne und brüllte.
In kürzerer Zeit, als meine Schwester brauchte, um ihren Führerschein zu machen, hatte sich mein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt. Ich hatte die Sicherheit einer Beziehung aufgegeben, hatte mich mit der endlichen Natur meiner Fruchtbarkeit auseinandergesetzt, zeitweise eine sorglose Verderbtheit an den Tag gelegt und schließlich eine komplett neue Identität angenommen. Diese Veränderungen hatten dazu geführt, dass ich jetzt ein Baby hatte, aber ob es nun darum geht, eine langjährige Beziehung zu beenden, in ein anderes Land zu ziehen, einen neuen Karriereweg einzuschlagen, zu heiraten oder einen Nervenzusammenbruch zu erleiden: Während dieser namenlosen Periode in unseren späten Zwanzigern, unseren Dreißigern und nicht selten auch noch Vierzigern geschehen meist enorme Dinge, nach denen es oftmals kein Zurück mehr gibt. Eltern zu werden ist dabei die einzige Entscheidung, die mit einer biologischen Deadline versehen ist, und auch die einzige, die sich tatsächlich nicht mehr umkehren lässt: Daher ist sie die eine Entscheidung, die alle anderen so scharf in den Fokus rückt. Man kann sich einen neuen Job suchen, umziehen, neue Freundschaften schließen, neue Partner oder Partnerinnen finden, aber sobald man zu Eltern wird, bleibt man es fürs Leben.
Trotzdem hat diese Periode keinen Namen. Im Gegensatz zu Kindheit, Jugend, Menopause oder Midlife-Crisis haben wir keinen allgemeingültigen Begriff für den Tumult aus Zeit, Hormonen, gesellschaftlichem Druck und Sehnen nach einem Kind, der über viele Frauen mit Ende zwanzig, Anfang dreißig hereinbricht. Es gibt keinen medizinischen Fachbegriff, kein zusammengesetztes deutsches Wort, nichts auf Lateinisch, Arabisch oder Französisch. Die Astrologie mag auf die Sieben-Jahres-Zyklen der Rückkehr des Saturn verweisen, aber diese vage Formulierung erzählt nur wenig von Mut und Größe, Blut und Tränen, Reisen und Transformationen, die ich sowohl an mir selbst, als auch an den Menschen in meinem Umfeld wahrgenommen habe. Während man mittendrin steckt, hat man das Gefühl, sich durch ein Netz aus unmöglichen Entscheidungen zu schlängeln – über Arbeit, Geld, Liebe, Wohnort, Karriere, Verhütung und Verpflichtungen –, von denen jede einzelne wie ein Faden an allen anderen zieht, sodass es unmöglich ist, das Ganze zu entwirren oder sich hindurchzubewegen, ohne es zu zerstören. Im Rückblick wurden viele, wenn nicht alle dieser Entscheidungen so drängend durch das pulsierende, pochende, unausweichliche Wissen um die Endlichkeit der eigenen Fruchtbarkeit, die sinkende Anzahl von Eizellen und die Tatsache, dass es der eigene Körper einem eines Tages nicht mehr ermöglichen wird, Kinder zu bekommen.
Diese Jahre sind geprägt durch die ewige Frage: Soll ich ein Baby bekommen, und wenn ja, wann, wie, warum und mit wem? Diese Frage sickert im Laufe der Zeit in jeden Bereich unseres Lebens. Sie ist das Rattern auf den Gleisen unter den eigenen Füßen. Die allem zugrunde liegende Basslinie. Ob man Eltern werden möchte oder nicht, als Person in ihren späten Zwanzigern und Dreißigern und vielleicht sogar noch in den Vierzigern bringt das langsame Verstreichen unbefruchteter Gelegenheiten eine Dringlichkeit in das eigene Leben, die sich so in keiner anderen Lebensphase wiederfindet. Man muss sich entscheiden, was man will, und zwar sofort, bevor der eigene Körper einem keine Wahl mehr lässt.
Dass es in jeder großen europäischen Sprache mehrere Wörter für die Jugendzeit gibt, aber kein einziges für diese zweite transformative Zeit im Leben einer Frau, weist auf zwei Dinge hin: Erstens lässt die Sprache uns häufig im Stich, und zweitens haben wir diese Phase nie richtig ernst genommen. Zu oft wird unsere Reise aus der Jugend hinaus, durch die fruchtbaren Jahre und hin zu einer neuen emotionalen Reife als Erwachen der Muttergefühle, als innere Unruhe oder ›lediglich‹ als das Ticken der biologischen Uhr abgetan. Dabei ist sie das komplexe Zentrum allen Drucks, aller Widersprüche und Ängste, mit denen westliche Frauen heute konfrontiert sind, von Fruchtbarkeit und Finanzen bis zu Liebe, Arbeit und Selbstwert.
Als ich mit achtundzwanzig meine Beziehung, mein Zuhause und meine Richtung verlor, sagte mir niemand, dies sei der Beginn von etwas Neuem. Niemand konnte mir kurz zusammengefasst erklären, dass aus so viel Verlust eine vollkommen neue Identität entstehen würde und dass die meisten Menschen in meinem Umfeld ebenfalls in einem Wandel begriffen waren, ob sie sich nun gerade in einer Beziehung befanden oder nicht. Wir alle kämpften mit denselben Fragen, und viele von uns fühlten sich ebenfalls gelähmt von dem Druck, große Entscheidungen zu treffen, im Hinblick auf die Elternschaft sogar unwiderrufliche. Vor der riesigen, ratternden Abfahrtszeitentafel meiner Zukunft war mir nicht bewusst, dass ich dort Schulter an Schulter mit Millionen anderen Frauen stand, die sich auf ihrer eigenen Reise durch das gleiche mütterliche Dilemma befanden.
Weil wir dieser Phase keinen Namen gegeben haben, sind wir nicht ausreichend auf sie vorbereitet, wenn sie vor der Tür steht, und haben nicht die nötigen Werkzeuge entwickelt, um unseren Weg durch sie zu finden. Das ist ein Problem, wenn Frauen dann das Gefühl vermittelt wird, alles, was in dieser Zeit geschieht, läge irgendwie allein in unserer Verantwortung und müsse von uns allein angegangen, ausgehalten und aufgelöst werden. Indem wir die Körperfunktionen der Frauen mit Hilfe von Verhütung regulieren und den Männern gestatten, als ewige Teenager zu leben – mit unsicheren Jobs, kurzen Liebschaften, pubertären Hobbys –, haben wir die Last der Entscheidung, ob man sich um ein Baby bemühen solle oder nicht, beinahe ausschließlich den Frauen aufgebürdet. Wir schirmen die Männer ab vor der Realität von Fruchtbarkeit, Familie und weiblichem Verlangen, weil uns beigebracht wurde, diese Dinge als uninteressant oder unattraktiv aufzufassen. Während meiner Zwanziger und bis in meine Dreißiger habe ich mir verzweifelt Mühe gegeben, locker und sorglos zu erscheinen, da ich glaubte, auch nur eine Andeutung meiner wahren, komplizierten Sehnsüchte – in meinem Fall nach Liebe, Bindung, Unabhängigkeit, einer erfolgreichen Karriere und schließlich auch einem Baby – würden dafür sorgen, dass ich für immer Single bliebe. Ich brachte mich selbst zum Schweigen, weil ich dadurch attraktiver zu wirken glaubte. Ich versteckte meine Schwächen, meine Wünsche und meine Gebärmutter.
Natürlich unterhielt ich mich mit meinen Freundinnen, aber ich war dabei nicht immer vollkommen ehrlich, was bedeutete, dass auch sie sich mir gegenüber nicht gänzlich öffneten. Wir setzten ein tapferes Gesicht auf und taten so, als hätten wir alles unter Kontrolle, wobei wir irgendwie die Tatsache übersahen, dass wir alle im selben Zug saßen. Ohne die üblichen Hilfsmittel aus Sprache und Etiketten, um unsere Erfahrung zum Ausdruck zu bringen, wurden wir bruchstückhaft, unsicher, ängstlich und beschämt. Nun ja, damit ist jetzt Schluss. Ich bin angetreten, um die Schultern zurückzurollen, meinen BH aufzumachen und diesem Ding einen Namen zu geben.
Im Laufe der Zeit sind mir dafür reichlich mehr oder weniger förmliche Vorschläge eingefallen. Zuerst die lustigen: fruchtbare Entscheidung, Eizellroulette, Hurkrux, Ova-Panik. Dann die Metaphern aus der Natur: die Spreu vom Weizen trennen, Lakune (eine Lücke oder ein Hohlraum im Knochen), Rubikon (ein Fluss, der unmöglich zu überqueren scheint), blaue Stunde (jene magische Zeit zwischen Tag und Dämmerung). Es gibt die lateinischen Ideen: reortempus – die Zeit der Entscheidung, procogravidum – schwer von Zweifeln sein, quasitinciens – mit Fragen schwanger gehen. Und zuletzt sind da noch die möglichen deutschen Komposita: Fastschwanger, Wechselperiode, Trockenlegen. Allesamt passend und besser als gar nichts, aber keins von ihnen beschwört die erstickende, heranschleichende, verwirrende Natur dieses Biests herauf. Als würde ich eine neu entdeckte Blume oder ein giftiges Kraut klassifizieren, gebe ich ihm am Ende den Namen »der Fluss«: eine körperliche und emotionale Transformation, die am Boden der Panikjahre heranwächst. In der Landschaft bedeutet »Fluss« das Fließen von Wasser, in unserem Körper ist es das Ausstoßen von Blut, in der Physik ist es ein Zustand beständigen Wandels. Der Fluss ist die Lücke zwischen Jugend und mittleren Jahren, in der Frauen jenen konstruierten Kunstgriff der Kontrolle über ihr Leben verlieren, sich mit ihrer Fruchtbarkeit auseinandersetzen und sich selbst neue Identitäten errichten. Der Fluss ist ein spezifischer Prozess, ausgelöst von Biologie, Gesellschaft und Politik, der so viele von uns durch die Panikjahre treibt wie, nun ja, Besessene.
Das hier ist eine Anatomie meiner eigenen Panikjahre. Dieses Buch ist kein Ratgeber, der erklärt, wie man den richtigen Mann findet, seinen Traumjob bekommt oder lernt, sich selbst zu lieben, schwanger zu werden oder am besten ein Kind großzuziehen. Es geht darum, was geschieht, wenn man sich dem teuren Besteck und der abgestimmten Bettwäsche des Erwachsenenlebens nähert und sich fragt, ob man ein Baby bekommen sollte, ob man nur deshalb eins will, weil man dazu erzogen wurde, oder ob man überhaupt in der Lage wäre, eins zu bekommen. Es geht um den Versuch, sich eine Karriere aufzubauen, ehe man sich in die Elternzeit verabschiedet, es geht darum, sich nach Stabilität zu sehnen, während sich der eigene Freundeskreis in Eltern und Nicht-Eltern aufteilt, es geht darum, nicht nur nach einem Freund oder einer Freundin Ausschau zu halten, sondern nach einem potenziellen Elternteil für das theoretische eigene Kind, es geht um Fruchtbarkeit, Genderungleichheit und gesellschaftliches Stigma. Es geht darum, weshalb man sich dabei erwischt, panische Berechnungen anzustellen: Wenn ich jemanden kennenlerne und erst mal ein Jahr mit ihm zusammenbleibe, und dann brauche ich zwei Jahre, um schwanger zu werden, aber wenn ich nun diesen Job anstrebe, und wenn ich mit dreizehn meine Periode bekommen habe und die Eizellen meiner Mutter mit vierzig verbraucht waren … bis man plötzlich nicht mehr rechnet, sondern sich eine unverblümte, schlichte und niemals abgeschlossene Frage stellt: Wer bin ich, und was will ich vom Leben?
Es geht um eine zweite Jugend, in der man nicht anfängt zu bluten und Brüste bekommt, sondern Selbsterkenntnis, Reife und Ernsthaftigkeit gewinnt. Ich will also das allgemeine Argument vorbringen, dass diese Zeit Anerkennung verdient, und zu diesem Zweck bringe ich ein persönliches Argument vor, indem ich meine eigenen Panikjahre wiedergebe, wie ich sie erlebt habe und noch immer erlebe. Ich beschreibe, wie ich mich von einer alleinstehenden, bindungsscheuen Mitbewohnerin durch Herzschmerz, Liegestütze, den Geruch von Schuhcreme, einen Besuch in einem Nonnenkloster, einen Sommer in Berlin, Schwangerschaft, Geburt, ein ausgesprochen unglückliches Busfenster und so vieles mehr in eine ausgewachsene Mutter mit flachen Stiefeln verwandelt habe. Ich werde darlegen, wie der Fluss meine Freundschaften, meine Beziehung, meine Umwelt, meine Gedanken, meine Arbeit und meine Fähigkeit, meinen Körper zu bewegen, beeinflusst hat. Zum ersten Mal gebe ich dem Fluss einen Namen und durchschreite ihn, Schritt für Schritt.
In meinem Fall begannen die Panikjahre auf einer Hausparty, als ich bei Freunden in Liverpool zu Besuch war, ein silbernes Kleid trug und in der auseinanderfallenden Küche einer toten Vermieterin stand, deren Mieter ihre Asche in einen Eckschrank gestellt und Teppiche über die verrotteten Dielen geworfen hatten. Meine Periode war einen Monat überfällig, und ich wachte an den meisten Tagen um halb fünf Uhr morgens auf, den Mund voller Angst und Übelkeit. Ich hatte meinen Freund zu Hause gelassen, um meine Freunde zu besuchen. Als ich mich in der grünen Küche umsah, ergriff ein Gedanke von mir Besitz, der seit Wochen allem zugrunde gelegen hatte: Ich könnte schwanger sein. Ich wollte nicht schwanger sein. Nicht so, nicht jetzt. Ich wollte nicht auf diese Weise gefangen sein. Das wurde mir damals mit einer Klarheit bewusst, die mir Angst einjagte. Mein Körper sagte mir, noch bevor mein Geist es realisiert hatte, dass ich unglücklich war. Meine Gebärmutter hatte ein Leuchtsignal abgesendet, und ich sah pflichtschuldig zu, wie es verglühte. Einen Monat später war ich Single, in Wirklichkeit doch nicht schwanger, saß in einem schäbigen Café in Walthamstow und feierte meinen achtundzwanzigsten Geburtstag allein über einer Tasse Instantkaffee.
Ohne den Anker eines Partners schleuderte ich mich in eine Welt aus Arbeit, Partys, Schweiß, Deadlines, Laufen, Reisen und Zigaretten. Ohne das Gegengewicht aus Liebe und mit dem explosiven Ehrgeiz einer jungen Journalistin stellte ich fest, dass ich zu allem ja sagen konnte. Tatsächlich war es so: Je öfter ich ja sagte, desto weniger musste ich denken. Ein ganzes Jahr lang lautete meine einzige berufliche Regel, absolut jeden Auftrag anzunehmen, den ich angeboten bekam. Außerdem ging ich zelten, hatte Sex mit Männern, die mich nicht lieben konnten und die ich nicht lieben konnte, bot Zeitungen, zu denen ich mein ganzes Leben aufgeschaut hatte, Artikel an, ging an windigen Stränden schwimmen, schrieb mir die Seele aus dem Leib, fragte mich, ob ich überhaupt wirklich ein Baby wollte, weinte tagelang vor meiner Periode, nähte Kleider, trat im Radio auf, schnitt mir das Haar und hörte meine Platten.
Eines Morgens, im gesprenkelten Grau des frühen Bewusstseins, wachte ich mit dem Geschmack von etwas Vertrautem auf der Zunge auf, wie den Fetzen eines Liedes, das man in der Schule gesungen hat. In meinem eigenen Schlafzimmer, unter meinen eigenen Bildern, unter meiner eigenen Bettdecke, die nach meinem eigenen Waschpulver roch, erinnerte ich mich endlich daran, wer ich war.
Schön und gut, nur war ich zu diesem Zeitpunkt dreißig, und meine Freundinnen, die bis dahin mit mir Toast gegessen und Tee getrunken hatten, während wir uns das Herz aus dem Leib rissen und der Zeit ins Gesicht lachten, packten plötzlich ihre Taschen und waren fort: Partner, Häuser, Verlobungsringe, Hochzeiten, Schwangerschaften, Babys. Der Wettlauf war eröffnet – gegen die Zeit, gegen unsere Körper, gegen die Halbwertzeit von Spermien und unweigerlich auch gegeneinander. Ich wusste, weil ich selbst dabei gewesen war, dass meine Mutter früh in die Wechseljahre gekommen war – mit vierzig –, daher hatte ich vermutlich noch weniger Zeit geerbt als meine Freundinnen. Meine Deadline war früher. Infolgedessen waren meine Panikjahre besonders intensiv, mein Sprint in Richtung Sicherheit akuter, mein Bedürfnis, alles geregelt zu bekommen, ziemlich extrem. Dennoch hatte ich aus irgendeinem Grund die Ansage noch nicht gehört, hatte noch nicht einmal mein Ticket gekauft. Die Menschen, die ich am meisten liebte, glitten davon, während ich wankend zurückblieb.
Weniger als zwei Jahre später war ich verliebt. Dieser Mann, mit Schultern wie ein Baugerüst und einem Kinn wie eine Gartenschaufel, trat unerwartet, unvorhergesehen und unangekündigt in mein Leben. Ganz mir nichts, dir nichts war ich in den Zug eingestiegen. Ich kannte sein Ziel nicht, aber ich wusste, dass ich irgendwohin unterwegs war. Was ich mir als Lösung für meine innere Unruhe ausgemalt hatte, führte allerdings lediglich zu noch mehr Fragen. Großen Fragen. Für jede Frau, die während der Panikjahre eine neue Beziehung beginnt, ist die Zukunft durchlöchert von jenen existenziellen Entscheidungen, die einen in die Knie zwingen können. Was bedeutet es für eine berufstätige Frau, in einem Land mit unerschwinglichen Preisen zu wohnen, das auf ein Klimadesaster zusteuert, wenn sie sich an einen Partner bindet oder gar an ein zukünftiges Kind? Wie reagiert man, wenn die beste Freundin verkündet, dass sie schwanger ist? Liegt vor einem selbst ein anderer Weg? Was, wenn der eigene Partner keine Kinder will? Oder wenn er Kinder will, bloß noch nicht jetzt, nicht sofort, nicht auf diese Weise? Ist dies der richtige Zeitpunkt, um das Land zu verlassen, einen neuen Karriereweg einzuschlagen, sich einen wahnsinnig teuren Mantel zuzulegen, auf alles zu scheißen und mit jemandes Bruder zu schlafen, irgendwo ein Haus zu kaufen, wo es billig ist, und freiberuflich zu arbeiten? Sollte man einen Hund anschaffen?
Als würden einem die Zähne aus dem Kiefer gebrochen und der kalte Wind über jeden bloß liegenden Nerv fegen, erkennt man, dass man erneut die Kontrolle verloren hat. Der eigene Körper wird durch Verhütung in einem Zustand künstlicher Unfruchtbarkeit gehalten, während der Geist durch all die verlorenen Zukunftsmöglichkeiten rast. Man sitzt zwar im Zug, hat aber vergessen nachzusehen, wohin er unterwegs ist, und nun gleitet die Welt verschwommen an einem vorbei. Liebe kann nichts gegen den Fluss an Eizellen ausrichten, die den eigenen Körper verlassen, ein warmes Bett hilft einem nicht bei der Entscheidung, was man beruflich machen will, ein Partner beendet nicht den Bürgerkrieg zwischen Gehirn und Gebärmutter, ein Plus One gibt einem nicht unbedingt das Gefühl von Vollständigkeit. Drei Jahre nach dem Ende meiner letzten Beziehung wurde mir erneut etwas Schmerzhaftes und Wahres bewusst: Die Panikjahre enden nicht mit Sex oder gemeinsamen Handtüchern, sie werden nicht einfach zum Schweigen gebracht durch das Gewicht eines weiteren Körpers im eigenen Bett.
Während ich durch mein Leben schlitterte, Beziehungen beendete, versuchte, mehr Geld zu verdienen, meine Mietwohnung mit geliebten Freundinnen teilte, zur Therapie ging, meinen Körper kräftigte und mit zunehmend netteren Menschen Sex hatte, war für mich absolut nichts erkennbar, was diese Entscheidungen zusammenhalten würde. Nun, da ich in meine Mittdreißiger vordringe und mich von all dem Staub und den Dramen entferne, die meine Weitsicht trübten, erkenne ich, wie die Mutterschaft als Erwartung die ganze Zeit über mir schwebte. Sie war mein Motor gewesen und hatte mich zum Abschuss bereit gemacht. Natürlich. Während der gesamten Panikjahre beendeten mein Körper und Geist unbewusst mein altes Leben, um den Weg für ein neues zu ebnen, in dem ich mich, sofern ich es wollte, für den Versuch entscheiden konnte, ein Baby zu bekommen. Wie Luke Turner in seinem wunderschönen Memoir Out Of The Woods schreibt: »Die Entscheidung, die Grundlagen eines Lebens zu sprengen, wird stets Trümmer in alle Richtungen schleudern.« Denn, so zögerlich ich es auch erkannt und vor den wichtigen Menschen zugegeben haben mag, ich wollte wahrscheinlich schon immer ein Baby.
Während ich hier sitze und an einem Laptop tippe, der auf dem Wickeltisch meines Babys balanciert, ist mir bewusst, dass ich dieses Buch in vielerlei Hinsicht für die achtundzwanzigjährige Nell schreibe, die in ihrem silbernen Kleid neben der Urne einer fremden Frau in jener Küche in Liverpool stand und der ganz schlecht vor Panik darüber war, was als Nächstes geschehen mochte. Aber eigentlich schreibe ich dieses Buch für alle: für jene, die gerade in ihren Fluss steigen, für jene, die mittendrin stecken in der Verwirrung, für jene, die mehr über Mutterschaft erfahren wollen, ob sie sich selbst nun darin sehen oder nicht, für jene, die das alles bereits durchgemacht haben und sich darin wiedererkennen möchten, und für die Männer und Frauen, die einfach nur wissen wollen, wie die Panikjahre sind. Ich gebe nicht vor, eine ginbeduselte Partynudel zu sein, ich schreibe keine akademische Abhandlung, und ich nutze keine experimentellen literarischen Formen, um zu beweisen, dass auch Mütter kreativ sein können. Ich zeige einfach nur so ehrlich und bedeutungsvoll ich kann, wie diese Zeit aussehen mag: Warum eine Party zum dreißigsten Geburtstag sich wie eine Ein-Personen-Hochzeit anfühlen kann, wie es als einziger Single bei einer Abendgesellschaft ist, wie man es verkraftet, in einem sehr kleinen Zelt sexuell abgewiesen zu werden, weshalb man möglicherweise versehentlich losheult, wenn der Chef einen fragt, wo man sich in fünf Jahren sieht, wie es sich anfühlt, seine Periode zu bekommen, wenn man hofft, schwanger zu sein, das Fieber, das einen befällt, wenn man sich entscheidet, zu versuchen, ein Baby zu bekommen, wie es ist, wenn man sich vorstellt, jenes Baby an die Wand zu schmeißen.
Dieses Buch wird die donnernde Libido der Dreißigjährigen feiern, die sich gemeinsam mit einem Verschwörungstheoretiker und seinen Geheimratsecken einen Berg hinaufschleppt. Wie es sich anfühlt, durch die eigene Ambivalenz gegenüber der womöglich größten Entscheidung des eigenen Lebens zu waten. Die spitzengesäumte Hölle der Babypartys anderer Menschen. Das Gefühl, in einer tropfenden Toilette auf ein Stäbchen zu pinkeln und seine gesamte Zukunft auf vier Zentimetern säurehaltigem Papier in der Hand zu halten. Dieses Buch wird sich auf die Schultern all jener Augenblicke stellen und fragen: Wo sind wir, und wie sind wir hierhergekommen? Wie befreien wir uns von unserer gesellschaftlichen Konditionierung, warum enden Beziehungen, wieso heiraten Menschen noch immer, wann wird aus einem Fötus ein Baby, wie hoch ist das richtige Gehalt, was ist eine Familie, welche Bedeutung hat der fünfunddreißigste Geburtstag, und wie sollen wir die Verantwortung für die Verhütung aufteilen? Da das Gewicht all dieser und noch mehr Fragen Frauen in ihren Zwanzigern, Dreißigern und Vierzigern auf die Schultern kracht, ist es höchste Zeit, nach Antworten zu suchen.