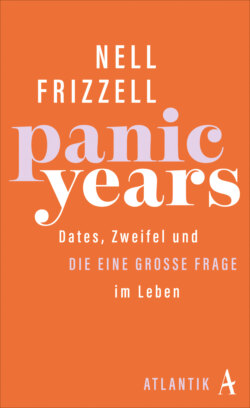Читать книгу Panic Years - Nell Frizzell - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Plötzlich Single
ОглавлениеIch liege auf dem Bett meiner Großmutter und lausche den Kirchenglocken und dem Fernsehmoderator Noel Edmonds.
Selbstverständlich ist es nicht das eigentliche Bett meiner Großmutter. Es ist nicht jener Ort, an dem ich am Weihnachtsmorgen meinen Strumpf auspackte – der Strumpf, der tatsächlich eine alte Stützstrumpfhose meiner Großmutter war, in irgendeiner Schattierung von »Nerz« oder »Bambus«.
Nein, es ist ein anderes Bett – ein Einzelbett in der Farbe einer Prothese, das in einem kleinen Zimmer auf dem Dachboden ihres Pflegeheims versteckt ist. Nach Jahrzehnten der Landwirtschaft mit Viehbestand, Labradoren, Apfelbäumen und sprudelnden Bächen lebt meine Großmutter nun in einem Einzelzimmer mit Blick auf Schieferdächer, umgeben von Ziegelsteinen. Sie verbringt die letzten paar Jahre ihres Lebens in einer Stadt – ein Ort, den sie in den ganzen vierundneunzig Jahren ihrer Existenz zuvor nicht betreten hat. Für mich ist es großartig: Ich kann mit dem Zug hinfahren, in einem Café am Markt zu Mittag essen und bei Savers vorbeischauen, um ihr noch mehr Nivea-Körperpuder zu kaufen. Nicht, dass ich heute irgendetwas von diesen Dingen tun würde.
Heute liege ich auf ihrem Bett. Ich liege auf der Seite zusammengerollt und starre auf ihren weißen Schrank voller Faltenröcke aus Tweed, cremefarbener Satinblusen und flauschiger ausrangierter Pantoffeln. Aus dem kleinen Fernseher in der Ecke ertönt Deal or No Deal wie ein pfeifender Teekessel. Auf einem Tablett steht eine Schüssel voller Satsumas neben einem Stapel ungelesener Shropshire Stars, Wochenendbeilagen und einem Buch über die Royals. Im Zimmer unter mir bewegt sich ein Mann in der Form eines Liegestuhls ächzend auf die Tür zu, wobei seine Jogginghose an seinem hutzeligen Hintern hinunterrutscht und eine weiße Kinderunterhose entblößt. In der Küche schaufelt der Koch Kartoffelbrei neben ein Ei und Kressesalat und hört dabei Magic FM. Im Wohnzimmer dösen zwei Damen in Strickjacken und Karottenhosen vor dem Fernseher, während sich eine Kochshow auf magische Weise in ein altes Schwarz-Weiß-Musical verwandelt. Im Garten raucht eine der jüngeren Bewohnerinnen eine Zigarette von der Länge eines Strohhalms und beobachtet, wie ein Rotkehlchen an einer fetten Kugel pickt.
Ich weine nicht. Ich habe jenes leere Stadium reiner Taubheit erreicht, in dem man wie an einem stillen See sitzend einfach ins Nichts schauen kann. Ich denke, dass ich wohl für immer hier liegen bleiben werde. Meine Muskeln werden verkümmern, mir werden Barthaare wachsen, von Zeit zu Zeit wird jemand hereinkommen und mir ein frisches Nachthemd anziehen, ich werde Vanillepudding essen und Sherry trinken. Ich werde im Schlafzimmer meiner Großmutter liegen wie die Schicht aus Talk und Taschentüchern, die das Innere ihrer Handtasche auskleidet. Ich werde hierbleiben, bis alles besser ist, alles vorbei, alles beendet.
Zwei Wochen zuvor lag ich mit meinem Freund der letzten sechs Jahre im Bett, während er sanft und gründlich mein Leugnen des Zustands unserer Beziehung zerbrach wie eine Handvoll Stöckchen.
»Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir eigentlich noch gemeinsam verbringen würden, wenn wir nicht ausgingen«, sagt er.
Knack.
»Du bist immer beschäftigt.«
Knack.
»Ich glaube, du willst nicht mit mir zusammen sein.«
Knack.
Die Nacht hält den Atem an, während ich dort wach liege und mich so entblößt fühle, als hätte mir jemand die Haut vom Körper gezogen. Diesen Mann anzufassen, diesen Bären in Menschenkleidung, fühlt sich auf einmal unzulässig an, wie ein Verstoß, als würde man die Hand in jemandes Hosentasche stecken. Also liege ich still. Nach sechs Jahren, in denen er sich um mich gekümmert hat, hilft er mir nun schon wieder. Bloß hilft er mir diesmal dabei, mit ihm Schluss zu machen. Er sagt mir, ich solle mir ein paar Tage Zeit nehmen, ich solle mir keine Sorgen machen, es würde alles gut werden, aber ich solle darüber nachdenken, ob ich mich von ihm trennen wolle. Am Morgen klammere ich mich an ihn wie an ein Rettungsboot, weine verstört und verspreche ihm, ich wolle nicht, dass sich irgendetwas ändere. Aber zugleich breitet sich eine leise Stimme in meinem Kopf aus wie ein Tropfen Tinte in einem Glas Wasser und sagt mir, dass sich bereits etwas verändert hat. In den kommenden zwei Tagen sind wir uns näher als in den Monaten zuvor: Wir reden, sitzen zusammen, essen gemeinsame Mahlzeiten, legen füreinander die Wäsche zusammen. Ich betrachte seinen Rücken, groß wie eine Matratze, während er spült.
Ich sage ihm, dass ich ihn liebe, aber nicht aufgeregt bin. Ich glaube, dass ich etwas will, aber ich weiß nicht, was.
Er blickt nach unten. »Natürlich bin ich nicht aufregend«, erwidert er. »Ich bin der Mann, mit dem du dir eine Waschmaschine gekauft hast. Dieser Typ ist für niemanden aufregend.«
Mein Herz fällt auseinander wie eine Pusteblume im Regen.
Und so trennen wir uns. Natürlich tun wir das. Ich habe noch nie von einem »Werden wir uns trennen?«-Gespräch gehört, das nicht mit einem »ja« endete. Ohne es zu wissen fiel ich durch einen Riss in dem Stoff, der plötzlich mein altes Leben war, und landete kopfüber und rasend schnell in etwas anderem: dem Fluss. Wie so viele Tausende Kinder nach einer Trennung ziehe ich zu meiner Mutter, während er seine Sachen packt. In meinem Fall bedeutet das drei Haltestellen der Busroute 48 auf die andere Seite des Flusses Lea. Auf dem Weg zur Arbeit komme ich mit dem Fahrrad an unserer Wohnung vorbei und sehe, dass er all seine Bilder von der Wand genommen und auf dem Fußboden gestapelt hat. Die Wohnung wirkt nun entblößt, unpersönlich und unerträglich traurig.
Wenn man seine gesamten Zwanziger mit einer Person verbracht hat – zuerst befreundet, dann als Liebespaar, dann als Gefährten –, kann es ein kleiner Schock sein, zu erkennen, dass man absolut keine Ahnung hat, wer man ohne diesen Menschen ist. Was man isst, wann man schläft, wen man kennt, was man besitzt, wie man redet, was man sich anschaut, wo der Staubsauger steht, um wie viel Uhr man aufsteht, was man an seinem Geburtstag macht, was man lustig findet, ob einem das eigene Besteck gefällt, ob man sein Fahrrad reparieren kann, wie man seine Arbeit erledigt, wie man sich kleidet, wem man vertraut, was man hört, woran man sich erinnert, sogar schlicht, was man mag – von alldem weiß man nichts mehr. Man hat keine Ahnung, wer man ist, weil man den größten Teil seines Erwachsenenlebens mit einem anderen Menschen zusammen gewesen ist. Sein Geschmack wurde zum eigenen Geschmack, wurde zu seinem, wurde zum eigenen, wurde zu einem selbst, wurde zu ihm. Ich war für ungefähr sechs ganze Monate eine unabhängige berufstätige Frau gewesen, ehe ich mit meinem Freund zusammenkam. Ich war ungebrannter Ton. Als wir uns also genau an meinem achtundzwanzigsten Geburtstag trennten, hatte ich kaum ein Erwachsenenselbst, zu dem ich zurückkehren, auf das ich zurückgreifen oder bei dem ich Trost finden konnte. Mein Ich lag Jahre zurück, hatte jahrelang den Anschluss verloren. Kein Wunder fühlte ich mich wie gelähmt, überwältigt und losgelöst: Ich war verloren.
Dabei hatte ich nicht nur mich selbst verloren. O nein. Ich hatte auch seine Familie verloren – seine ältere Tante mit dem Kaminsims voller Vögel und seine Mutter mit ihrer Strickliesel und ihrer Vorliebe für Sechziger-Jahre-Motown –, ich hatte seine Freunde verloren, ich hatte seine Fähigkeiten, seine Hilfe, seine Werkzeuge und Handtücher und Fußmassagen verloren, ich hatte seine Version von mir verloren und all unsere gemeinsamen Zukunftsvorstellungen. Indem ich mich von einem Mann trennte, mit dem ich geglaubt hatte, eine Familie gründen zu wollen, verlor ich auch meine potenziellen Kinder. Als achtundzwanzigjährige Frau, deren Mutter mit vierzig in die Wechseljahre gekommen ist, weiß man vom Körper und Kopf her besser als die meisten Menschen, dass es nur ein begrenztes Zeitfenster gibt, in dem man Kinder bekommen kann. Das ist halbwegs erträglich, solange man einen Partner hat, denn auch wenn man noch nicht ganz bereit oder sich noch nicht ganz sicher ist, kann man sich doch zumindest damit beruhigen, dass man über das nötige Equipment verfügt, wenn es dann zu einer Entscheidung kommt. Man kann noch warten. Zumindest für eine Weile. Aber als achtundzwanzigjährige Frau, die sich mit gebrochenem Herzen in die weite Prärie des Singlelebens schleppt, ist diese endliche Zeit auf einmal eine ganz andere Aussicht. Sie kann beängstigend sein. Sie kann sich tödlich anfühlen. Und die Berechnungen, die am Horizont auftauchen, bekommen ein extremes Gewicht.
Sollte sich meine Menopause wie bei meiner Mutter bereits mit vierzig ankündigen, dann könnte meine Fruchtbarkeit in meinen Mittdreißigern beträchtlich abnehmen. Das hieß, dass ich wahrscheinlich vor meinem fünfunddreißigsten Geburtstag mit dem Versuch starten müsste, ein Baby zu bekommen – und dabei herausfinden, ob ich überhaupt fruchtbar war. Wenn ich dann Probleme hätte, würden mir noch ein paar Jahre bleiben, um die Alternativen auszuprobieren. Aber wartet mal, wenn ich vor meinem fünfunddreißigsten Geburtstag versuchen wollte, ein Baby zu bekommen, dann hieße das, ich müsste jemanden kennenlernen, und zwar speziell jemanden, der sich in mich verlieben und mit mir eine Familie gründen wollte, bis ich, was, zweiunddreißig war? Dann hätten wir noch zwei Jahre, die wir gemeinsam als Paar genießen könnten, ehe wir anfingen, mit Vorsatz zu vögeln. Das würde uns ein paar schöne Erinnerungen verschaffen, von denen wir später zehren könnten, wenn wir übernächtigt, überfordert und voller Verbitterung wären. Aber wartet mal, ich hatte siebzehn Jahre gebraucht, um meinen ersten Freund zu bekommen, und danach dreieinhalb Jahre, um meinen zweiten kennenzulernen. Wenn man sich daran orientieren konnte, lägen nun noch mindestens drei Jahre Singledasein vor mir. Damit wäre ich bei was, neunundzwanzig? Aber Moment, fast jeder lebte mindestens mal zwei Jahre lang unabhängig, hatte Sex mit unterschiedlichen Leuten und konzentrierte sich auf seine Arbeit, ehe er ernsthaft mit der Partnersuche begann. Dieser Rechnung zufolge hätte ich mit meinem Freund Schluss machen müssen, als ich siebenundzwanzig war. Ich würde also um eine sechsjährige Beziehung trauern müssen, während ich bereits ein Jahr im Rückstand war. Irgendwie musste ich es schaffen, mein Leben zu leben, unabhängig zu sein, Sex mit jemandem zu haben, ohne ihm in den Mund zu heulen, mich zu verlieben und darauf zu warten, dass er bereit für den Versuch der Familiengründung war, und das alles musste ich sofort tun, sonst würde mir die Zeit davonlaufen, und ich würde nie die Wahl haben: Mein Körper und die begrenzte Zahl meiner Eizellen würden mir die Entscheidung abnehmen, ehe ich auch nur die Gelegenheit hätte, es zu versuchen.
Seit jenem Wochenende glaube ich fest daran, dass alle Frauen mit einem gebrochenen Herzen, aber insbesondere jene, die gerade in ihren Fluss steigen, einen einwöchigen Aufenthalt in einer Institution spendiert bekommen sollten, wo alle anderen einfach zu alt und erschöpft sind, um noch über Babys, Liebe oder Herzschmerz zu reden. Wir sollten augenblicklich in ein großes halbkommunales Gebäude eingeliefert werden, in dem die Nähe des Todes ein gebrochenes Herz lächerlich erscheinen lässt und die sanfte Mischung aus Seife, Binden, Mahlzeiten, Nickerchen und Bettruhe vollkommen von uns Besitz ergreifen kann. Während einer Trennung gibt es eine Zeit der Analyse und eine Zeit der Paralyse: Jene ersten Wochen gehören fast ausschließlich zur Letzteren. Man ist noch nicht bereit, genauestens zu sezieren, was schiefgegangen ist. Im Grunde kann man nichts weiter tun, als dafür zu sorgen, dass man nicht auseinanderfällt, und auf den eigenen Herzschlag zu hören. Später bleibt noch genügend Zeit, um das Ende einer Beziehung mit Freundinnen, Familie, vielleicht sogar professionellen Zuhörern zu verarbeiten, diskutieren und auseinanderzunehmen. Man kann das Ganze nicht auf einmal schlucken, weshalb beginnt man also nicht damit, erst mal nur seine Wunden zu lecken? Wieso nimmt man sich nicht ein wenig Zeit, um seinem realen Leben zu entfliehen? Und wo könnte man sich selbst besser pflegen als in einem Pflegeheim?
Ihr mögt euch fragen, weshalb ich als frischgebackene Singlefrau in London so viel Trost bei den pastellfarbenen Vorhängen, Badezimmerdesinfektionsmitteln, Lockenwicklern, Lokalradiosendern, Taschenbüchern, Faltenröcken, Standuhren und Thrombosestrümpfen eines Pflegeheims in der Provinz fand. Wieso ich mich so bereitwillig dem gleichmäßigen, gemächlichen Stundenplan aus Mahlzeiten, Ruhezeiten, Singalongs und Tablettenvergabe unterwarf. Warum ich eine dermaßen tiefe Ruhe empfand, als ich in die bei neunzig Grad gewaschene Bettwäsche meiner unermüdlichen Großmutter sank oder über den unbetretenen Rasen hinausblickte. Die Antwort ist einfach: Für alle anderen in diesem großen roten Backsteinhaus auf dem Hügel war das schreckliche, drängende Pulsieren von Möglichkeit und Fruchtbarkeit längst zum Schweigen gebracht worden. Ihre biologischen Uhren waren stehen geblieben. Sie hatten diese Option nicht mehr. Ihre Arbeit war getan. Ihre Freundschaften verabschiedeten sich nach und nach. Ihr Fluss war lange versiegt. Jene Frauen hatten ihre Kinder entweder bekommen oder nicht. Sie hatten geliebt, geblutet, geschwitzt, waren ausgelaufen und hatten verloren, und nun begannen ihre letzten Lebensjahre. Ihre Körper vertrockneten, wurden blass und dünn bis zum Verschwinden. Ihre pergamentene Haut, ihr weißes Haar, ihre dicken Zehennägel und bröckelnden Zähne waren die greifbaren Manifestationen der Zeit, unbestreitbar und unaufhaltsam. Womöglich spürte ich eine anschwellende Flut der Hoffnungslosigkeit gegen meine Rippen drücken, wenn ich an die Zukunft, die Familie und das theoretische Leben dachte, die ich gerade verloren hatte, aber all das war nichts, was diese Leute hier nicht auch hatten bewältigen können. Mein gebrochenes Herz war weder einzigartig noch beispiellos oder weltverändernd. Ich folgte einfach dem zerbröckelten Pfad so vieler vor mir, die versucht hatten, von Liebe zu Liebe zu gelangen, ohne dazwischen zu oft in den Schlamm zu treten.
Was nicht heißen soll, dass jene Frauen unfreundlich oder nicht mitfühlend gewesen wären. Einige von ihnen waren wundervoll. Bei einem Besuch einige Monate später ging ich gerade zwischen Sherry und Mittagessen durch den Speisesaal, als eine zweiundneunzigjährige Lettin namens Elsa mich plötzlich an der Hüfte packte.
»Mein Liebes!«, rief sie und fixierte mich mit ihren dunkelblauen Augen. »Du erinnerst mich an die Gypsy-Frauen, von denen ich in der Kunsthochschule Aktbilder gemalt habe!«
Ich fühlte mich geschmeichelt. Wie ich später herausfand, hatte Elsa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Paris bildende Künste studiert – zu einer Zeit, als es für anständige Frauen als unschicklich galt, nackt zu posieren. In ihrem langen Leben hatte sie über Gastronomie geschrieben, zwei Söhne geboren, Kleider geschneidert, drei Sprachen gesprochen und großartige Dinnerpartys gegeben. Ihr Körper mochte zusammengefallen sein wie ein Soufflé, aber diese Frau war voller Leben, Humor und Freude über die Welt. In ihre bewegliche Zimtschnecke von Gesicht zu blicken und erklären zu wollen, dass ich mich durch den Verlust von Liebe, Sicherheit und meinen Zwanzigern ausgehöhlt fühlte, erschien mir wie der Versuch, sich bei einer Felswand über den Wind zu beschweren.
Es gibt eine bestimmte Art von Filmen, Popsongs oder Romanen – »I Will Survive«, Muriels Hochzeit –, in denen die Trennung von einem unpassenden Partner das Ende der Geschichte darstellt. Singleleben, Freiheit und Unabhängigkeit sind das Happy End für alle, von Hochschulabsolventinnen in ihren Zwanzigern bis zu achtundsechzigjährigen Geschiedenen. Wir sehnen uns nach einem ungebundenen Leben. Aber für Frauen im Fluss ist eine Trennung oft nur der Anfang der Geschichte, und »freedom’s just another word for nothing left to lose«. Wie meine Freundin, die Autorin Amy Liptrot, mir einmal in einer genialen, großbuchstabenlastigen Textnachricht schrieb: »Ich weiß noch, als ich mit meinem Berliner Freund Schluss machte und eine (jüngere) Freundin mich trösten wollte und meinte: ›Jetzt gibt es nichts mehr, was dich beschwert.‹ Und ich nur so: ›ICH WILL BESCHWERT WERDEN. GIB MIR DIE GEWICHTE. ICH BIN BEREIT.‹«
Ich wusste genau, was sie meinte. Während ich auf meine frühen Dreißiger zurutschte wie Schlamm von einer Kelle, war ich nicht etwa Single, weil ich bindungsunwillig gewesen wäre. Ich hatte gerade deshalb eine unperfekte Beziehung beendet, weil ich die Person finden wollte, die sich vollkommen auf mich und meine Vorhaben einlassen würde. So tief ich es zum Zwecke des Selbstschutzes auch unterdrückt haben mochte, wollte ich beschwert werden durch Liebe, Zukunftspläne, gemeinsamen Besitz und die dysfunktionale Familie eines anderen. Ich wollte gemeinsam ein Sofa kaufen, zusammen in den Bergen wandern, meinen Pass in eine Ablagebox stecken, die speziell zu diesem Zweck angeschafft worden war. Ich wollte eine erwachsene Beziehung mit jemandem, der sich selbst bereit fühlte, erwachsen zu sein. Natürlich dachte ich damals bloß, ich würde mit jemandem zusammen sein wollen, der Tee trank, Kreuzworträtsel löste, einen ausgewachsenen Sexualtrieb und einen Vollzeitjob hatte. Im Rückblick sind diese Eigenschaften nach wie vor eine ziemlich gute Skizze meines idealen Lebenspartners und Vaters meines Kindes. Während mein Kopf noch die Spreu aus Herzschmerz, Einsamkeit und weiblicher Panik aussortierte, heckten mein Körper und mein Unterbewusstes eine Art Masterplan aus.
»Ich weiß noch, wie ich dachte: ›Ich will nicht mit vierunddreißig immer noch total dysfunktionale Beziehungen haben‹«, sagt Dolly Alderton eines warmen Julimorgens, an dem ich in ihrer perfekten Wohnung sitze, die direkt einem französischen Nouvelle-Vague-Film entsprungen zu sein scheint, und sie über das Jahr ausfrage, in dem sie aufhörte, Sex zu haben. Dollys Bestseller Alles, was ich weiß über die Liebe war ein ehrlicher, gefühlvoller und lustiger Blick auf das Leben, die Liebe, Freundschaft und die Zwanziger. Außerdem schrieb sie mit Witz und Weisheit über ihre im Alter von neunundzwanzig Jahren getroffene Entscheidung, nicht mehr zu daten, keinen Sex mehr zu haben, Männern keine Nachrichten mehr zu schreiben und sogar – wenn möglich – nicht mehr zu masturbieren. Wer wäre also besser geeignet, um Fragen zu Sex, einem gebrochenen Herzen und dem Beginn des Flusses zu beantworten?
»Solange ich meine Haltung gegenüber Sex und Männern nicht änderte, würde ich nicht in der Lage sein, eine liebevolle, funktionierende Partnerschaft zu führen und eine Familie zu gründen«, sagt sie und beißt in einen der Bagels, die ich als Friedensangebot und Bestechung zugleich mitgebracht habe. »Es war, als wäre jener Raum so unverhältnismäßig belebt und grell erleuchtet gewesen, dass ich einfach die Tür schließen und den Schlüssel einstecken musste, in dem Wissen, dass ich später wieder dorthin zurückkehren konnte.«
Als sie achtundzwanzig wurde – ein wichtiges Jahr in den Panikjahren so vieler Frauen –, war Dolly gerade frisch getrennt, machte eine Therapie, hörte infolgedessen auf zu daten und Sex zu haben, schrieb ihr Buch und zog aus ihrer Wohngemeinschaft aus, um fortan allein zu leben. Alles innerhalb von sechs Monaten.
»Ich dachte, ich hätte einen Zusammenbruch«, lacht sie. »Ich las viel über Sexsucht, bereinigte die Dinge mit Expartnern, verbrachte viel Zeit mit den Frauen, die ich liebe, und baute die Beziehung zu meiner Familie neu auf. Im Grunde war es mein Weg, wieder ein Gefühl für mich selbst zu entwickeln«, erklärt sie.
Wie viel von dieser Arbeit, frage ich sie, stand in einem direkten Zusammenhang mit ihrem Wunsch, Mutter zu werden?
»Ich dachte definitiv über Babys nach, in dem Sinne, dass ich wusste: Vor diesem nächsten Schritt musste ich das hier erst mal geregelt kriegen«, erklärt sie und artikuliert mit beängstigender Genauigkeit ein Gefühl, das ich erst seit kurzem verstehen gelernt habe. »Viele Frauen, die ich kenne, haben ihre späten Zwanziger im Grunde wie eine Art Erholungszeit zwischen ihren Zwanzigern und der nächsten Phase ihres Lebens behandelt.«
Es mag kontraintuitiv erscheinen, keinen Sex mehr zu haben, weil man Babys bekommen möchte, aber Dolly argumentiert, um die Art von stabiler Beziehung aufzubauen, die man braucht, um die ersten Jahre mit Kind zu überleben, muss man womöglich aufhören, die Art von Sex zu haben, die einen zuvor so sehr, nun ja, ins Schwitzen gebracht hat. Hat sie sich je Sorgen darüber gemacht, dass ihr die Zeit davonläuft?
»Nein. Damals nicht«, sagt sie und blickt mir direkt in die Augen. »Aber mittlerweile mache ich mir große Sorgen. Fruchtbarkeit ist so ein schwieriges feministisches Thema, weil unsere Biologie nicht mit unserer politischen Einstellung Schritt gehalten hat. Ich würde liebend gern sagen: ›Ich brauche keinen Mann, ich brauche keine Dates, ich kann mich einfach auf mich selbst konzentrieren, mit vierzig mit den Fingern schnipsen und dann ein Baby bekommen!‹ Aber so läuft es nun einmal nicht.«
Leider.
Natürlich entspringt nicht jeder Fluss einer Trennung. Für viele Frauen kündigt sich der Fluss mitten in einer Beziehung oder während ihrer Singlejahre durch irgendein anderes bedeutendes Ereignis an – ein Umzug in ein anderes Land, ein Jobwechsel oder -verlust, zusehen zu müssen, wie ein Kollege befördert wird, eine Verlobung, eine Endometriose-Diagnose, mitzuerleben, wie die besten Freundinnen Babys bekommen oder Häuser kaufen, um nur ein paar der größten Posten anzuführen. Allerdings trennen sich tatsächlich viele Leute am Ende ihrer Zwanziger nach langjährigen Partnerschaften. Eine Umfrage ausgerechnet der Bausparkasse Nationwide zeigte, dass eine durchschnittliche Beziehung in den Zwanzigern 4,2 Jahre hält – eine Statistik, die ich 2017 las und seitdem mit mir herumgetragen habe wie die Versichertennummer und den Termin beim Zentrum für sexuelle Gesundheit, zusammengefaltet in meinem Geldbeutel.
In jener Krisenzeit in den späten Zwanzigern, wenn aus Jobs Karrieren werden, aus Mieten Kaufen wird, aus Liebhabern Partner und aus Freundinnen Mütter werden, gibt es häufig ein Minierdbeben von Trennungen, wenn die Leute noch ein letztes Mal neu würfeln, ehe sie eine große Verpflichtung eingehen. Vielleicht leben wir uns auseinander, vielleicht streiten oder betrügen wir, vielleicht verzweifeln wir am Schnarchen, Trinken, den Socken in der Küche, dem Einkaufen von Toilettenpapier, dem Schmollen beim Abendessen, dem Pläneschmieden, den ausbleibenden Plänen, dem Hass auf Pläne. Aber manchmal stehen wir auch einfach nur vor einer anderen Person und stellen mit kalter, nackter und unvermeidlicher Traurigkeit fest, dass wir uns geirrt haben. Dass wir beide eine falsche Entscheidung getroffen haben. Unter jenen Umständen ist das Beenden einer Beziehung nicht nur gesund, rechtzeitig und mutig – es könnte uns tatsächlich das Leben retten. Aber was kommt als Nächstes? Wie flickt man ein gebrochenes Herz? Wie lange braucht man, um die richtige Person zu finden? Wann ist man darüber hinweg? Wird man je wieder lieben? Was will man eigentlich vom Leben? Diese Frage treibt Priester und Doktoren in ihren Talaren quer über die Felder.