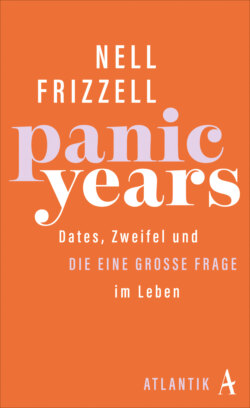Читать книгу Panic Years - Nell Frizzell - Страница 7
3 Eine Freundin in Schwierigkeiten
ОглавлениеEs gibt eine Art von Kater, der als reine Struktur zu existieren scheint: der feine Kies über den Augäpfeln, der sonnenblumenölige Glanz auf der Stirn, der Teppichboden, der aus einem Arbeiterverein gerissen und einem auf die Zunge gelegt wurde. Diesmal war es der Kies, der mich fertigmachte.
Ich saß in einem Café in Liverpool, beobachtete die Menschen, die an einem hellen Sonntagmorgen über die Bold Street spazierten, und versuchte verzweifelt, etwas Feuchtigkeit zurück in meine Augenhöhlen zu reiben. Meine Freundin auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches erzählte von ihrer neuen Mitbewohnerin, während ich die Ausbuchtungen unter meinen Lidern drückte, rollte und quetschte, als würde ich Pizzateig kneten. Das Sonnenlicht war von diesem speziellen dunstigen Weiß, das anscheinend nur vorkommt, wenn man die Nacht zuvor rauchend an einem Feuer verbracht hat, umgeben von Menschen in Glitter, Gin trinkend. Oberflächlich ging es mir gut. Ich war wach. Sogar fröhlich. Nur ein bisschen spröde, etwas trocken an den Rändern. Auf jeden Fall zu körnig in den Augen. Irgendwann, bevor mein Kaffee kam, erwog ich, mich auf den Fußboden zu legen und einen vorbeikommenden Kellner zu fragen, ob er mir einfach ein Glas Wasser direkt auf die Iris schütten könne, aber nach drei Schlucken war es schon besser. Meine Stimme klang wie eine Baustelle, meine Haut sah aus wie Frischkäse, an meiner Ferse befand sich eine Blase in der Größe eines Wasserbetts, und meine Zähne waren mit einer Schicht Spachtelmasse bedeckt. Aber mir gefiel es eigentlich, die Welt wie durch Tupperware zu betrachten. In der vorangegangenen Nacht hatte ich mit einer Gruppe männlicher Cheerleader getanzt, in einem mitternachtsblauen Overall mit riesigem pinkfarbenem Kragen, den ich eine Woche zuvor auf meinem Küchenfußboden gezaubert hatte. Ich war nun seit über einem Jahr Single und trug ständig Elasthan-Overalls.
Träge fragte ich mich, weshalb meine Freundin um zehn Uhr morgens Kuchen bestellte, wieso sie am vorigen Abend früh nach Hause gegangen war, und warum sie Saft statt Tee trank. Ich fing wieder an, ihr zuzuhören, ließ meinen Rücken gegen die Holzleisten meines Stuhls krachen und fragte sie, ob sie sich amüsiert habe.
Sie zog eine Haarsträhne hinter dem Ohr hervor, wickelte sie sich um den Finger und begann, sich damit geistesabwesend über die Wange zu streichen. »Jaa, klar. Ich bin nur ein bisschen müde geworden.«
Eine Pause entstand. Ihre Worte schienen auf Grund zu laufen wie ein Boot auf Kies. Mein Herz überschlug sich.
»Weil ich schwanger bin.«
Mein Gesicht wurde zu Sand und glitt direkt von meinem Kopf.
Wenn euch nicht der zweifelhafte Segen zuteilwird, als erste Person, die ihr je getroffen habt, schwanger zu werden (in diesem Fall: Herzlichen Glückwunsch, mein Beileid, hoffentlich mehr Glück beim nächsten Mal), ist eines der untrüglichen Kennzeichen der Panikjahre jener Tag, an dem ihr herausfindet, dass eine eurer guten Freundinnen schwanger ist. Ich spreche von guten Freundinnen, weil andere Leute natürlich andauernd schwanger werden. Jene Tochter der Freundin eurer Mutter, die so viele Halsketten trägt – sie wird schwanger, wenn ihr noch auf dem College seid. Diese Frau, die ihr Mittagessen in ein Tuch gewickelt mit zur Arbeit brachte und Bouillon statt Tee als Heißgetränk zu sich nahm – ihr findet irgendwann beim Ausgehen heraus, dass sie schwanger ist. Jene alte Chefin, die Senf- und Mayonnaisetüten in ihrer Schreibtischschublade aufbewahrte – sie wird schwanger, nachdem ihr gerade das erste Jahr freiberuflich gearbeitet habt. Das Mädchen, dem ihr mal nach dem Sportunterricht euer Deo geliehen habt – sie ist vor dem Ende der Oberstufe schwanger. Die Nichte von jemandem, mit dem euer Vater Gitarre spielt und der mal versucht hat, aus Bananenschalen einen Joint zu bauen – die ist ebenfalls schwanger.
Diese Schwangerschaften bedeuten einem in etwa so viel oder wenig wie irgendjemandes neues Gartenhäuschen. Aber wenn es eine der besten Freundinnen betrifft, eine der Frauen, die sich im eigenen Knochenmark wiederfinden wie Stammzellen, eine der Frauen, die die eigenen Großeltern kannten, mit denen man die erste Zigarette geteilt hat und deren Kleidung man sich über mehrere Jahre ausgeliehen hat: Wenn sie einem eröffnet, dass sie ein Baby bekommt, dann scheint sich im eigenen Herzen eine ganz neue Kammer zu öffnen. Es tut weh, es raubt einem den Atem, das ganze bisherige Leben läuft vor dem inneren Auge ab, man verspürt ein Hämmern in der Brust und muss sich setzen. Selbstverständlich ist es wundervoll. Aber es kann auch noch mehr sein.
Ich kenne Alice seit unserer Teenagerzeit. Zum ersten Mal sah ich sie etwa 1996 auf einer Fünfzehn-Personen-Party bei jemandem im Garten. Sie kam den Weg herauf in einem Paar weißer Cordhosen und den scheußlichsten Patchwork-Absatzstiefeln, die ich je gesehen hatte, in der Hand ein Glas Weißwein. Bei einem Fischteich von der Größe eines Badvorlegers blieb sie stehen, warf den Kopf zurück und rief: »Wer hat Lust zu schwimmen?«
Es war Liebe auf den ersten Blick.
Sie lebte hinter einer Polizeiwache, es kursierte der Running Gag, ihr Freund hieße Sebastien Le Camel, und sie war durch nichts aus der Ruhe zu bringen, unglaublich liebenswürdig und unerträglich lustig. Als mittleres von vier Geschwistern schien Alice völlig immun gegen jugendliche Ängste ihr Leben zu leben. Sie sehnte sich nicht nach Aufmerksamkeit und gab einen Scheiß darauf, ob ihr jemand hinterherschaute. Wenn man einen Platz zum Übernachten brauchte, einen Snack, jemanden, der einem das Oberteil mit einer Sicherheitsnadel feststeckte, oder ein fünfstündiges Gespräch darüber, was man in einer Nudelsauce mochte, war Alice die richtige Ansprechpartnerin. Einen der großartigsten Augenblicke puren Glücks erlebte ich, als ich mit siebzehn runter nach Dorset fuhr, während die Sonne schien und Alice in einem ihrer selbst gemachten Boob Tubes am Steuer des schlimmsten Autos saß, das Japan sich je zu fabrizieren getraut hat. Auf einmal ertönte Apache Indians »Boom Shack-A-Lak« aus der Stereoanlage, und völlig unverhofft rezitierte Alice den gesamten Anfangs-Rap, perfekt im Takt, aus dem Gedächtnis. Wer hätte das gedacht?
In den fünfzehn Jahren, die seit Alice und meiner ersten Begegnung vergangen waren, hatten wir nicht nur zusammengewohnt, sondern, abgesehen von zwei Wochen Unterbrechung, einmal zwölf Monate hintereinander jeden einzelnen Tag in Gesellschaft der anderen verbracht. Zu Unizeiten waren wir Mitbewohnerinnen, wir fuhren zusammen nach Hause, wir verreisten in den Ferien zusammen, wir gingen zusammen auf Partys, teilten uns Einzelbetten, fuhren zum Picknicken aufs Land, gingen zusammen in den Waschsalon, kauften zusammen ein, alles. Ich habe weder zuvor noch danach einen Menschen getroffen, mit dem ich so leicht und glücklich zusammenleben konnte. Für ein paar Jahre in meinen Zwanzigern gehörte sie zu meinem Leben wie mein eigener Atem und mein eigenes Blut. Ich nannte sie meine Frau. Sie nannte mich Frauchen.
Als sie mir damals also eröffnete, ein Baby zu bekommen, kann man wohl durchaus sagen, dass ich es aufnahm wie eine Bäuerin aus dem 14. Jahrhundert die Nachricht über den schwarzen Tod. Ich weinte. Ich hob ihr Oberteil an, um ihre Haut zu betrachten. Ich fragte, wie, obgleich ich selbst seit mindestens einem Jahrzehnt relativ regelmäßig mit Samen in Kontakt kam. Ich spürte meinen Mastdarm panisch zucken. Plötzlich hatte ich eine Vision davon, wie ich sechzehnjährig mit Alice in meinem Garten lag und für die Schulabschlussprüfung in Psychologie lernte, während wir Marvin Gaye hörten, und mir wurde bewusst, dass all das nun vorbei war. Meine Achseln wurden feucht. Ich wollte sie in den Himmel heben und zu ihren Ehren schreien. Ich wollte, dass sie nicht mehr schwanger war. Ich wollte ebenfalls schwanger sein. Ich wollte meine Adern ausleeren und noch einmal von vorn beginnen.
Wir standen draußen auf dem Gehweg. Ich ging in die eine Richtung, zum Bahnhof, zurück nach London, wo ich um fünf Uhr morgens freiberuflich Artikel schrieb, ehe ich zu meinem Bürojob aufbrach, zurück zu einem leeren Bett und einem summenden Laptop, zurück in mein lahmgelegtes Leben. Sie fuhr nach Hause, zu ihrem Ehemann, ihrem ausgebauten Dachboden, ihren Folsäuretabletten und Ofenchips.
»Wenn ich dich das nächste Mal sehe, wirst du Mutter sein«, sagte ich, und meine Stimme verfing sich wie ein Faden an einem Nagel. Ich nahm keine Rücksicht auf die Tatsache, dass diese Aussage falsch war: Ich schien ihre Schwangerschaft mit der einer Wüstenrennmaus zu verwechseln (ich würde sie bereits in drei Wochen wiedersehen), außerdem war sie längst dabei, Mutter zu werden, und weil es noch sehr früh war, könnte sie das Baby noch auf tragische Weise verlieren. In meinem Kopf jedoch verabschiedete ich mich in diesem Augenblick von meiner Freundin, von unserer alten Beziehung und von einer ganzen Ära. Statt zum Bahnhof rannte ich zur Wohnung einer anderen Freundin, von der mir klar war, dass sie es bereits wissen würde.
Sobald sie die Tür aufmachte, fragte sie: »Sie hat es dir erzählt, nicht wahr?«
Auf ihrer kleinen Terrasse mit Blick über die Dächer der Roscoe Street und den Radio City Tower sitzend, rauchte ich fünf Zigaretten hintereinander, verdrehte die Blätter ihrer Pflanzen zwischen meinen Fingern und fragte immer wieder, was das bedeutete.
»Es fühlt sich komisch an«, sagte ich und lehnte mich gegen die Schulter meiner Freundin. »Es fühlt sich an, als wäre sie nicht länger eine von uns.«
Sie wusste natürlich, was ich meinte. Wir hatten beide zu unterschiedlichen Zeiten mit Alice zusammengelebt, hatten mit ihr unsere glücklichsten häuslichen Momente verbracht, sie als Ersatz für eine Romanze genutzt, sie als so nah wie ein Familienmitglied angesehen. Und nun war sie jemandes Ehefrau und würde bald jemandes Mutter sein. In der Hierarchie ihres Herzens würden stets mindestens zwei Menschen über uns stehen. Irgendein glücklicher Herzschlag, eine zukünftige Person in ihrer Gebärmutter, würde die großartigste Mutter bekommen, die ich mir vorstellen konnte. Ich war eifersüchtig auf ihr Baby und eifersüchtig darauf, dass sie ein Baby bekam. Ich war traurig, dass unsere Party vorüber war, erkannte jedoch auch plötzlich, wie sehr ich mir wünschte, was sie hatte. Ich wollte, dass sich der absolute Ausdruck von Liebe und Verpflichtung in meinem eigenen Körper manifestierte und etwas Unglaubliches erschuf. Wenn sie Mitglied im Club war, dann wollte ich auch eins werden. Aber ebenso wünschte ich mir noch einen weiteren Nachmittag mit ihr, an dem wir hier oben mit Blick auf die Stadt Wein tranken und Kippen rauchten, Scherze und Anspielungen aus der Luft griffen, mit offenen Herzen, verfügbar und unvernünftig. Ich wollte meine alte Freundin zurück, denn mir war nicht klar gewesen, dass sie im Begriff war, zu gehen.
Frauen wird (durch Popkultur und Konvention) beigebracht, eine Schwangerschaft solle eine Quelle der Freude sein. Wenn eine Freundin uns die Neuigkeit überbringt, sollen wir vor Stolz und Aufregung überfließen. Wir sollen sofort anfangen zu stricken, Babypartys zu schmeißen und natürlich einzukaufen. Man braucht allerdings nur jede beliebige Frau im echten Leben zu fragen, wie sie reagiert hat, als eine ihrer besten Freundinnen ihr eröffnete, dass sie schwanger sei, und bald wird ziemlich klar, dass die Verkündung in Wirklichkeit zugleich ein Brennpunkt von Panik, Nostalgie, Trauer, Sehnsucht, Unsicherheit und Verwirrung ist. Selbstverständlich freut man sich für seine Freundin. Zumindest in den meisten Fällen. Aber es wäre unvorstellbar, dass eine solch enorme Veränderung im Leben eines geliebten Menschen nicht auch wenigstens einen gewissen Einfluss darauf haben sollte, wie man sich selbst in der Welt fühlt.
»Ich hatte sofort das Gefühl, ich hätte die Erwachsenenvorlesung verpasst und ruderte nun wild mit den Armen durchs Leben«, berichtet mir eine Frau auf Twitter. »An dem Wochenende habe ich mir mein erstes Tattoo stechen lassen, weil ich dachte, wenn ich mich nicht in der Sesshaft-mit-Baby-Gruppe befand, dann müsste ich irgendwie wild und frei erscheinen.«
Eine andere Frau beschreibt: »Ich bin in meinen Kleiderschrank geklettert, habe die Tür zugemacht und im Dunkeln geweint«, nachdem sie erfahren hatte, dass ihre Freundin ein Baby erwartete, während sie selbst es seit zweieinhalb Jahren vergeblich versuchte.
»Ich freue mich wirklich riesig für meine Freundinnen, besonders für jene, die sich jahrelang bemüht haben«, fügt eine andere hinzu, »aber das ändert nichts an der Traurigkeit darüber, dass ich zu dieser seltsamen Peter-Pan-Figur werde, die immer noch zu Konzerten geht, in den Urlaub fährt und mit dem Rest der Gruppe nicht mehr viel gemeinsam hat. Ich weiß auch noch, wie ich eines Abends, nachdem ich die Neuigkeit von einer Freundin erfahren hatte, richtig sauer wurde und meinem Freund wütend erklärte, alle anderen würden sich weiterentwickeln, und er würde mich davon abhalten. Obwohl es gar nicht seine Schuld war und wir gemeinsam beschlossen hatten, dass Kinder nichts für uns waren.«
Nachdem ich herausgefunden hatte, dass Alice schwanger war, fuhr ich nach Hause und heulte beinahe eine Stunde lang in mein Kissen. Ich war ein durchgebrochenes Stöckchen, bestand aus Selbstmitleid, Furcht, mütterlichem Verlangen, Eifersucht und Wut. Meine Freude für sie war vorübergehend verflogen. Auf einmal erschien mir Ambivalenz gegenüber Kindern wie eine Grausamkeit. Wieso hatte keiner der Männer, mit denen ich zusammen gewesen war, verstanden, was eine Schwangerschaft für mich bedeutete? Alice’ Mann liebte sie so sehr, dass er seine DNA mit ihrer verknüpfen wollte. Er wollte ein zukünftiges Leben, einen vollständigen Menschen in ihrem Körper erschaffen. Er wollte, dass sie mit ihm verbunden war, sich auf ihn verließ, für immer seine Familie war. Ich schrie und schluchzte in dieses Kopfkissen um meine verlorenen Zwanziger, aus Neid, wegen meines Versagens, je einen Mann zu finden, der eine Familie wollte, aus Entsetzen darüber, wie schnell das Leben überall um mich herum sich vollzog, aufgrund des Gewichts dieser Entscheidung, die ich für immer hinter mir her schleppen musste.
Im Rückblick kann ich erkennen, dass ich »ein Baby« wieder einmal als Sammelbegriff verwendete für meinen lebenslangen Wunsch nach Stabilität, Liebe, Sicherheit, die Möglichkeit, mich auf einen Mann zu verlassen, ohne ihn zu vertreiben, die Gelegenheit, alles besser zu machen, was in meiner Kindheit schiefgelaufen war, Zuneigung und die Erlaubnis, verletzlich zu sein. Aber darüber hinaus empfand ich auch das ernsthafte Verlangen, das Gewicht eines Kindes in meinem Körper zu spüren, zu gebären, mich dem Blut und den Schmerzen dieser Transformation zu stellen und mit etwas Magischem daraus hervorzukommen, mich selbst ganz etwas und jemand anderem zu übergeben, zu stillen, »Mama« genannt zu werden, auf Kniehöhe jemandes Arme zu halten, während dieser Mensch durch einen Garten läuft, Pausbäckchen zu küssen, angeschwollen zu sein von Milch und Stolz und Oxytocin und Sinnhaftigkeit, Windeln zu wechseln, ein Baby unter meine Rippen treten zu fühlen, auf ein schlafendes Gesicht hinabzublicken und zu wissen, dass es aus meinem Körper und dem Körper meines Partners und unserer Liebe entstanden ist.
Abgesehen von dem Gangwechsel des mütterlichen Verlangens, den die Schwangerschaft einer Freundin womöglich auslöst, kann »die Ankündigung« sich auch wie ein Raub anfühlen. Die Schwangerschaft einer anderen Person kann sich wie der Verlust der eigenen anfühlen – egal wie theoretisch die eigene Schwangerschaft auch gewesen sein mag. Vielleicht ist man eifersüchtig, fühlt sich auf dem falschen Fuß erwischt und betrogen, weil eine Person, die man geliebt und der man vertraut hat, nun einen Vorsprung besitzt.
»Ich hatte kürzlich ein Baby verloren und konnte nicht mehr [schwanger werden]«, erzählt mir eine Frau per E-Mail. »Ich war zu Unrecht wütend [auf meine Freundin]. Als sie es mir erzählte, weinte ich am Telefon, und während ihrer Schwangerschaft habe ich kaum mit ihr geredet. Ich war ziemlich selbstsüchtig, wie sehr, ist mir erst bewusst geworden, als ich mit meiner kleinen Tochter schwanger wurde. Aber in diesem Szenario ist es so schwer, die eigenen Emotionen zu kontrollieren.«
Auf eine frisch geschwängerte Gebärmutter mit Tränen, Brüllen, Wut und Neid zu reagieren ist für alle Beteiligten unangenehm und verstörend, aber zugleich ist es wirklich nicht die eigene Schuld. Unter unserem alten Freund Kapitalismus sind wir es gewohnt, die Verteilung aller Ressourcen als Wettkampf anzusehen. Wenn man Äpfel will, muss man, um sie zu bekommen, alle anderen Leute schlagen, die auch Äpfel wollen. Wenn man ein Haus will, muss man die hinterhältigen, Gegengebote machenden Ratten verjagen, die das Haus ebenfalls wollen. Wenn man einen Job will, muss man womöglich dafür sorgen, dass jemand anderes gefeuert wird, um den Aufgabenbereich dieser Person zu übernehmen. Diese Jeder-gegen-jeden-Mentalität sorgt dafür, dass wir immer mehr wollen, mehr kaufen, mehr produzieren, mehr leihen und glauben, wir könnten uns aus, in und um jede menschliche Erfahrung kaufen. Auf diese Weise halten wir die Wirtschaft in Gang.
Auch wenn die Ressourcen immateriell und nicht greifbar sind, bleibt der kapitalistische Instinkt bestehen: Während wir durchs Leben gehen, fühlen wir uns in einem Wettstreit um Liebe, Beziehungen, Respekt, Anerkennung, Gesundheit, Fruchtbarkeit, einem Zugehörigkeitsgefühl. Vom Verstand her wissen wir vielleicht, dass Liebe, Verbindlichkeit und Babys keine endlichen Ressourcen sind, die nach dem Wer-zuerst-kommt-mahlt-zuerst-Prinzip ausgeteilt werden. Es auch vom Gefühl her zu wissen, ist noch einmal eine ganz andere Sache. Sicher, als die Menschen noch in Stämmen aus 150 Personen lebten, für die wir erschaffen wurden, war es gut möglich, dass die Schwangerschaft einer Person tatsächlich bedeutete, dass jene um sie herum mit weniger auskommen mussten, damit sie und ihr Baby versorgt waren. Aber selbst damals, in unserer prähistorischen und größtenteils spekulativen Vergangenheit, saugte die Schwangerschaft einer Gleichaltrigen nicht auf irgendeine Weise alle verfügbaren fruchtbaren Samen auf. Nur weil die eigene Freundin ein Baby bekommt, wird es nicht weniger wahrscheinlich, dass man selbst dasselbe tut. Der Wettstreit unter Frauen um das Schwangerwerden ist die Folge einer eingebildeten Konkurrenz und nicht einer realen Ressourcenaufteilung.
Gleichzeitig ist es wahr, dass ein Teil der Bevölkerung niemals Kinder haben wird. Dem Office for National Statistics zufolge waren von den Frauen, die im Jahr 1971 geboren wurden, bei ihrem fünfundvierzigsten Geburtstag 18 Prozent kinderlos. Zunächst einmal ist mir bewusst, dass die Festlegung des Alters von fünfundvierzig Jahren als Schwelle, nach der Frauen keine Kinder mehr bekommen, willkürlich erscheinen mag, aber um diese Art von Statistiken aufzustellen, muss man die Grenze irgendwo ziehen. Außerdem lohnt es sich, darauf hinzuweisen, dass diese Statistik zwar landesweit repräsentativ ist, diese Zahlen jedoch nicht unbedingt direkt auf den eigenen Freundeskreis übertragbar sind – es ist unwahrscheinlich, dass exakt 18 Prozent der eigenen Freundinnen ihr ganzes Leben lang kinderlos bleiben. Das Muster von Schwangerschaft und Kinderzeugen ist ein Flickwerk mit großen Unterschieden zwischen verschiedenen Communitys, Wohnorten, ökonomischen Gruppen und körperlichen Voraussetzungen. Für jede achtunddreißigjährige Single-Frau, die beim Anblick eines weiteren »Baby an Bord«-Aufklebers die Faust ballt, lebt siebenhundert Meilen entfernt eine Vierundzwanzigjährige, die aus freien Stücken nie ein Kind bekommen wird. Auch wenn 18 Prozent aller Britinnen nie ein Baby bekommen mögen, kann es trotzdem gut sein, dass jede einzelne Frau aus der eigenen Grundschule bis zum Alter von fünfunddreißig Jahren mindestens ein Baby hat. Statistische Beobachtungen sind keine Tatsachen, die Diagnosen erlauben. Dennoch, je mehr eigene Freundinnen Kinder bekommen, desto wahrscheinlicher fühlt es sich an (auch wenn es nicht stimmt), dass man selbst diejenige sein wird, die keins hat. Irgendjemand, sagt man sich, muss ja schließlich die 18 Prozent ausmachen.
»Für mich hat es sich vom ›Scheiße, wirst du es behalten?‹ vor zehn Jahren dergestalt verändert, dass ich jetzt mit zusammengebissenen Zähnen lächle, Glückwünsche ausspreche und mich als Babysitterin anbiete, während ich gleichzeitig das Gefühl habe, vor Traurigkeit zu zerbrechen«, schreibt mir eine Frau anonym auf Twitter. »Und seltsamerweise sind es für mich nicht so sehr die Tatsache, dass ein Baby unterwegs ist, oder die Jahre voller Mühen und Freuden, um die ich mein Gegenüber beneide, als die Sicherheit und Geborgenheit eines Paars, das gemeinsam beschließt, etwas so Bedeutsames zu teilen. Unfreiwillig sowohl alleinstehend als auch kinderlos zu sein, führt dazu, dass jede Verkündung einer Schwangerschaft sogar noch mehr Distanz zwischen mir und meinen engsten Freundinnen schafft.«
Ich kenne diese Distanz. Ich habe meinen Neid in diese Distanz geschüttet. Ich habe in diese Distanz hineingeheult. Euch geht es vielleicht genauso.
Natürlich sind manche Frauen bei der Aussicht auf die Schwangerschaft einer besten Freundin optimistischer als andere. Ich liebe diese Reaktion einer Journalistenkollegin, die mich per E-Mail kontaktierte, nachdem sie gehört hatte, dass ich an diesem Buch arbeite.
»Meine beste Freundin hat es uns mit einem Braten-in-der-Röhre-Scherz gesagt«, schrieb sie. »Wir waren in einem Center Park, und sie stellte wirklich einen Braten in den Backofen. Ich verspürte eine absolut überwältigende Freude. Das bedeutete zwar, dass sie während des Urlaubs eine Menge Dinge nicht tun konnte – Alkohol trinken, in die Stromschnellen gehen, etc. –, aber was meine Freude für sie anging, so war sie hundertprozentig ehrlich. Das liegt vermutlich daran, dass es nichts ist, was ich mir im Augenblick selbst wünsche, weshalb ich weder Neid verspürte, noch einen Vergleich mit meinem eigenen Leben anstellte.«
Aber selbst unter solchen Umständen kann die Schwangerschaft einer besten Freundin die Frage nach Babys ungewollt wieder aufploppen lassen. Sie selbst formulierte es so: »Natürlich führte es dazu, dass mein Partner und ich uns immer öfter darüber unterhielten. Während eines langen Heimwegs sprachen wir im Auto über die Logistik von Elternschaft … trotzdem werde ich die Pille noch eine Weile nehmen, bitte und Dankeschön.«
Eine andere Freundin textete mir auf meine Diskussion auf Twitter hin lediglich: »Ich musste so lachen: In derselben Woche erst stand ich bei Boots und rätselte darüber, wieso jemand gleich mehrere Schwangerschaftstests in einer Packung brauchen sollte.«
Wenn das Durchschnittsalter einer britischen Frau bei ihrem ersten Kind 28,6 Jahre beträgt, ist es wahrscheinlich ein wenig lächerlich, dass ich so schockiert war, als ich erfuhr, dass meine einunddreißigjährige Freundin ein Baby bekam. Es war schließlich keine Teenagerschwangerschaft, ich hatte sogar schon ein paar graue Schamhaare. Aber die Tatsache, dass wir uns mitten in jenem Zeitfenster befanden, in dem in Großbritannien Babys entstehen, änderte nichts daran, dass wir irgendwo in meinem Herzen noch immer die Gruppe Siebzehnjähriger waren, die sich dicke einzelne Brauen ins Gesicht malten, um als Madonna auf eine Achtzigerparty zu gehen. In meinem Kopf spielten wir alle immer noch Erwachsensein, redeten hypothetisch darüber, sondierten die Lage, ehe wir »wirklich« sesshaft wurden. Aber sobald eine Gleichaltrige ein Baby bekommt, lässt sich die Wahrheit schwerer ignorieren. Die Zeit vergeht, Kapitel im Leben werden beendet, und die Zwanziger sind ein Jahrzehnt und keine Lebensform. Man sollte sich keine Vorwürfe machen, wenn diese Erkenntnis Panik, Nostalgie, Wut, Enttäuschung, Sehnsucht oder Verwirrung auslöst, denn die eigenen Gefühle sind die eigenen Gefühle, und man kommt mit ihnen nur zurecht, indem man akzeptiert, dass sie real und vorübergehend sind. Man sollte aber versuchen, sich daran zu erinnern, dass nie irgendjemand schwanger geworden ist, nur damit die beste Freundin sich scheiße fühlt. Wahrscheinlich hat die andere Person dabei noch nicht einmal an einen gedacht.
Von all den Geschichten, die ich von Frauen gehört habe, die auf die Schwangerschaft einer Freundin reagierten, ist diese hier, in der ein reiner, unverfälschter Schock zum Ausdruck kommt, eine meiner liebsten: »Als ich meine Schwester anrief, um es ihr zu erzählen, war sie gerade zu Besuch bei unserer besten Freundin«, schrieb mir eine Frau in einer E-Mail. »Sie fing an zu schreien, und dann wurde es ganz still. Ihre Freundin kam ans Telefon und sagte, sie sei ins Bad gerannt, um zu duschen. Ich weiß immer noch nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Reaktion war.«
Eine Studie der Bocconi-Universität in Italien und der Universität Groningen in den Niederlanden, die sich auf die Daten von 1170 Frauen stützte, von denen im Untersuchungszeitraum 820 Eltern wurden, fand heraus, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Frau, ein Baby zu bekommen, für etwa zwei Jahre anstieg, wenn eine Freundin ein Baby bekommen hatte – bevor sie dann wieder sank. Kurz gesagt, sobald eine von euch »in Schwierigkeiten gerät«, gibt es einen vorübergehenden Anstieg bei Freundinnen, die es ihr nachtun.
Die beiden Studienleiterinnen führen diesen Anstieg auf mehrere Faktoren zurück: sozialer Einfluss, auch bekannt als der gute alte Gruppenzwang; soziales Lernen, soll heißen, wenn man einmal erlebt hat, wie jemand Nahestehendes sich mit Schlafentzug, Brustentzündungen, Krupp und Krabbeln herumschlägt, fühlt man sich eher in der Lage, sich selbst auf diese Reise zu begeben; und schließlich Kostenteilung – wenn man ohnehin ein Baby bekommen möchte, weshalb dann nicht in der Zeit, in der es auch die Menschen im eigenen Umfeld tun, damit man sich die Last der Kinderbetreuung teilen kann und die abgetragenen Kleider und alten Spielsachen ihrer Kinder bekommt?
Zu dieser Liste würde ich auch noch den Punkt der emotionalen Rechtfertigung hinzufügen. Als Alice mir erzählte, sie sei schwanger, erschien mir das plötzlich wie die Erlaubnis, das Gleiche zu wollen. Ich war nicht länger die Außenseiterin der Gruppe mit dem heimlichen Kinderwunsch – meine Sehnsucht stimmte zumindest mit der einer meiner Freundinnen überein, von ihrem Partner ganz zu schweigen. Wenn sie es tun konnte – ihre Karriere auf Eis legen, den Schlag gegen ihre Beziehung einstecken, das Ausgehen aufgeben und ihre Abende fortan damit verbringen, Ausschläge zu googeln –, dann würde ich das doch auch können, oder?
Die renommierte Professorin für Philosophie und Kognitionswissenschaft L.A. Paul von der Yale University argumentiert, man könne nicht wissen, wie die Erfahrung eines eigenen Kindes sein werde, ehe man sie selbst erlebt. Man könne nicht genau vorhersagen, ob die Erfahrung positiv, negativ oder irgendetwas dazwischen sein werde, da sie unmöglich hypothetisch zu beurteilen ist. In dieses Vakuum und auf die Schwangerschaften der eigenen engsten Freundinnen schüttet man also all seine Ängste, Hoffnungen und Sorgen. Ihre Erfahrung wird zu einem Maßstab, anhand dessen man Spekulationen über die eigene Entscheidung anstellt. Das kann bedeuten, dass sich die eigene Ablehnung gegenüber Babys verhärtet, dass man die eigenen Pläne beschleunigt, oder dass man einfach eine Flasche Wein hinunterkippt und in den Abgrund schreit, bis die Panik langsam verfliegt.
Zum größten Teil wird die Reaktion auf die Schwangerschaft einer Freundin von den eigenen Umständen abhängen. Als ich Single war, verwandelten Schwangerschaften meine Freundinnen vorübergehend in Fremde, die in ein Leben aufbrachen, das nur wenig mit meinem eigenen zu tun hatte. Als ich mich in einer festen Beziehung befand, wirkte die Schwangerschaft einer Gleichaltrigen wie eine Notfackel, die tagelang am Himmel über mir brannte und die Babyfrage unmittelbar in mein Blickfeld zwang, mich blind gegenüber rationalen Argumenten machte und der Aussicht eine Art von Dringlichkeit verlieh, die ich internalisierte, während mein Partner sie einfach verdrängte. Als mein Sohn klein war, begrüßte ich jede neue Schwangerschaft einer Freundin mit Freude und einem zutiefst empfundenen Gefühl von Schwesternschaft, das ich so bisher noch nicht gekannt hatte. Nun, da ich ein Baby habe, meine Periode wieder da ist und ich regelmäßig gefragt werde, ob ich ein weiteres Kind bekommen werde, verspüre ich langsam wieder dieselben alten schleichenden Gefühle von Neid, Traurigkeit und Wut, wann immer ich höre, dass eine meiner Altersgenossinnen schwanger ist. Wie können wir damit aufhören, das Leben anderer Frauen als Kommentar zu unserem eigenen zu interpretieren? Wie können wir lernen, uns nicht mit unserem Umfeld zu vergleichen? Wie entfernen wir das Gefühl von Konkurrenz aus der Schwesternschaft? Wenn ich das wüsste, ihr Lieben, glaubt mir, dann würde ich es euch sagen. Mit Sicherheit würde ich heute nicht mit meinem eigenen Kind hier in einem Wohnwagen in Essex sitzen, diese Zeilen schreiben und mit einem Felsbrocken in der Brust auf ein Foto des Zwölf-Wochen-Ultraschalls meiner Freundin starren.