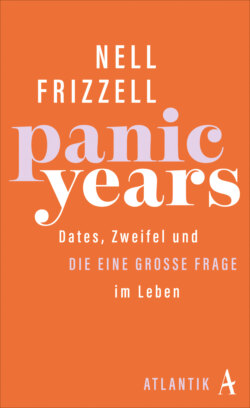Читать книгу Panic Years - Nell Frizzell - Страница 6
2 Lass uns rausgehen
ОглавлениеIch wollte niemals an einem Bahnhof sitzengelassen werden.
Manchmal ist Daten wie ein feuchtes Holzscheit: Es schwelt, raucht und spuckt, fängt aber nie richtig Feuer. Am Ende hat man nicht so sehr Liebeskummer aufgrund einer Person als aufgrund von etwas, das es eigentlich nie gegeben hat, eine entrissene Möglichkeit, ein Streich der Hoffnung, den man sich selbst gespielt hat. Das hier war ein solcher Fall von Liebeskummer. Und hier war ich, stand mit achtundzwanzig Jahren auf Bahnsteig vier am Bahnhof von Crewe in einem Pumpkin Café und versuchte, mich zwischen einem eiskalten Becher Birchermüsli vom Vortag für 2,99 Pfund und einer Tüte Salt-and-Vinegar-Chips für 1,29 Pfund zu entscheiden. Während die verspäteten Züge und Gleisänderungen sich über meinem Kopf abrollten wie bernsteinfarbener Regen, hielt ich den mit Folie bedeckten Becher in Joghurt getränkter Haferflocken in den Händen und spürte, wie mein Entschluss bröckelte.
Nur vierzig Minuten zuvor hatte mir ein Mann, mit dem ich zelten gewesen war, eröffnet, dass er zwar Vater werden, aber keine Freundin haben wollte. Auf dem Rückweg von einem Wochenende in den Bergen saßen wir in einem Virgin Train, der gerade in Stafford einfuhr, als er entschied, dies sei der richtige Zeitpunkt, um mir die frohe Botschaft zu überbringen. Er gab mir einen Kuss auf die Lippen, nahm seine Tasche und stieg aus dem Zug. Vor dem Fenster zwinkerte er mir zu, lächelte und beobachtete, wie ich davonfuhr. Von Stafford bis Crewe starrte ich in die gen Boden sinkende schmutzige Zwei-Pence-Sonne, während mein Herz gegen meinen Hals drückte wie ein Winkelschleifer, und bemühte mich, nicht zu weinen. Er hatte mich geküsst. Er hatte mir zugezwinkert. Er wollte mich nicht. Ich warf einen Blick auf die Menschen in meinem Abteil und brannte vor Scham, denn sie alle hatten es gesehen. Sie hatten dabei zugesehen, wie ich, einer feuchten Mülltüte gleich, höflich aber bestimmt fallengelassen wurde. Ich war zerzaust, ich trug Leggings, ich hatte meine Füße auf eine Tasche gestellt, die so viel wog wie eine Leiche, und ich war eine Idiotin. Eine absolute Idiotin.
Obwohl ich diesen Mann bereits seit zwei Jahren kannte, war es das erste Mal gewesen, dass wir wirklich Zeit zu zweit miteinander verbracht hatten. Ich weiß. Ehrlich, ich weiß. Von einer Bekannten zu einer verschwitzten Liebhaberin in der Natur zu werden, ist ein seltsamer Move, aber dieser wurde sozusagen zu meinem Markenzeichen. Ihr müsst wissen, ich habe es nie richtig hinbekommen, jemanden abzuschleppen, ohne eine große Sache daraus zu machen. Ich habe mir nie eine App heruntergeladen, habe nie nach rechts gewischt und auch nur selten jemanden gefragt, ob er mit mir etwas trinken oder essen gehen will. Stattdessen fragte ich einen Mann, den ich kaum kannte, praktisch aus dem Nichts, ob er mit mir ein Wochenende im Nirgendwo verbringen wollte, schwitzend, unter zwei auseinandergezogenen Polyesterlaken. Ihr würdet wirklich staunen, wie oft da ja gesagt wird.
Wie dem auch sei, da ich diesen Mann kaum kannte, hatte ich mit ihm auch noch nicht richtig über die Zukunft gesprochen, ich hatte mich nicht getraut. Ich war noch nie besonders an Hochzeiten interessiert gewesen und legte nicht viel Wert darauf, dass jemand mir einen Antrag machte, dennoch hatte ich mir ausgemalt, im Bett neben ihm aufzuwachen und sein Achselhaar in der Morgensonne zu betrachten. Ich hatte auf klammernde Küsse, Textnachrichten und Insiderwitze gehofft. Ich hatte davon zu träumen gewagt, ihm Brot zu backen, ein Marmeladenglas voller Zigarettenstummel auf einem Fensterbrett zu balancieren, ein gemeinsames Bücherregal zu haben und dazu, weil es stets etwas war, das ich mir in meiner Zukunft vorstellte, ein Baby. Es mag lächerlich klingen, wie die Kulmination der schlimmsten Ängste eines Bindungsphobikers, dass ich nach nur zwei Nächten in einem Zwei-Personen-Zelt mitten im Nirgendwo bereits ein Leben der totalen Interdependenz und Elternschaft mit einem Mann plante, den ich kaum kannte. Aber ganz so einfach ist es nicht.
Für mich und für viele andere, die sich im Fluss befinden, ist die Vorstellung, wie es sein könnte, ein Baby mit jemandem zu haben, ihm die eigene Gebärmutter anzuvertrauen und das eigene Leben untrennbar mit seinem zu verbinden, eine Möglichkeit auszutesten, welche Gefühle man wirklich für diesen Menschen hat. Es ist so, wie wenn man jemandem beim Tanzen zusieht und sich überlegt, ob man mit diesem Menschen Sex haben könnte, oder wenn man sich hinter den Schreibtisch im Büro einer anderen Person imaginiert, um zu schauen, ob man deren Job übernehmen könnte, oder wenn man ins Fenster einer Erdgeschosswohnung blickt und sich fragt, ob man mit dieser Tapete leben könnte. Ich malte mir aus, mit Leuten Babys zu bekommen, um mich selbst zu testen, das Ausmaß meiner Anziehung, meiner Bereitschaft und meiner Absichten. Wenn ich vor der Idee zurückschreckte, wusste ich, dass die Sache ein Reinfall war. Wenn ich das Gefühl hatte, das imaginäre Kind vor der Reizbarkeit, den Gewohnheiten, dem Drogenkonsum, dem Job oder der Familie jener Person beschützen zu müssen, war es ein ziemlich gutes Anzeichen dafür, dass ich mich von ihr fernhalten sollte (ob ich das dann tat oder nicht, ist eine andere Frage – zumindest waren die Anzeichen da, die ich aber bewusst ignorieren konnte). Wenn ich mir glücklich vorstellen konnte, wie er unser Neugeborenes durchs Haus trägt und dabei Stevie Wonder singt, dann wusste ich zumindest auf irgendeiner Ebene, dass ich mich bei dem Gedanken an eine gemeinsame Zukunft wohlfühlte. Und wenn man nach einer langen oder bedeutenden Beziehung wieder datet, wenn man in den Panikjahren datet, wenn man datet, während die Menschen um einen herum anfangen, sesshaft zu werden, dann wird die Zukunft zu einer ziemlich realen und unmittelbaren Angelegenheit. Die bevorstehenden Dinge nehmen noch beim Reden Form an. Daher ist ein Baby nicht einfach etwas, das eines Tages passieren könnte, sondern etwas, das tatsächlich relativ bald passieren kann. Mir jemanden, mit dem ich gerade geschlafen hatte, als einen Vater vorzustellen, war meine Art, mich mit einem inneren, kindlichen emotionalen Selbst zu verbinden und zugleich die Skizze einer möglichen Zukunft anzufertigen.
Als er sich mit jenen paar Worten also als ein williger Vater, aber nicht als ein Partner präsentierte, hatte er nicht nur meine Hoffnung beschämt und meine Zuneigung blamiert, sondern mir noch ein weiteres ungelebtes Leben entrissen. Er hatte eine mögliche Version von Nell ausgelöscht, und ebenso der Kinder, die sie hätte gebären können. Ohne sich dessen unbedingt bewusst zu sein oder es zu wollen, hatte er das Zahnfleisch meiner zur Schau getragenen Gleichgültigkeit zurückgeschoben und einen wunden Nerv der Sehnsucht enthüllt. Aber statt diese Sehnsucht wertzuschätzen, war er mit einem Zwinkern davongegangen.
Weil ich technisch so unfähig wie verschwenderisch bin, hatte ich nur etwa sieben Songs auf meinem Telefon heruntergeladen. Während ich mit schmerzendem Herzen durch Cheshire donnerte, hatte ich also die Wahl, mir entweder eine Coverversion von »It’s All Over Now, Baby Blue« von Them oder eine siebzehnminütige Version von »Love To Love You Baby« von Donna Summer anzuhören. Ich entschied mich für Ersteres. Heute wünschte ich, ich hätte Letzteres gewählt. Mit aufgesetzten Kopfhörern, das Gesicht ans Fenster gedrückt, fühlte ich mich leer. Ich war ein verzogener und aufgerissener Tischtennisball, der im Staub eines Scheunenbodens lag. Ich war eine niedergetretene Trockensteinmauer. Ich war eine leere, altersmüffelige Tupperdose. Ich weinte wie ein Feuer in der Sonne.
Natürlich gibt es keinen guten Ort, um mit jemandem Schluss zu machen. Der Akt des Schlussmachens hat schon viel zu viele Uferpromenaden, heiß geliebte Cafés, stille Wälder und dunstige Pubs ruiniert. Was mich auf eine Idee bringt: Der Staat sollte ausgewiesene Schlussmachbereiche zur Verfügung stellen. Sozusagen als Zwillingsprojekt zu meinen Pflegeheimen für gebrochene Herzen. Es sollte von der Regierung finanzierte öffentliche Orte geben, an die tränenmüde, lustlose Paare gehen können, um ihre Verbindung zu lösen. Statt ein Restaurant, einen nahe gelegenen Park oder, noch schlimmer, das eigene Zuhause mit einem Gespräch darüber zu verseuchen, auf wie viele Weisen der andere einen nicht mehr begehrt, wäre es doch so viel besser, eine anonyme, automatische, nicht beantwortbare E-Mail im Outlook-Postfach vorzufinden, die einen in ein von der M6 abgehendes Konferenzzentrum einlädt. Dort einen komplett neutralen, auf hässliche Weise unpersönlichen Raum über einem Wartebereich auf dem Bahnsteig zu betreten, in dem der eigene Partner einem auf einem Plastikschalenstuhl gegenübersitzt, die Ellbogen auf eine Holzfasertischplatte mit den Flecken von anderer Menschen Tränen gestützt, und einem langsam das Herz zerquetscht. Oder mit sinkendem Mut in ein Besprechungszimmer in einem Industriegebiet neben einer Kiesgrube zu treten, wo man seinen Freund auf Teppichfliesen unter einer Neonröhre stehen sieht und sicher weiß, dass man gleich verlassen wird. Dorthin wird man nie wieder zurückkehren müssen, man wird nicht während eines Essens im Pub oder eines langen Spaziergangs daran erinnert, es holt einen nicht zufällig drei Monate später ein, wenn man mit seiner Cousine Tee trinken geht. Es wird für immer ein entfernter bürokratischer Albtraum bleiben, den man ertragen hat und fortan ignorieren kann. So sollte Schlussmachen funktionieren.
Wahrscheinlich kam ich diesem glücklichen Traum so nahe wie irgend möglich, als ich am Bahnhof von Crewe stand, wo ein sibirischer Wind über die mit Scheiße bespritzten Bahnschienen unter meinen Füßen herauffegte, und versuchte, etwas für weniger als 5 Pfund zu kaufen, was das Nagen meiner Eingeweide stoppen könnte, ehe ich in eine Bummelbahn in Richtung London stieg. Der Rucksack hing an meinen Schultern wie ein schlechtes Gewissen, und die Kühlschranklichter der Auslage des Cafés schienen blind auf meine grauen Haare. Trotzdem frage ich mich, ob ich das verdient hatte. Trotzdem wünschte ich, er hätte es besser gemacht.
Zu diesem Zeitpunkt hätte ich das Zelten vermutlich sein lassen sollen. Ich hätte meinen eigenen Rat annehmen und erkennen sollen, dass das Verspeisen von Instant-Nudeln in einem Anorak höchstwahrscheinlich nicht zur Liebe des Lebens führt. Ich hätte in Betracht ziehen sollen, wie das mühsame Anziehen einer Unterhose, während man gekrümmt ist wie ein Shrimp, der Versuch, unter einer Kuppel aus vermodert riechendem Zelttuch Sex zu haben, oder das Schlafen in zwei Paar Herrensocken meine Chancen auf Hingabe schmälern könnten. Aber stattdessen zeltete ich noch härter. Liebe Leute, ich zeltete wie eine Besessene. Im Verlauf der nächsten zwei Jahre durchquerte ich das Land wie eine Pfadfinderin, ich wurde zur Pionierin des Draußen-Vögelns. Ich hatte endlich genügend Selbstvertrauen zusammengekratzt, um zu begreifen, was mir wichtig war: Landschaft, Draußensein, Menschen, die ja sagen, Sex und Abenteuer. Ich wollte einen Mann, der nach Holzfeuer roch, einen ordentlichen Pullover besaß und ein Zugticket im Voraus buchen konnte. Was ich noch nicht zugeben konnte, war, dass ich neben Romantik und Abenteuer auch Zuneigung und Verbindlichkeit wollte – und verdient hatte. Immerhin bekam ich ein paar gute Spaziergänge und viel frische Luft. Ihr wisst schon, genau wie ein Hund.
Es gibt einen Mythos, der unsere Kultur so beharrlich durchdringt, dass ich Jahre brauchte, um zu erkennen, dass er nicht immer zutreffend ist. Dieser Mythos besagt, alle Männer seien unersättliche sexuelle Wesen, die ihr gesamtes Leben in einem Zustand aufgeregten Verlangens verbringen, der von den Menschen in ihrem Umfeld entweder verurteilt oder gebilligt wird. Ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass das Schwachsinn ist. Manche Männer haben eine gesteigerte Libido. Manche Frauen auch. Die meisten Männer haben zu bestimmten Zeiten in ihrem Leben und unter bestimmten Umständen eine gesteigerte Libido. Genau wie die meisten Frauen. Manche Männer haben eine schwache Libido. Manche Frauen haben eine schwache Libido. In seinem Buch Die versteckte Lust der Frauen argumentiert der Autor Daniel Bergner, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht so sehr biologisch als vielmehr anerzogen sind: Die weibliche Sexualität sei zwar genauso roh und animalisch wie die männliche, Frauen werde allerdings beigebracht, das Ausdrücken triebhaften Verlangens sei irgendwie unschicklich oder unweiblich. Wenn diese dringende animalische Lust dann endlich einmal zum Vorschein komme, könne sie bei Frauen daher beschämend oder unnatürlich wirken und schnell unterdrückt werden. Aber sie ist da, sie war schon immer da. Immerhin, wie Zoe Williams in einem ihrer besten Artikel schreibt, wurde Fifty Shades of Grey gerade deswegen zum bestverkauften Buch, seit die Verkaufszahlen im Vereinigten Königreich aufgezeichnet werden, weil es von Scharen lüsterner Frauen gekauft wurde, denselben Frauen, die von ihren verständnislosen oder hinter den Erwartungen zurückbleibenden Partnern zu oft als »frigide« oder »vertrocknet« abgetan werden. Es ist ein unangenehmer Scherz der Biologie, zumindest für heterosexuelle Paare, dass Männer oftmals mit achtzehn eine starke Libido genießen, während die Libido von Frauen eher mit dreißig ansteigt, was eine Quadratur des Kreises darstellt, die mir nie gelungen ist. Aber in unserem sexuellen Wesen und Appetit, wenn man von der sozialen Konditionierung einmal absieht, gleichen sich Männer, Frauen und nichtbinäre Menschen in vielerlei Hinsicht.
Mit alldem will ich sagen, dass das Märchen, alle Männer seien jederzeit hungrig und bereit für Sex, dumm und gefährlich ist. Zum einen bestätigt es auf subtile Weise den Irrglauben, bei sexualisierter Gewalt ginge es um Sex statt um Gewalt und Macht. Es vermittelt uns, Männer wüssten sich nicht zu helfen: Manchmal werde ihr Verlangen zu machtvoll, um ihm zu widerstehen, und dann müssten sie Sex an irgendjemandem ausführen, ohne Rücksicht auf die Gefühle jener Person. Sexualisierte Gewalt hat jedoch viel damit zu tun, Macht über eine Person zu erlangen, ihr wehzutun, ihr Menschsein zu ignorieren und ihre Gefühle zu verletzen, aber nur sehr wenig mit Sex. Zum anderen bedeutet es, dass bei jedem Zusammentreffen eines heterosexuellen Mannes mit einer heterosexuellen Frau beide eine unausgesprochene Reihe von Annahmen darüber mit sich herumtragen, was von wem gewollt werden wird. Er werde Sex wollen, bringt man uns bei, und es werde an ihr liegen, ob sie dem nachgeben werde oder nicht. Ich habe in meinem Leben zu viel Zeit damit verbracht, mich wie eine Versagerin, wie ein alter Drachen zu fühlen, wann immer ein Mann mit genügend Gelegenheiten mir nicht an die Wäsche ging. Ich schämte mich für die Tatsache, dass ich mit Vergnügen eine Jeans durchbissen hätte, um einen Orgasmus zu bekommen, während der Mann neben mir interessierter an, nun ja, fast allem anderen wirkte. Was mich mit entsetzlicher Unausweichlichkeit auf ein Feld in Whitby führt.
Ich sitze allein in meiner Unterwäsche in einem heißen orangefarbenen Zelt auf einem Feld mit Aussicht auf die gewundene Küste North Yorkshires und frage mich, was genau gerade vor sich geht. Es war der Sommer 2014, und ich hatte bei einer Vernissage in Manchester ein paar Wochen zuvor einen Mann kennengelernt, nennen wir ihn Max (hauptsächlich, weil ich nie mit einem Mann geschlafen habe, der Max heißt). London in Richtung Norden zu verlassen gab mir irgendwie immer einen Hauch dieses berauschenden Urlaubsgefühls, weniger bekannt, weniger schnell verurteilt und damit eher in der Lage zu sein, jede Gelegenheit zu nutzen, Spaß zu haben. Wie auch immer, ich war mit Max nach Hause gegangen und hatte, obwohl ich einen selbst gemachten Velour-Overall trug, der den Zugang zu meinen erogenen Zonen nahezu versperrte, eine der besten schlaflosen Nächte meines Lebens gehabt. Ermutigt dadurch, sowie durch die Tatsache, dass er ein Auto besaß und behauptete, er könne ein Feuer anzünden, schlug ich ihm vor, übers Wochenende in Yorkshire zelten zu gehen. Damals hatte ich noch nicht begriffen, dass Max außerdem ein Verschwörungstheoretiker mit einer ungesunden Vorliebe für YouTube-Videos war.
Als wir ein paar Stunden zuvor an jenem Tag am baumbewachsenen Ufer eines kleinen, sich kräuselnden Baches saßen, hatte er mich aus dem Nichts gefragt, ob ich an Drachen glaube. Ich wollte großzügig sein und antwortete, ich glaubte, die Menschen im Mittelalter könnten den Biss einer großen giftigen Echse, die damals womöglich von Europa herübergewandert kamen, mit Feuer verglichen haben.
Es entstand eine kurze Pause, ehe er mich anblickte, sich erneut mit seinen spinnenartigen Fingern durchs Haar fuhr und sagte: »Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, da muss mehr dahinterstecken, verstehst du? Es kann doch nicht so viele Geschichten geben, wenn da nicht irgendwas dran ist.«
Wie eine Lebensmittelvergiftung folgte darauf das Unausweichliche: für 9/11 seien die Amerikaner selbst verantwortlich, Jesus sei eigentlich gar nicht gekreuzigt worden, das Parlament sei an einem Punkt des Zusammenlaufens alter Kraftlinien erbaut worden. Das Übliche. Mein absoluter Favorit kam, als wir durch die sonnenbeschienenen Hügel von North Yorkshire fuhren und er anfing, sehr schnell und immer lauter über die Bushaltestellen am Wegesrand zu sprechen.
»Hier, Mann, sieh dir das an, all diese Bushaltestellen – sie sehen alle anders aus, jede ist einzigartig. Sie sind wie kleine Häuschen.«
Ich stimmte zu, es seien tatsächlich hübsche Bushaltestellen.
»Aber in Manchester findest du sowas nirgends. Die Stadt, der Staat – die kontrollieren alle, die Gedanken von allen, dein Verhalten. Du wirst von denen buchstäblich manipuliert, damit du dich verhältst, wie die es wollen.«
Ich konnte ihm nicht ganz folgen, zum einen, weil ich von einem Feld voller Heuballen abgelenkt wurde, zum anderen, weil ich versuchte, dieses ganze Fiasko auszublenden. Wer waren »die«? Meinte er die Kommune?
»Ja, sicher. Ich meine, das muss dir doch aufgefallen sein. Alle Bushaltestellen in Manchester sind rot.«
Er machte eine deutliche, beinahe bedeutungsschwangere Pause, als ob diese Feststellung für sich spräche.
»Rot?«, gab ich zurück, mit der grimmigen Akzeptanz einer Kuh, die einen glatten Hang hinunterschlittert.
»Ach, komm schon, Babe, erzähl mir nicht, du weißt nicht, was rot bedeutet«, antwortete er. »Jedes Kind weiß, dass Rot eine Warnfarbe ist, die eine chemische Reaktion in deinem Hippocampus auslöst, der dich in einen ›Kampf oder Flucht‹-Modus versetzt. Die machen alles rot – die Bushaltestellen, die Parkuhren, die Mülleimer –, damit wir Angst kriegen. Um uns einzusperren. Hier draußen, wo die Bushaltestellen …«
Ich drehte meinen Kopf zum Fenster und tat so, als würde das hier gerade nicht passieren.
Trotz allem, trotz der Theorien und des musikalischen Snobismus und der endlosen Erklärungen von Dingen, die ich bereits wusste, war ich noch immer fest entschlossen, das Beste aus meinem Wochenendtrip mit diesem Verrückten zu machen. Und so fand ich mich dort in jenem Zelt wieder, wo ich mich ansprechend auf einem blauen Nylonschlafsack drapierte und darauf wartete, dass etwas passierte. Ich hatte versucht, kokett zu lächeln, während er vor dem Zelt rauchte. Ich hatte versucht, ihn sanft zu fragen, womit er gerade beschäftigt sei, ohne eine Antwort zu bekommen. Am Ende hatte ich meinen Kopf aus der Eingangsklappe gestreckt und so verführerisch ich konnte gesagt: »Komm und schlaf mit mir.«
Und dann wartete ich.
Und wartete.
Ich las in meinem Buch. Ich wartete noch etwas länger. Ich checkte meine Nachrichten. Ich wartete weiter. Ein wenig geknickt blickte ich schließlich hinaus, wo ich Max in seinem Auto sitzen sah. Ich kroch in meiner Unterwäsche hinüber und fragte ihn, was er da mache.
»Ich sortiere nur meine CDs neu«, antwortete er und wandte sich ab. »Und spiele mit diesem coolen Schlüsselanhänger, den ich mir gerade gekauft habe.«
Ich weiß nicht, ob ich mich in meinem ganzen Leben sexuell je so abgewiesen gefühlt habe. Als ich mit weniger Stoff als bei einem handelsüblichen BH bekleidet auf dem feuchten Gras eines Zeltplatzes in Yorkshire hockte und durch ein halb heruntergelassenes Autofenster auf einen Mann blickte, der lieber seine Compilations alphabetisch sortierte, als mit mir ins Bett zu gehen, verspürte ich den starken Drang, mich zu einem Ball zusammenzurollen und den Rest meines Lebens in einer Hecke zu verbringen. Ich kannte diesen Mann nicht, mochte ihn noch nicht einmal besonders, aber ich war bereit, meinen Körper mit ihm zu teilen, ihm Vergnügen zu schenken, um – in den Worten von Millie Jackson – das Beste aus einer schlimmen Situation zu machen. Stattdessen kroch ich, vor mittlerweile allzu vertrauter Scham und Wut heiß errötet, zurück ins Zelt, zog meinen Pyjama an und wartete auf den Schlaf.
Im kalten Licht des Tages und über einer Tupper-Schüssel mit noch kälterem Müsli, kratzte ich all meinen verbliebenen Mut zusammen und fragte ihn, weshalb er nicht mit mir hatte schlafen wollen.
Er antwortete fast beiläufig, mit meiner Forderung nach Sex hätte ich »wie eine wütende Lehrerin« geklungen, was ihn komplett abgetörnt hätte. Lassen wir mal die Tatsache außer Acht, dass Lehrerin-Schüler-Affären zu den ältesten Mustern für Erotik gehören: Als ich ihm gezeigt hatte, dass ich eine proaktive, dem Anschein nach selbstbewusste und sexuelle Person war, hatte er mich sogleich in die Rolle einer wütenden, alternden und abseitigen Autoritätsperson gesteckt, gegen die er rebellieren musste. Weil man mir in meinen prägenden Jahren durch Werbung, Popkultur und scherzhaftes Gerede beigebracht hatte, alle Männer wären jederzeit scharf auf Sex, konnte ich im vollkommen nachvollziehbaren Desinteresse an Sex dieses Mannes nichts anderes sehen als eine schmerzhafte persönliche Ablehnung. Und weil man ihm in seinen prägenden Jahren beigebracht hatte, »echte« Männer wären jederzeit scharf auf Sex, konnte er nicht einfach die Tatsache akzeptieren, dass er keinen Sex haben wollte, sondern musste in mir irgendwie die Bösewichtin, die alte Hexe, die Tyrannin sehen – und die ganze Episode als meine Schuld betrachten. Ist man zu willig, ist man widerlich, ist man nicht willig genug, ist man die Heißmacherin, ist man zu gierig auf eine Bindung, wird man sitzengelassen. Wie gesagt, ich hätte das Zelten sein lassen sollen.
Nicht, dass einen ein Leben urbaner Kultiviertheit vor furchtbaren Dates schützen könnte, bei weitem nicht. An ganz gewöhnlichen Orten in der Stadt wurden Freundinnen von mir schon gefragt, wie viel ihre Zunge wiege oder ob ihre Klitoris »chinesisch« aussehe, oder ihnen wurde mit kartographischer Genauigkeit die Vagina der Exfrau ihres Gegenübers nach der Entbindung beschrieben. Ich kenne Leute, die nach einem One-Night-Stand gebeten wurden, auf die Eidechse von jemandem aufzupassen, die einen Nachtbus nach Hause nahmen, nachdem ihnen bewusst geworden war, dass ihr Date ihrem Cousin aufs Haar glich, oder die nach einem Jahr (und einem wichtigen Feiertag, an dem sie seine Eltern treffen wollten) herausfanden, dass ihr Freund tatsächlich verheiratet war und mit seiner Frau zusammenlebte. Ich weiß von Tinder-Dates, die noch am selben Abend als Begleitung auf einer Hochzeitsfeier voller Fremder endeten, von Menschen, denen auf OkCupid der eigene Bruder vorgeschlagen wurde, und von Freundinnen, die auf Guardian Soulmates um Visums-Ehen gebeten wurden. Meine Dates waren nicht schrecklich, weil ich so gern in der freien Natur war, sondern weil Dating in vielen Fällen schrecklich ist.
Die Frage lautet natürlich, weshalb ich es darauf anlegte, mit diesen beiden ausgesprochen ungeeigneten Männern eine Verbindung zu schaffen. Warum schenkte ich meine Wochenenden einem totalen Bindungsphobiker und einem Phantasten? Wieso fühlte ich mich von Leuten angezogen, deren Alter, Wohnort, Lebensstil und Glaubenssätze es unmöglich für mich machten, je ihre Freundin zu werden? Wozu so viel Energie an etwas verschwenden, das ohnehin zum Scheitern verurteilt war? Tja, dieses Rätsel zu lösen, kostete mich buchstäblich Tausende Pfund und mehrere Jahre in einem cremefarbenen Zimmer, in dem ich auf eine Jalousie starrte und mit einem Therapeuten sprach. Wenn ich mit dem erworbenen Wissen zurückblicke, kann ich euch verraten: Ich versuchte deshalb so zielstrebig, inkompatible Männer dazu zu bringen, sich in mich zu verlieben, weil ich mich tief in meinem Inneren nicht wertvoll genug und auch nicht bereit für eine echte Bindung fühlte.
Manchmal rennt man hinter Menschen her, die man nicht bekommen kann, um sich vor der Verletzlichkeit einer echten Beziehung mit einem Menschen, den man bekommen kann, zu schützen. Und echte Beziehungen machen einen verletzlich: Damit sie funktionieren, muss man der anderen Person seine Fehler, seine Schwächen, seine Wünsche, seine geheimen Ängste und seine wahren Absichten offenbaren. Man muss die Rüstung um sein Herz ablegen und es einem anderen Menschen anvertrauen, selbst wenn das bedeutet, dieser könnte es zerbrechen. All das fällt einem extrem schwer, wenn man aufgrund einer Phase des Umbruchs durch Trennungen, Karrierewechsel, Verlust von Freundschaften oder Veränderungen im eigenen Körper das Gefühl dafür verloren hat, wer man ist und was man will.
Dank einer gewichtigen Trennung, der ziemlich erfolglosen Partnersuche, der beruflichen Erfolge Gleichaltriger bei eigener finanzieller Stagnation und den lange ignorierten Störungen in meiner Kindheit hatten mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein sich in einen feuchten Lappen verwandelt, der unter der Spüle vor sich hin moderte. Ungebremst war aus meinem natürlichen Hang zur Selbstkritik eine lodernde Flamme des Selbsthasses geworden, wie ein Zippo-Feuerzeug, bei dem das Rädchen abgebrochen ist. Als Folge hatte ich unbewusst das Gefühl bekommen, ich wäre es nicht wert, geliebt zu werden. Und wenn man das Gefühl hat, man wäre es nicht wert, geliebt zu werden – ob als Folge von Ablehnung, Trauma, einer schwierigen Kindheit oder was auch immer –, dann ist es unglaublich, mit wie viel Sicherheit man die Leute aufspüren kann, die Liebe nicht erwidern. Altersunterschiede, Entfernung, Süchte, Leute, die bereits in einer Beziehung stecken, kollidierende Sexualitäten: Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, die eigene Suche nach Liebe und Bindung zu sabotieren, während man nach außen alle Merkmale einer Person aufweist, die ernsthaft eine Beziehung anstrebt. Wenn man unpassende Menschen datet, kann man sich mit seinen Freundinnen um einen Tisch im Pub versammeln und schreien, wie sehr man sich einen Partner wünscht, die Wunden der jüngsten Zurückweisung präsentieren, über die Untauglichkeit aller einem je über den Weg laufenden Kandidaten klagen, betteln, jemandem vorgestellt zu werden, stöhnen, was für eine gute Partnerin man wäre, ohne tatsächlich irgendjemanden Passendes nah an sich heranzulassen. Das ist so, als würde man seinen Kühlschrank mit Mist füllen und sich dann beschweren, dass kein Gemüse mehr reinpasst. Als würde man Scheiße essen. Und diejenigen von uns, die sich im Fluss befinden, können jahrelang so weitermachen.
Das Komische ist, während dieses ganzen Frischluft-Zurückweisungs-Fiaskos hielten viele meiner glücklich gebundenen Freundinnen mein Leben für beneidenswert. Da war ich, lebte das Singleleben, reiste durchs Land, hatte Sex mit glamourösen Fremden, schlief unter den Sternen und häufte lustige Anekdoten an wie Chips im Casino. Für die Paare in meinem Umfeld war ich sowohl Unterhaltung als auch Warnung. Für Menschen, die sich bereits im Für-immer-zusammen-Lager befanden – die sich gemeinsam ein Haus gekauft, geheiratet, die Verhütung abgesetzt oder schon ein Baby bekommen hatten –, war mein Leben die perfekte Verkörperung all dessen, was sie eingetauscht hatten. Ich hatte Freiheit, ich hatte Vielfalt, ich hatte eine gesunde Geringschätzung für meine eigene Sicherheit. Während sie zwei Wochen im Voraus eine Babysitterin und einen Abend voller Fläschchenmahlzeiten planten, nur um drei Stunden außer Haus zu verbringen und ein Essen zu sich zu nehmen, das sie nicht selbst gekocht hatten, tobte ich über eine taufeuchte Wiese mit jemandem, der womöglich versuchte, meinen BH mit seinen Zähnen zu öffnen. Erst später, wenn ich auf ihren Sofas saß, mit aschfahlem Gesicht und abgekauten Fingernägeln, und ihnen erzählte, wie ich Orgasmen vorgetäuscht oder eine Geschlechtskrankheit riskiert oder nachts geweint hatte, weil ich mich so einsam fühlte, erwischte ich sie dabei, wie sie ihren Partner irgendwie erleichtert anblickten.
Im Herbst jenes Jahres hatte ich genügend Freundinnen dabei zugesehen, wie sie Liebe fanden, um zu wissen, dass ich ebenfalls einen Partner wollte. Ich wusste, dass ich, auch wenn die Zeit gegen mich arbeitete und auch wenn ich es vor anderen vielleicht noch nicht zugeben mochte, eines Tages ein Baby haben wollte. Und sollte ich das Glück haben, schwanger zu werden, wollte ich, so viel war mir ebenfalls klar, dass das Baby mit seinem Vater aufwuchs. Aber irgendwo entlang der Fallschirmleinen meines Lebens hatten sich die Botschaften verknotet. Solange ich nicht genügend Selbstbewusstsein aufbaute, um wahre Intimität, echte gegenseitige Abhängigkeit und absolute Verbindlichkeit von jemandem zu verlangen, war ich nicht bereit für eine Beziehung, von einem Baby ganz zu schweigen.
Als Paar wird man mit viel größerer Wahrscheinlichkeit zu guten Eltern, wenn beide das nötige Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl besitzen, um Hilfe einzufordern, Schwäche zu zeigen, einander zu vertrauen, Konflikte zuzulassen, ehrlich zu sein und Unsicherheit zu ertragen. Ich war noch nicht einmal stark genug, jemanden zu bitten, nicht mit anderen Menschen zu schlafen, und schon gar nicht, jemanden um eine lebenslange Verpflichtung und Kinder zu bitten. Ich hatte so viel Angst davor, abgelehnt zu werden, dass ich jeden potenziellen Partner auf Abstand hielt und nur das zeigte, was ich für meine guten Seiten hielt, Ambivalenz vorspielte und mich gleichgültiger gab, als ich war. Ich hatte so viel Angst davor, mir könnte das Herz gebrochen werden, dass ich mich zu Menschen hingezogen fühlte, die mich nie nah genug an sich heranließen, um sie zu lieben. Ich konnte so schwer zugeben, was ich eigentlich wollte (weil es sonst auf lange Sicht so viel bitterer wäre, es nicht zu bekommen), dass ich mich verhielt, als würde ich gar nichts wollen.
Derart ausgestattet mit einem kometenhaften Sexualtrieb, einem Job voller Kontakte, einem adäquaten Einkommen und einem unterirdischen Selbstbewusstsein hatte ich Länder durchquert, Berge erklommen, Ozeane durchschwommen und Baumwollfelder vollgeheult, alles in dem vergeblichen Versuch, Menschen, die mich nicht lieben konnten, dazu zu bringen, mich zu lieben. Es war vermutlich eine Verzögerungstaktik, bis ich mich sortiert hatte. Es war ein Weg, mein Verlangen zu stillen, ohne meine Sehnsucht allzu genau zu betrachten. Es war eine Form des Selbstschutzes, auch wenn es nach Selbstsabotage aussah. Die wahre Arbeit musste ich an mir selbst erledigen: mit einem Therapeuten, allein, in meinem Tempo. Indem ich mir ungeeignete Kandidaten aussuchte, sorgte ich unbewusst dafür, dass ich Single blieb. Und indem ich dafür sorgte, dass ich Single blieb, zwang ich mich, meine Probleme zu lösen. Wie sich herausstellte, war das Campen nur ein in Zeltplane gehülltes Symptom, nicht die Ursache.
Ein paar Wochen nach dem Whitby-Debakel lag ich im Sprechzimmer meines Therapeuten, starrte auf die Splitter blauen Himmels, die auf beiden Seiten seiner Jalousien sichtbar waren, spielte mit einer Kette um meinen Hals und zitterte noch von dem kalten Bad, das ich gerade in Hampstead Heath genommen hatte. Zu diesem Zeitpunkt ging ich bereits seit fast einem Jahr in Therapie. Die Trennung von meinem Freund und die Erkenntnis, dass sich absolut niemand in meiner unmittelbaren Familie mehr in einer glücklichen langjährigen Beziehung befand, hatten damals den Ansporn gegeben. Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester und ich waren allesamt allein und hatten sich vor nicht allzu langer Zeit aus einer festen Partnerschaft gelöst. Aus diesem Grund war ich besorgt, wir alle könnten irgendwie pathologisch, genetisch oder grundlegend unfähig sein, gesunde, dauerhafte Beziehungen zu führen. Ich hatte Angst, tief in unserem Inneren wäre etwas kaputt, und ich wollte es reparieren.
An jenem Tag erzählte ich meinem Therapeuten etwas, eine so winzige Sache, dass ich mich beinahe schämte, sie zu erwähnen. Aber zugleich, das wusste ich, war es etwas so Machtvolles und Bedeutsames, dass es mein ganzes Leben umgekrempelt zu haben schien. Ich hatte den Schrank unter meiner Spüle aufgeräumt, alle Lappen in einem Eimer gesammelt, Päckchen mit Grassamen weggeworfen und eine Schnur aufgewickelt.
Während ich mich durch jahrelang angesammelten Krempel wühlte, dachte ich an jenes Wochenende, das ich auf einem Berg verbracht hatte, neben einem rauschenden Bach schlafend und mich fragend, ob der Mann neben mir sich gerade verliebte. Ich dachte an sein Zwinkern im Zug, während mein Herz ganz leer wurde. Ich dachte an die Nachrichten, die ich ihm seitdem gesendet hatte und die allesamt unbeantwortet geblieben waren. Unter einer alten Thermoskanne hatte ich ein paar weiße Kabelbinder und eine Dose Kiwi-Schuhpolitur gefunden. Ich drehte den Deckel auf, um zu sehen, ob die Politur vertrocknet war, und wurde von einem Geruch getroffen, als schlüge mir jemand mit einem Paddel gegen die Magengrube. Petroleum, Leder, Staub, Alter, Zeit, Paraffin, die Vergangenheit. Ich war für einen Augenblick zurückversetzt worden in die alte Stiefelkammer meiner Großmutter: die große rote Tasche, mit der sie auf dem Markt einkaufen ging, die Wachsjacken meines Großvaters, die längst vergessenen Putzgeräte aus dem Innovations-Katalog, die Hundefutter-Wasser-Doppelschüssel, auf deren Oberfläche dünne blonde Labradorhaare trieben, die grünen Steppmäntel, der Ständer voller Wanderstöcke, seine Kappen, ihre Schals. Irgendwie schien jener Geruch mich zu durchspülen, mich auszufüllen wie Milch, die in eine Schale mit Zucker geschüttet wird.
Als ich dort zwischen Putztüchern und Marmeladengläsern auf meinem Küchenfußboden saß, kam mir ein glasklarer Gedanke: Ich habe mehr verdient. Das war es. Das war alles. Ich war ein Mensch. Ich hatte eine Kindheit gehabt, hatte eine Großmutter, die Eier in Butter pochierte, hatte einmal meinen Arm in eine Regentonne getaucht, um zu spüren wie das Wasser sich kräuselte, war auf Welsh-Ponys mit Rücken wie eine Berg-und-Tal-Fahrt geritten, hatte einen Großvater mit Hosenträgern und zwei hölzernen Haarbürsten vor seinem Badezimmerfenster, war mit dem Schlauch abgespritzt worden, wenn ich im Sommer nackt im Garten herumlief, hatte mich in einem Kohleschuppen versteckt, hatte einen Fußball gegen ihre Garagentüren gekickt, hatte direkt vom Baum Kochäpfel gegessen, die so sauer waren, dass mein Gesicht sich verzog wie ein Senkloch, war eingeschlafen, während ich die Risse in der Decke meines Schlafzimmers betrachtete, und war im Pyjama die Treppengeländer hinuntergerutscht. Ich war ein vollständiger Mensch, mit einer vollständigen Vergangenheit. Und deshalb hatte ich mehr verdient als nur die kleine Nebenrolle im Sexleben eines anderen.
Ich lege eine Pause ein. Mein Therapeut sagt nichts. Bewegt sich nicht einmal. Wie eine Karikatur Sigmund Freuds sitzt er während unserer Stunden hinter mir, und ich kann sein Rasierwasser riechen, aber sein Gesicht nicht sehen.
Ich starre weiter auf die Jalousien. Ich warte. Er sagt noch immer kein Wort.
Also fahre ich fort: »Ich dachte einfach – ich habe eine ganze Geschichte hinter mir, mein ganzes eigenes Leben. Das heißt, dass ich einen ureigenen Wert habe. Ich bin nicht die Schönste, Intelligenteste, Erfolgreichste. Aber ich bin wertvoller, als mich all diese Männer behandelt haben.«
Eine weitere Pause entsteht. Ich halte meine Kette in der Hand. Ich starre hinauf an die Decke. Tausende Pfund, stundenlanges Reden, und endlich habe ich etwas gesagt, das schließlich zu einer Veränderung führen wird.